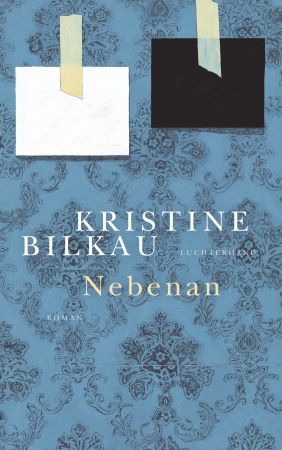Christian Oelemann : Totmann
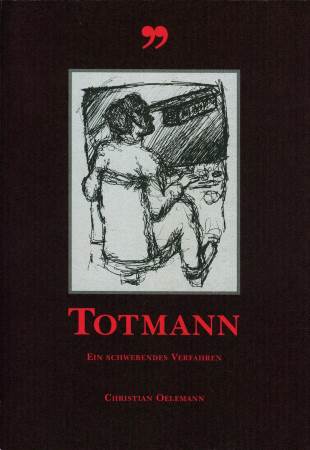
Inhaltsangabe
Kritik
Georg Berger wurde schon in der Grundschule gehänselt und erhielt den Spitznamen SchlauBerger.
Die Anlage zum Schrätel habe ich schon als kleiner Junge nicht verheimlichen können. Und meinen Eltern war das ganz recht so. Ich brachte wenigstens nicht andauernd Kinder ins Haus. Kinder! […] Meine Eltern hassten Kinder im Grunde, wissen Sie. Und ich brachte nicht nur nicht andauernd Kinder ins Haus, sondern nie.
Allein deswegen habe ich ja schon als kleiner Junge Gott gehasst. Gott sah alles, wie man mir eingetrichtert hatte, also hasste ich ihn. Ich glaubte an ihn, das schon. Aber ich liebte ihn nicht, und deshalb fühlte ich mich schuldig.
Mit mir hat man es nicht leicht. Nie leicht gehabt.
Zum Verdruss seines Vaters träumte er von einer Karriere als Schriftsteller, bis er sich vor 16 Jahren bei den Wuppertaler Stadtwerken bewarb und Schwebebahnfahrer wurde. Seither ist er der Schwebebahnschorsch. Freunde hat der eigenbrötlerische 56-Jährige ebenso wenig wie eine Frau, aber seit zwölf Jahren sind Günter und Jochen seine Skatbrüder.
Es gibt weltweit nur ungefähr fünfundsiebzig Schwebebahnfahrer, und die naturgemäß allesamt in Wuppertal.
Die Schwebebahnfahrer bilden keine Gemeinschaft. Nicht einmal eine Weihnachtsfeier wird organisiert.
Es gibt nicht den Schwebebahnfahrer schlechthin. Wir sind alle Individuen. Alle einmalig, das ist ja das Groteske! Das Einmalige haben wir gemeinsam.
Nun soll Georg Berger sich einen Tag lang von einer Schriftstellerin aus Kamen begleiten lassen, die darüber ein Buch schreiben möchte. Beck, sein Chef, hat ihm das eingebrockt.
Auf die eine oder andere Art steckt Schikane dahinter, ich bin sicher.
Georg erinnert sich noch gut an die Leute vom WDR, die fünf Runden mit ihm fuhren und ihn fortwährend filmten. Davon wurden dann gerade einmal drei Minuten im Fernsehen gezeigt. Man sah Georgs Glatze von hinten und hörte, wie er zweimal die Haltestelle „Alter Markt“ ausrief. Das war alles. Diese Frau Winding will nun sogar alle sieben Runden einer Schicht mitfahren. Georg weiß nichts über sie. In der Buchhandlung schauten sie für ihn eigens in den Computer, fanden aber den Namen Winding nicht.
Hauptsache, sie raucht nicht. Für mich ist es immer der erste Gedanke, wenn ich es mit einem neuen Menschen zu tun bekomme: Raucht er oder raucht er nicht. Raucht er, kann er mir gleich gestohlen bleiben. Raucht er nicht, hängt es davon ab, wie er sonst auf mich wirkt. Manche Menschen rauchen nicht, haben aber etwas dermaßen Raucherhaftes an sich, das allein ich schon nicht ertragen kann, seitdem ich selbst nicht mehr rauche.
Am Abend vor dem Tag mit der Schriftstellerin sitzt Georg in seiner Wohnung, trinkt ein Gläschen Cognac nach dem anderen, insgesamt neunzehn, und malt sich aus, was auf ihn zukommen könnte.
Durch den Kakao ziehen lassen werde ich mich nicht, das steht fest. Zumindest dann nicht, wenn ich es rechtzeitig merke.
Über die Geschichte der Wuppertaler Schwebebahn wird Frau Winding sich wohl bereits vorab informiert haben. Aber Georg wird ihr erklären, was es bedeutet, Schwebebahnfahrer zu sein.
Ich habe einen Dienst abzuleisten, Oberbarmen – Vohwinkel und retour, siebenmal am Tag. Das ist auf eine Art anstrengend, die ich Ihnen gar nicht beschreiben kann.
Er wird ihr die Hebel zeigen und vor allem die Totmannseinrichtung.
Ein Schwebebahnfahrer ist ein Totmannspedalbediener, sonst eigentlich nichts. […]
Alles ist reglementiert, also geregelt. Am besten, Sie nennen mich gleich Totmann. Das ganze kriegt dann einen enormen Witz. Pars pro toto, wenn Sie verstehen. Wenn nicht, ist es auch egal.Die paar Handgriffe, die ich zu machen habe, könnten mit Leichtigkeit vom Computer übernommen werden.
Technisch wäre es längst möglich, die Wuppertaler Schwebebahn fahrerlos zu betreiben.
Aber noch ist es nicht so weit. Noch bleiben die Fahrer und vermitteln den Fahrgästen ein anachronistisches Sicherheitsgefühl.
Der Vorteil dieser Überflüssigkeit ist, dass Georg auch während der Schicht seinen Gedanken freien Lauf lassen kann. Er hat im Dienst schon den Plot eines Thrillers entworfen: Eine Gruppe von Palästinensern kapert die Wuppertaler Schwebebahn.
Ich brauche meine Freiheit, und die habe ich bei meinem Dienst.
Nur selten ist die volle Aufmerksamkeit des Fahrers erforderlich.
Wenn es einmal schaukelt, dann herrscht mindestens Windstärke 7 vor, eher sogar mehr. Dann wird das Schwebebahnfahren urplötzlich wieder zum Abenteuer, zumindest ein paar Minuten lang. […] Irgendwann kommt dann allerdings per Funk eine Direktive, und schon ist das abenteuerliche Flair auch schon wieder zunichte. Dann stehst du vielleicht ein, zwei Stunden im Bahnhof und bekommst die Strecke einfach nicht freigeschaltet.
Beim Schwebebahnfahren hat Georg eine Menge gesehen. Am 18. August 1988 sah er beispielsweise im Vorbeifahren die Gladbecker Geiselnehmer. Und als er am 6. März 1984 in die Wagenhalle fuhr, erblickte er die Überreste einer 67-jährigen Selbstmörderin, die sich hinter Schwelm vor einen Zug geworfen hatte und bis Oberbarmen mitgeschleift worden war.
Manchmal fährt eine ganze Schulklasse mit.
Was ist, wenn Sie mal Pipi müssen, hat mich neulich ein kleiner Junge gefragt. Pragmatisch, nicht wahr? Es ist ein Problem, das hatte der Junge absolut richtig erkannt. Sie müssen zusehen, dass sie während der Runde nicht müssen. […] Mal eben rechts ‚ranfahren scheidet naturgemäß aus.
Georg vergleicht die Schwebebahn mit dem Geschlechtsverkehr:
Die Schwebebahn ist der Phallus, der auf sein Ziel zusteuert. Das Ziel ist jeweils der nächste Schwebebahnhof, die Vagina. Er will, er muss da hinein. Und naturgemäß auch wieder heraus.
Das Weibliche zieht uns hinan, Faust. Kennen Sie, das ewig Weibliche heißt es sogar, also der ewig immer gleiche Scheißbahnhof Völklinger Straße. Wir nähern uns der Völklinger Straße. Der Schoß, die Vagina lockt, sendet Geruch aus wie im Traum, vereinnahmt uns völlig, wir verschwinden darin total und entleeren uns. All die hinauswuselnden Menschen, die es so eilig haben, sind die Spermatozoen.
Bis vor 30 Jahren gab es in Barmen noch eine Berg- bzw. Zahnradbahn. Die führte zum Toelleturm hinauf.
Mein Vater hat uns sonntags gerne zum Toelleturm geschleift, und ich habe die anderen Sonntägler, die nämlich, die mit der Bergbahn hinauffuhren, immer auf das Innigste beneidet. Für uns kam es nicht in Frage, mit der Bergbahn zum Toelleturm hinaufzufahren. Das ist etwas für Ommas und Oppas, hatte mein Vater entschieden. Ob meine Mutter ihre Kopfschmerzen hatte, interessierte ihn nicht. Solange wir noch zwei Beine haben, die uns überall hintragen, brauchen wir keine Bergbahn, so mein Vater.
Als die Barmer Bergbahn 1959 stillgelegt wurde, gehörte Georgs Vater allerdings zu den Leuten, die am lautesten dagegen protestierten. Der Vater, ein Oberregierungsrat, hielt die Parteien einschließlich der CDU, deren Mitglied er war, allesamt für „Waschlappenparteien“. Kommunisten, Schwule („Hinterlader“), Alkoholiker, Raucher und Muttersöhnchen verabscheute er gleichermaßen. Seinen Sohn – ein Einzelkind – verspottete er als „Mammis Liebling“.
Geschlagen hat er mich übrigens nie, kein einziges Mal. Die Sarkasmen meines Vaters taten jedoch mehr weh […]
Dass Georg als Kind des Öfteren krank war, betrachtete sein Vater als Zeichen von Schwäche. Im Alter von zwölf Jahren lag der Junge mit Ziegenpeter im Bett und las „Im Westen nichts Neues“. Als sein Vater ihn dabei erwischte, schimpfte er:
Hätte ich mir ja denken können! Mein Herr Sohn macht in Pazifismus!
Drei Jahre später gab Georg der Nachbarstochter Moni Geld für einen Kuss. Sie merkten nicht, dass sie von seinem Vater beobachtet wurden. Als Georg heimkam, empfing der Vater ihn mit den Worten:
Deine Mutter hat sich vor lauter Gram, dass du dich mit der Schlampe herumtreibst, erhängt. Nein: Deine arme Mutter hatte er gesagt. Arme Mutter.
Selbstverständlich war das eine Lüge, aber Georg erschrak und weinte dann, als er seine Mutter ins Zimmer kommen sah.
Mit 18 hatte er noch keine andere sexuelle Erfahrung als Monis Kuss und das allabendliche Masturbieren. Dann hievte Iris, die Sekretärin seines Vaters, in einem Augenblick, in dem sie ohne Zeugen aufeinandertrafen, unvermittelt die rechte Brust aus dem Ausschnitt.
Das Ganze hatte etwas dermaßen Peinliches, dass ich nicht mehr wagte, meinen Kopf wieder zu heben. Ich lutschte und saugte an Iris Brust, bis sie sie mir irgendwann entzog und mit deutlich genervtem Unterton beschied, ich solle es gut sein lassen, das führe eh zu nichts.
Der Vater nahm schließlich seinen Sohn zur Seite und wies ihn darauf hin, dass er über entsprechende Beziehungen verfügte für den Fall, das Georg ein Mädchen schwängern würde. In der Öffentlichkeit sprach er sich aber gegen eine Abschaffung des Paragrafen 218 aus, also gegen eine Lockerung des Abtreibungsverbots.
Wenn er wenigstens konsequent das Arschloch gewesen wäre, das er war. Aber nein, nicht einmal darauf war Verlass.
Mit 19 zog Georg zu Hause aus.
Um sich an seinem Vater zu rächen, heiratete er und lud ihn nicht zur Hochzeit ein. Die Ehe mit Klara hielt nur ein Jahr.
Ich denke nicht gerne daran. […] Wie ein Schemen sehe ich Klara im Bett sitzen und sagen, machen wir uns doch nichts vor, Georg.
Was meinst du denn damit, wollte ich wissen.
Ach tu doch nicht so, als ob du nicht wüsstest, dass ich schwanger bin. Ein Blinder sieht das doch!
Ich hatte es nicht gewusst. Man sah nämlich gar nichts, verstehen Sie. Ist es von mir, habe ich sie gefragt.
Am nächsten Tag kamen zwei Kerle mit einem VW-Bus und holten Klaras Sachen ab. Die Scheidung folgte. Solange Georg sich als Schriftsteller versuchte und nichts von ihm zu holen war, ließ Klara ihn in Ruhe, aber sobald er als Schwebebahnfahrer das erste Geld verdiente, wurde er schriftlich aufgefordert, einen Ausbildungsbeitrag für den Sohn Christian zu zahlen. Bevor Georg einen Vaterschaftstest beantragen konnte, verunglückte Christian allerdings mit dem Motorrad tödlich.
Genau an dem Tag, an dem Georg 37 Jahre alt wurde, starb seine Mutter. Er war betrunken, als sein Vater anrief. Dr. Pferdemenges, ein Kriegskamerad des Witwers, schrieb zwar Herzinfarkt auf den Totenschein, aber Georg ist überzeugt, dass seine Mutter sich mit einer Überdosis Tabletten das Leben genommen hatte.
Der Vater forderte ihn ein paar Tage später auf, am Sonntagmittag vorbeizukommen, um das Finanzielle zu regeln. Als Georg hinkam, saß eine junge Frau bei seinem Vater.
Janette, sagte er. Eine gute Bekannte. Macht gerade ihren Doktor. Verdient sich was nebenbei. Gell, man muss was tun heutzutage?
[…] Zu sagen das ist Janette, hätte doch gereicht. Von mir aus, dass sie ihren Doktor machte, was übrigens nicht einmal stimmte, sie stand kurz vor dem zweiten Staatsexamen als Lehrerin für Deutsch und Geschichte. Aber egal! Das Hinzuverdienen war eine dermaßen plumpe Anspielung auf seine Potenz, dass ich am liebsten auf den Teppich gekotzt hätte, um es einmal drastisch zu sagen. In diesem Haus war nicht einmal zwei Wochen zuvor meine Mutter gestorben, meine einzige Liebe bis dato, und mein Vater vergnügte sich mit Janette im Rahmen des Dazuverdienens!
Nach diesem Besuch war Georg noch keine zwei Stunden zu Hause, als die Prostituierte, die er bei seinem Vater kennengelernt hatte, bei ihm in der Tür stand. Janette sei ihr Künstlername, erklärte sie, sie heiße Lucrezia Franca. Georg erfuhr später, dass sein Vater ihr 100 D-Mark gegeben hatte, damit sie seinen Sohn aufsuchte. An diesem Abend rauchten sie zusammen einen Joint, tranken etwas und schliefen dann miteinander. Lucrezia blieb bei ihm, 42 Monate lang, obwohl sie de jure noch verheiratet war, und zwar mit einem Rechtsanwalt, der zugleich als ihr Zuhälter fungierte. Die Eheschließung hatte ihr die deutsche Staatsangehörigkeit verschafft. Ihren Scheidungstermin erlebte sie nicht mehr. Sie wurde nur 28 Jahre alt.
Georg schrieb zwar um die 200 Erzählungen und mehrere hundert Gedichte, aber veröffentlicht wurde nur eine Erzählung mit dem Titel „Spätgeburt“. Ohne sein Wissen hatte Lucrezia Kopien des Manuskripts an mehr als 30 Verlage geschickt. Obwohl er mit dieser einen Ausnahme keinen Erfolg hatte, träumte er davon, der Autor eines epochalen Romans zu sein.
In der Überzeugung genial zu sein, war ich im Grunde viel zu sehr mit dem Genitalen beschäftigt.
Weil Georg keine Einnahmen hatte und aus Hass die Schecks zerriss, die ihm der Vater schickte, lebte das Paar von dem, was Lucrezia verdiente. Georg nahm das hin, wollte nur, dass sie ihre Freier nicht mit in die Wohnung brachte und seinen Vater mied.
Sie hurte nur im Rahmen des unbedingt Nötigen.
Wenn Sie noch nicht erfahren möchten, wie es weitergeht,
überspringen Sie bitte vorerst den Rest der Inhaltsangabe.
Im September 1980, also vor 16 Jahren, kam Georg angetrunken nach Hause. Schon im Treppenhaus roch der das Rasierwasser seines Vaters. Ekelerregend. Er riss die Tür auf. Lucrezia war allein, saß nackt auf einem Stuhl, die Lehne zwischen den gespreizten Beinen. Zornig rannte er nach unten, um den Vater auf der Straße einzuholen, fand ihn aber nicht. Zurück in der Wohnung, öffnete er die Flasche Cognac, die sein Vater mitgebracht hatte, und trank davon. Er genoss es, dass Lucrezia offenbar Angst vor ihm hatte. Sie sagte:
Er interessiert sich wirklich für dich. Er will helfen, nur lässt du ihn nicht. Er ist selbst der unglücklichste Mensch, dass er nicht an dich herankommt.
Ich hatte doch nicht vor, dich zu verletzten, wimmerte Lucrezia mit schmerzverzerrter Stimme. Ich wusste doch nicht, dass du so verletzt sein würdest. Das konnte ich doch nicht wissen. Ich wusste nur, wir brauchen dringend Geld, und dein Vater hat mir Geld angeboten, viel Geld, verstehst du, wenn ich
Wenn was?
wenn ich ihn ein wenig auf dem Laufenden hielt.
Lucrezia beteuerte schluchzend, in den dreieinhalb Jahren ihres Zusammenseins keinen Sex mehr mit seinem Vater gehabt zu haben, aber Georg war die Vorstellung unerträglich, dass sein Vater in dem Manuskript des halb fertigen Romans „In der Schwebe“ gelesen haben könnte.
Die Vorstellung, dass mein Vater erfahren hatte, wie ich wirklich über ihn dachte, war nicht schlimm. Im Gegenteil, schlimm war, dass ich es ihm nie hatte sagen können. Das war ja das Schlimme, Frau Winding. Schlimm war, dass er sich über meinen Hass ganz sicher kranklachen würde. Sich aufgeilen an meinem Hass, sich weiden an meiner Empfindlichkeit, wie er es schon getan hatte, wenn ich im Rock meiner Mutter Schutz vor seinem Zynismus suchte, dreijährig, vierjährig, was weiß ich.
An der Stelle funktionierte unsere Kommunikation nicht mehr, Frau Winding.
Lucrezia schluchzte. Plötzlich kippte sie seitwärts vom Stuhl und blieb mit offenen Augen am Boden liegen, während sich eine Urinpfütze bildete. Georg rief seinen Vater an und berichtete lallend, dass Lucrezia tot war. Während des Telefonats verlor er das Bewusstsein. Er kam erst wieder zu sich, als sein Vater und Dr. Pferdemenges bereits neben ihm standen.
Merke dir jetzt eines, mein Junge, sagte der Göttergleiche. Du hast dein Mädel nicht angerührt. Sie hat einen ganz gewöhnlichen Schlag bekommen. Einen ganz gewöhnlichen Schlag. Ihr habt euch gar nicht angefasst. Sie ist schlichtweg umgekippt. Hast du das verstanden? Zu viel gesoffen und umgekippt und hopp, verstehst du!
Erst in diesem Moment schlich sich in mein Bewusstsein, dass ich sie getötet haben könnte, vielleicht tatsächlich getötet hatte. Zumindest war es möglich, dass ich sie getötet hatte. Wie auch immer, ich wusste es nicht. Und so ist es bis heute, Frau Winding. Ich weiß es nicht. Kann sein, dass ich sie umgebracht habe. Vielleicht ist ja noch ein Filmriss dazwischen. Vielleicht hat sie ja schon tot auf dem Stuhl gesessen.
Von dem Roman-Manuskript war sogar sein Vater begeistert und er ließ seine Beziehungen spielen, damit ein renommierter Verlag in Frankfurt am Main das Buch ins Programm nahm, aber Georg wollte nichts mehr mit Literatur zu tun haben. Er bewarb sich bei den Wuppertaler Stadtwerken und wurde Schwebebahnfahrer. Eine Fernsehillustrierte ist seither das einzige Druckerzeugnis in seiner Wohnung. Das Literarische Quartett schaute er sich zwar an, aber nur, weil sich herausgestellt hatte, dass er Marcel Reich-Ranicki gut imitieren konnte.
Wissen Sie, was ich über Goethe denke? Ein aufgeblasener, wichtigtuerischer Phrasenheini, mehr nicht. Ein Vielschreiber, der sich überall eingemischt hat mit seiner Schreiberei. Ein angepasster Karrierist. Ein pädophiler Faun. Einer, der nach oben buckelt und nach unten tritt. Ein richtiger Deutscher, wenn Sie verstehen.
Der Roman „Totmann. Ein schwebendes Verfahren“ von Christian Oelemann besteht aus dem Monolog eines Wuppertaler Schwebebahnfahrers, der abends in seiner Wohnung sitzt, Cognac trinkt und sich vorstellt, was er am nächsten Tag einer Schriftstellerin erzählen könnte, die beabsichtigt, etwas über die Schwebebahn zu schreiben und deshalb angekündigt hat, sieben Runden mit ihm fahren zu wollen. Das Thema Schwebebahn bildet denn auch so etwas wie einen roten Faden durch die 19 als „Gläschen“ bezeichneten Kapitel. (Es sind übrigens ebenso viele wie es Stationen an der Schwebebahnstrecke zwischen Oberbarmen und Vohwinkel gibt.)
Das erinnert an das Ein-Personen-Theaterstück „Der Kontrabass“ von Patrick Süskind.
Der Schwebebahnschorsch plaudert vor sich hin und kommt dabei vom Hölzchen aufs Stöckchen. In der ersten Hälfte des Buches „Totmann“ unterhält Christian Oelemann die Leser vor allem mit vergnüglichen Gedankensprüngen, originellen Einfällen und viel Sprachwitz. Dann kippt die Darstellung vom Kabarettistischen ins Tragische um und drängt auf einen dramatischen Höhepunkt zu. Wie in einem guten Thriller sorgen Andeutungen für Spannung, und erst am Ende wird klar, was geschehen ist.
„Totmann. Ein schwebendes Verfahren“ dreht sich um einen bestürzenden Vater-Sohn- und Generationen-Konflikt. Allmählich stellt sich heraus, dass nicht nur der Vater charakterliche Fehler hat, sondern auch der Sohn psychisch angeschlagen ist und in seiner hasserfüllten Verblendung die Wirklichkeit verzerrt wahrnimmt.
All dies entwickelt Christian Oelemann im Plauderton der Hauptfigur und beweist dabei ein außergewöhnliches Sprachgefühl.
Es ist ein Jammer, dass es „Totmann. Ein schwebendes Verfahren“ derzeit nur antiquarisch zu kaufen gibt. Das Buch hätte eine Neuausgabe und ein breites Publikum verdient.
Christian Oelemann wurde am 7. Oktober 1958 in Wuppertal als zweites Kind von Kurt und Ingeborg Oelemann geboren. Der Vater war Buchhändler, die in Indonesien als Tochter eines Missionars geborene Mutter Geigerin. In der Jugend interessierte sich Christian Oelemann mehr für Musik und Literatur als für die Schule. Mit 13 Jahren gründete er seine erste Band und besaß bereits einen Stapel selbst geschriebener Gedichte und Kurzgeschichten. Nach dem Zivildienst studierte er von 1980 bis 1985 Germanistik und Literaturwissenschaften, zog aber auch mit Jazz-Bands herum und ließ sich von dem elf Jahre älteren niederländischen Jazz-Pianisten Jasper van’t Hof unterrichten. 1996 veröffentlichte Christian Oelemann sein erstes Kinderbuch („Erich und die Fahrraddiebe“). Für das Hörspiel „Isabellas Welt“ wurde er 2007 mit dem Kinderhörspielpreis des MDR ausgezeichnet. Ab 2007 half er im Rahmen des Wuppertaler Projekts „Schulhausroman“ Schulklassen, einen Roman zu schreiben. Und er führt die Ronsdorfer Bücherstube seines Vaters in Wuppertal weiter.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2013
Textauszüge: © Jo Budde Atelier Verlag
Christian Oelemann (kurze Biografie)
Christian Oelemann: Nur raus damit!
Christian Oelemann: Isabellas Welt
Christian Oelemann: Dumme Gedanken
Christian Oelemann: Freundschaftspiel
Christian Oelemann (Hg.): Paternoster. Vom Auf und Ab des Lebens