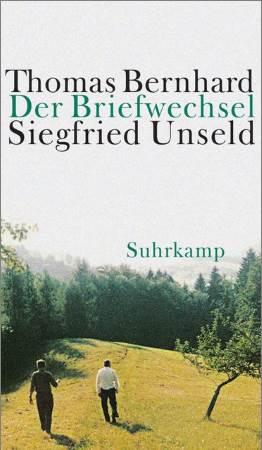Michael Krüger : Das falsche Haus

Inhaltsangabe
Kritik
Der Ich-Erzähler ist in der Redaktion einer der führenden Zeitungen im süddeutschen Raum, einem kritisch-liberalen Blatt, für die Rubrik „Das politische Buch“ verantwortlich, die nur von einer winzigen Minderheit der Leser wahrgenommen und „von den in diesen Jahren beängstigend wuchernden Todesanzeigen bedrängt“ wird.
Schon als Schüler war er als Eigenbrötler verschrien gewesen.
Ich war bis zur Bockigkeit in mich gekehrt. Wenn es möglich war, spielte ich Schach gegen mich selbst und freute mich, wenn einer von uns beiden gewann. (Seite 118)
Sein Biologiestudium brach er ab, um als Entwicklungshelfer nach Afrika zu gehen. Doch als er durchschaute, dass der größte Teil der Hilfsgelder „in der dunklen Bürokratie des Landes versickerte“, verlängerte er seinen Vertrag nicht, sondern verdingte sich zunächst als Hilfskraft am deutschen Seminar der Universität Kapstadt und arbeitete dann in einem internationalen Transportunternehmen, das ihn nach einem Jahr nach Buenos Aires schickte, wo er seinen dreißigsten Geburtstag feierte.
Ich habe es stets als ein Privileg, als eine besondere Gnade empfunden, nur eine lächerlich geringe Zeit in die Planung meines Lebens investiert zu haben. Obschon ich doch immer gearbeitet habe, war es mir mühelos gelungen, mich der sorgfältigen Verwaltung meiner Gaben zu entziehen […] Ich war zutiefst davon überzeugt, dass der größte Teil dessen, was ich ausführte, nicht für mich arbeitete, mein Leben bereicherte, sondern das Gegenteil bevorzugte: Etwas arbeitete gegen mich, zerstörte mein Leben, auch wenn es, von außen, so aussah, als würde es mein Leben ermöglichen und verschönern […] Ich hatte immer den Verdacht, dass das Leben von den meisten Menschen mit zu vielen Hoffnungen belegt wird, die nach und nach zerplatzen und eine fatale Leere hinterlassen, die unangenehm ist und auf alle Außenstehenden, aber auch auf Freunde, peinlich wirkt. (Seite 49)
Nach seiner durch politische Intrigen in Argentinien erzwungenen Ausreise wurde er Nachrichtenredakteur in Süddeutschland.
Ich ließ die Nachrichten, wie sie waren. Das Weltübel durfte nur nicht länger als drei Zeilen am Stück sein. (Seite 51)
Später übernahm er die Rubrik „Das politische Buch“ und begann, nebenher für die Wochenendbeilage der Zeitung das Loblied des Müßiggangs in Kurzgeschichten zu singen. Ein Auto besitzt er längst nicht mehr. Dabei hatte er das Glück, von einer unsympathischen Tante ein kleines Vermögen zu erben, das sich, als er dem Rat von Bekannten folgte und es in Aktien anlegte, so rasant vergrößerte, dass ihm schwindelig wurde und er die Bank beauftragte, alles wieder in konservative Anlagen umzuschichten.
Es wurde mir leichtgemacht, mich gegen das, was man in unserer Welt Erfolg nennt, zu immunisieren, weil alle um mich herum erfolgreich sein wollten. (Seite 52)
Seit längerer Zeit arbeitet er an einem Buch über die jesuitischen Indianer-Reduktionen in Lateinamerika. Eine Bibliothekarin in Nürnberg bringt ihm Handschriften, die eigentlich nur im Lesesaal eingesehen werden dürften, in die Wohnung.
Eines Tages erhält er von der Zeitungsredaktion den Auftrag, über einen mehrtägigen Kongress des Verbandes der Bibliothekare in Hamburg zu berichten.
Am Abend nach seiner Ankunft entdeckt er im Schaufenster eines Antiquariats eine sechsbändige Ausgabe der Werke von Johann Georg Hamann. Die kauft er am nächsten Morgen und bringt sie in sein Hotelzimmer, bevor er ins Congress-Centrum geht.
Um nicht mit anderen Journalisten ausgehen zu müssen oder gar als Repräsentant einer angesehenen Zeitung an den Tisch der Veranstalter eingeladen zu werden, sondern sich stattdessen in die Schriften von Johann Georg Hamann vertiefen zu können, verlässt er unmittelbar nach dem letzten Vortrag des ersten Tages das Congress-Centrum.
Zu Fuß macht er sich auf den Weg zu seinem Hotel, doch statt in die Innenstadt, gerät er in einen Außenbezirk von Hamburg. Plötzlich fliegt ein Ball auf die Straße und rollt unter ein geparktes Auto. Während ein Junge zu dem Auto läuft und sich bückt, sieht der Redakteur, wie der Ball auf der Straßenseite wieder zum Vorschein kommt.
Ich lief, ohne zu zögern, auf die Straße und versuchte den Ball, wie ich es früher gekonnt hatte, mit dem rechten Fuß aufzunehmen, um ihn mit dem linken Spann über das Auto hinweg dem Jungen zuzuspielen, stellte mich jedoch so ungeschickt an, dass der Ball, von mir korrekt getroffen, mit einem klatschenden Geräusch an der Seitenscheibe des Autos abprallte und mir aus kürzester Entfernung auf die Brust klatschte. (Seite 14)
Der Ball war offensichtlich durch Schmieröl gerollt; er hinterlässt auf dem Hemd einen großen Fleck. Die Mutter des Jungen, der Marcel heißt, bittet ihn ins Haus, führt ihn in das Gästebad im ersten Stockwerk und legt ihm, während er duscht, nicht nur ein frisches Hemd, sondern auch noch ein Paar Socken und eine Krawatte zurecht. Obwohl der Redakteur seit der Beerdigung seiner Mutter keine Krawatte mehr getragen hat, bindet er sie um, bevor er wieder hinuntergeht.
Marcel sitzt im Wohnzimmer und spielt mit einem Computer. Seine Mutter, eine ausgemergelte Blonde um die vierzig – „die Hälfte des Lebens vorbei, die schlechtere vor Augen“ (Seite 18) – schreit in ein winziges schnurloses Telefon und beschimpft den Gesprächspartner als „Scheißkerl“. Als der frisch geduschte Gast den Namen seines Hotels nennt, kommentiert sie: „Kinderstrich und Drogen, Amphetamine“ (Seite 36). Sie müsse für ein paar Stunden weg, erklärt sie ihm; er möge so lang auf Marcel aufpassen.
Der Junge geht bald in sein Zimmer und lässt den Babysitter allein im Wohnzimmer zurück. Wenn er hier wohnen müsste, denkt der Gast, würde er die neureiche, kitschige Einrichtung stark verändern.
Das Telefon klingelt. Ein Rüpel verlangt, die Hausherrin zu sprechen und kündigt drohend an, gleich da zu sein. Eine halbe Stunde später hämmert ein Kerl mit beiden Händen gegen das Panoramafenster. Statt zu öffnen, knipst der Redakteur das Licht aus, geht zu Marcel hinauf, der noch liest, obwohl es auf Mitternacht zugeht. Bei dem Mann im Garten handele es sich bestimmt um Max, den Dieb, meint Marcel ungerührt. Es sei richtig gewesen, ihn nicht hereinzulassen, denn Max würde das Haus ausräumen und habe Marcels Mutter schon einmal zusammengeschlagen. Seit er arbeitslos sei, betrinke er sich ständig und versuche, Marcels Mutter zu erpressen. Vorher habe er als Diener, Chauffeur und Leibwächter für ihren Vater gearbeitet.
Um kurz vor 3 Uhr nachts wird der inzwischen an Marcels Bett eingeschlafene Redakteur von der heimgekehrten Frau geweckt.
Eine deutliche Veränderung: Weggegangen war eine selbstbewusste, herrisch auftretende, die Welt überschauende Frau, zurückgekommen war ein armseliges, verlassenes Bündel. (Seite 75)
Am nächsten Morgen wundert Marcel sich nicht weiter darüber, dass der Fremde neben seiner Mutter im Bett liegt. Er gehe jetzt zur Schule, teilt er mit, die ersten beiden Unterrichtsstunden habe er ausfallen lassen. Großvater rief an und kündigte an, am Nachmittag vorbeizukommen. – Bei ihrem Vater handele es sich um einen systematischen Zerstörer, behauptet die Frau und ersucht ihren Gast, ihn zu empfangen.
Erst hat er meine Mutter vernichtet, dann meinen Mann, dann mich. Von Kreaturen wie Max ganz zu schweigen. Jetzt ist er dabei, sich selbst zu zerstören, als Krönung seines Lebenswerkes. (Seite 77)
Der Redakteur ist allein im Haus, als der Greis mit einem Taxi gebracht wird. Er geht hinaus, schiebt den Rollstuhl wunschgemäß auf die Terrasse und kocht Kaffee.
Marcels Großvater war vom Nationalsozialismus überzeugt gewesen und hatte als ranghoher Offizier im Außenministerium gearbeitet. Als das „Dritte Reich“ zusammenbrach, floh er nach Argentinien und erwirtschaftete dort als Viehzüchter ein Vermögen. Zwanzig Jahre nach dem Krieg lud ihn die zweimal im Jahr abwechselnd in Regensburg, Passau und Würzburg tagende „Paneuropäische Gesellschaft“ ein, eine Rede über seine Erfahrungen in Argentinien zu halten.
Kennen Sie die „Paneuropäische Gesellschaft“?, fragte er. Rechtskonservativ, grauenhaft. Deutscher Adel, Kleinindustrielle, Burschenschaftler, allesamt dritte Klasse. (Seite 108)
Und diesen alten Kameraden sollte ich etwas über die alten Kameraden in Argentinien erzählen, die sich einmal in der Woche zum Bierabend treffen und deutsche Volkslieder singen. Aber ich habe diese Leute gar nicht gekannt, ich habe sie wie die Pest gemieden. (Seite 109)
Während Marcels Großvater den „paneuropäischen Trachtenverein“ verabscheute, träumte seine aus einer Hamburger Handelsdynastie stammende Frau davon, nach Passau zu ziehen und sich den Damen der „Paneuropäischen Gesellschaft“ anzuschließen. Tatsächlich blieb sie mit ihrer in Buenos Aires geborenen Tochter in Deutschland, während ihr Mann wieder nach Argentinien zurückflog.
In der Maschine nach Buenos Aires saß eine italienische Studentin namens Isabella neben ihm, die seine Geliebte wurde. Als er merkte, dass sie Drogen nahm, überredete er sie zu einer Expedition in die jesuitischen Indianer-Reduktionen in Uruguay. Schließlich brachte er sie außer Landes, weil sie unter Mordverdacht geraten war, und Isabella verschwand im Dschungel.
Wegen der Untreue ihres Mannes verübte Marcels Großmutter Selbstmord.
Erst danach wagte der Großvater sich wieder nach Deutschland zurück, wo er ein Pharmaunternehmen erwarb. Nach einiger Zeit wurden Unregelmäßigkeiten bei der Herstellung der Arzneimittel entdeckt, aber einflussreiche Leute aus Wirtschaft, Politik und Justiz, die mit dem Unternehmer gekungelt hatten, sorgten dafür, dass sich die Zeitungen mit Berichten darüber zurückhielten. Und der Fabrikant wälzte alle Schuld auf seinen Schwiegersohn ab, einen Chemiker aus Heidelberg, der die Produktion leitete. Marcels Vater vergiftete sich daraufhin. Er hinterließ seiner Witwe allerdings Dokumente, die bewiesen, dass nicht er, sondern sein Schwiegervater für die illegalen Machenschaften verantwortlich war. Die an einem sicheren Ort verwahrten Papiere ermöglichen Marcels Mutter ein finanziell sorgenfreies Leben auf Kosten ihres Vaters.
Der kaufte Nachtlokale und ein Hotel in Hamburg. Von Max begleitet, kassierte er persönlich die Einnahmen der Etablissements, die er dann sozialen Einrichtungen spendete. Jeder in Hamburg kennt den mächtigen Mann.
Er liebte die Deutschen nicht mehr, er fand sie stillos und kriecherisch. (Seite 83)
Eigenartig, wie schnell und umstandslos das Besondere vernichtet wurde, sagte der Großvater jetzt, und wie gerne man heute das Gewöhnliche pflegt. (Seite 105)
Er wusste, dass Max ihn betrog, Rechnungen fälschte, Kunstwerke verhökerte und ihm auch Geld aus der Brieftasche stahl, aber er unternahm nichts dagegen, bis er so hinfällig wurde, dass er einen Rollstuhl benötigte. Da fühlte er sich Max hilflos ausgeliefert. Deshalb verkaufte er alles und zog vor zwei Wochen in ein Seniorenheim. In welches, verrät er nicht. Max wurde mit Geld und einer Wohnung abgefunden, aber er zerbrach am Verlust seiner Stelle und wird sich bald zu Tode gesoffen haben.
Kurz bevor ihn der Taxifahrer wieder abholt, nimmt er ein Foto von Isabella aus der Brieftasche und lässt es absichtlich liegen.
Einige Zeit später taucht Marcel auf und schließt aus dem Foto, dass sein Großvater den Fremden bat, nach Isabella zu suchen. Das teilt er denn auch gleich seiner Mutter mit, als sie heimkommt. Die sagt, ihr Vater sei närrisch geworden und zerreißt das Foto in winzige Stückchen. Sie befürchte, fährt sie fort, dass ihr Vater darauf aus sei, sie umzubringen und ihr das Beweismaterial zu rauben. Weil Max nicht mehr als Mörder zur Verfügung stehe, habe er vermutlich ihren Gast für die Aufgabe ausgesucht.
Das Telefon klingelt. Marcel hebt ab. Sein Großvater bestellt den Fremden für den nächsten Morgen zum Frühstück ins Hotel „Atlantic“. Der Redakteur fährt rechtzeitig zum Hauptbahnhof und will von dort zu Fuß gehen. Doch ein Polizist fordert ihn auf, ihm den Ausweis zu zeigen, und weil er keine Papiere bei sich hat, muss er zur Wache mitkommen. Als er endlich ins „Atlantic“ kommt, ist sein Gesprächspartner schon wieder fort. Aber er ließ ein Kuvert mit einem Brief und einem Scheck über 1000 D-Mark für ihn da.
Wenn Sie noch nicht erfahren möchten, wie es weitergeht,
überspringen Sie bitte vorerst den Rest der Inhaltsangabe.
Schließlich soll Marcel zu seinem Großvater ins Seniorenheim kommen und Isabellas Foto mitbringen. Als Marcel zurückkommt, verschwindet er wortlos in seinem Zimmer. Kurz darauf klingeln Polizeibeamte und vernehmen den Jungen. Dessen Großvater war über eine Treppe hinuntergestürzt. Er ist tot. Marcel beteuert, seinen Großvater nicht gestoßen zu haben.
Er kommt in ein Internat. Seine Mutter zieht um, hinterlässt jedoch keine Adresse.
Das Haus wird verkauft. Während es nach und nach leer geräumt wird, bleibt der Redakteur allein dort wohnen. In drei Wochen soll es allerdings abgerissen werden. Mit der Zeitung, bei der er zunächst unbezahlten Urlaub nahm, einigt er sich auf eine Vertragsauflösung im beiderseitigen Einvernehmen.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Eine Novelle nennt Michael Krüger (* 1943) sein Buch „Das falsche Haus“. Es handelt sich um eine surreale, skurrile Geschichte, die von einem eigenbrötlerischen Zeitungsredakteur in der Ich-Form erzählt wird. Seinen Namen erfahren wir ebenso wenig wie die aller anderen Figuren mit Ausnahme von Max und Marcel. Friedmar Apel hält „Das falsche Haus“ für eine „wunderbare Phänomenologie einer sich selbst aufzehrenden Gelehrsamkeit“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21. September 2002).
Witzig und einfallsreich schickt Michael Krüger die Leser durch immer neue unerwartete Wendungen. Er versteht es, Spannung aufzubauen, denn bei der vergnüglichen Lektüre wird man von der Neugierde auf die nächste Überraschung getrieben; man sucht nach Antworten auf die sich ergebenden Fragen und möchte die Zusammenhänge der bizarren Vorgänge durchschauen. Auf eine Auflösung wartet man in „Das falsche Haus“ allerdings vergeblich.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2008
Textauszüge: © Suhrkamp Verlag
Michael Krüger: Die Turiner Komödie