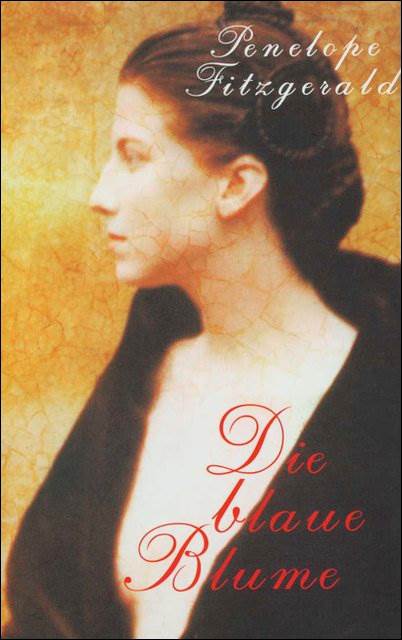Max Frisch : Mein Name sei Gantenbein

Inhaltsangabe
Kritik
Der Blinde
Der Erzähler stellt sich einen Mann in Zürich vor, der bei einem Verkehrsunfall im Gesicht verletzt wird und zu erblinden droht. Nach einiger Zeit wird ihm der Augenverband abgenommen. Er sieht, aber er sagt es nicht und spielt von da an einen Blinden. Gantenbein kauft sich eine Blindenbrille und ein Blindenstöckchen. Um eine gelbe Armbinde zu bekommen, muss er zum Amtsarzt. Der begleitet ihn anschließend zum Fahrstuhl.
Gantenbein steht schon im Lift, als der Amtsarzt ihn nicht um seine Hand bittet, sondern um seinen Finger, was Gantenbein nicht sogleich versteht. Um seinen Zeigefinger: um seinen Zeigefinger auf den richtigen Knopf am inneren Liftschalter zu legen, wo er drücken soll, sobald er das Schließen der Lifttüren, der äußeren, gehört habe.
Als er wie ein Blinder die Straße überquert, wird er beinahe überfahren. In einem unwillkürlichen Reflex hebt er seinen Stock auf, aber zum Glück schöpft niemand Verdacht, dass er vielleicht gar nicht blind ist. Die Blondine am Steuer des violetten Sportwagens heißt Camilla Huber. Sie fährt ihn nach Hause, und da sie in seiner Nachbarschaft lebt, lädt sie ihn ein, kurz mit in ihre Wohnung zu kommen.
Als dann Theo Gantenbein, um sich von seinem Schreck zu erholen, um einen Cognac bittet, sucht sie vergeblich die Flasche, die Gantenbein schon seit einer Weile sieht. Camilla sieht sie nicht. Er muss ihr helfen, indem er mit seinem Tellerchen, als möchte er es wegstellen, gegen die Cognac-Flasche stößt. Ohne das Gespräch (worüber eigentlich?) zu unterbrechen, geht Camilla in die Küche, um eines der beiden Cognac-Gläser zu waschen, während Gantenbein, als Cognac-Kenner, es nicht lassen kann, die fragliche Flasche zur Hand zu nehmen, um die Etikette zu lesen. Wie sie lautlos zurückkommt, Camilla in ihrem Pelzmantel nach wie vor, aber ohne Schuhe, wie gesagt, daher lautlos, findet sich Gantenbein nicht bloß mit der Cognac-Flasche in der linken Hand, sondern in der rechten Hand hält er auch noch seine dunkle Blindenbrille. Um besser lesen zu können. Auffälliger hätte er nicht aus der Rolle fallen können, aber Camilla entschuldigt sich bloß, keine andere Cognac-Marke im Haus zu haben …
Bei Camilla Huber handelt es sich um eine Prostituierte, aber sie gibt sich als Maniküre aus – und Gantenbein, der so tut, als glaube er das, wird ihr einziger Kunde auf diesem Gebiet. Während sie seine Fingernägel feilt, erzählt er ihr immer wieder neue Geschichten. Etwa die Geschichte von einem Milchmann, der ein schlimmes Ende nahm.
Nämlich er kam ins Irrenhaus, obschon er sich nicht für Napoleon oder Einstein hielt, im Gegenteil, er hielt sich durchaus für einen Milchmann. Und er sah auch aus wie ein Milchmann. Nebenbei sammelte er Briefmarken, aber das war der einzige fanatische Zug an ihm …
Oder die Geschichte von einem Pechvogel:
Ich habe einen Mann gekannt, einen andern, der nicht ins Irrenhaus kam, obschon er ganz und gar in seiner Einbildung lebte. Er bildete sich ein, ein Pechvogel zu sein …
Oder die Geschichte von dem Mann, der von einer Geschäftsreise nach Hause fliegt und in der Zeitung seine eigene Todesanzeige entdeckt. Hat jemand seinen Wagen gestohlen und ist damit nach einem Unfall bis zur Unkenntlichkeit verbrannt? Tatsächlich fehlt sein Auto auf dem Flughafen-Parkplatz. Er nimmt ein Taxi und kommt gerade noch rechtzeitig zu seiner eigenen Beerdigung. Aber er bleibt im Hintergrund und achtet darauf, dass niemand ihn bemerkt.
Eine der Geschichten handelt von einem 40 Jahre alten, gutmütigen und verlässlichen Bäckermeister in O., der seine schwangere Frau Anneli mit seinem jungen Gesellen erwischt – „vierbeinig“ –, das Ordonnanzgewehr holt, das jeder Schweizer Reservist im Schrank hat, den Nebenbuhler in die Lenden schießt und dann seiner Frau das Gesicht mit dem „rostfreien Soldatenmesser“ zerschneidet.
Lilas Ehemann
Dr. phil. Felix Enderlin, ein einundvierzig- oder zweiundvierzigjähriger Intellektueller, der einen Ruf nach Harvard erhalten hat, sich aber nicht entschließen kann, das Angebot anzunehmen, steht an einer Bar und wartet auf Frantisek Svoboda. Statt Svoboda erscheint dessen Frau Lila, stellt sich vor und entschuldigt ihren Mann, er habe unerwartet nach London reisen müssen und könne deshalb die Verabredung nicht einhalten. Enderlin lädt die neue Bekanntschaft zu einem Drink ein. Sie ist eine berühmte Schauspielerin. Abends wollen sie gemeinsam in die Oper gehen (Lila hat noch die Karte von ihrem verreisten Mann), aber sie bleiben stattdessen die Nacht über in Lilas Wohnung.
Der Erzähler stellt sich vor, er sei Lilas Ehemann. Sie glaubt wie alle anderen auch, er sei blind.
Ich stelle mir vor:
Manchmal haben wir Gesellschaft, und das ist schwieriger – weil die andern beobachten – beispielsweise wenn Lila nicht sieht, dass die Aschenbecher endlich geleert werden müssen, dass zum schwarzen Kaffee leider der Zucker fehlt, dass unser Hund (ich denke, wir haben einen Hund) mit seinem Schnarchen unter dem Tisch nichts beiträgt zu der Frage, ob Ernst Jünger eine Wandlung durchgemacht habe, dann muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verrate, nicht einfach aufstehe, um endlich die übervollen Aschenbecher zu leeren. Jemand wechselt auf Joyce. Ich streichle also den schnarchenden Hund (Dackel oder Dogge?) und sehe, wie unsere Gäste nach Zucker schielen, meinerseits schweigsam, dank meiner Blindenbrille erlöst von der Heuchelei, dass auch ich Finnegans Wake gelesen habe.
Bei einer Abendgesellschaft wird Lila von „einem Doktor“ umworben, der sie noch zu einem Glas Sekt einlädt.
… und wir können fahren, um bei dem hingerissenen Doktor einen Sekt zu trinken, ich verstehe, sozusagen unter vier Augen: Lila und der Doktor und ich. Der Hingerissene, der hinten sitzt, redet unentwegt, als wäre ich nicht nur blind, sondern auch stumm. Ich sitze neben Lila und sehe eine Hand auf ihrer Schulter, eine Hand, die von hinten kommt voll Verständnis für Lila und sie tröstet über eine blöde Kritik in der Presse. Es wäre hartherzig, wenn ich ganz und gar dazu schweigen würde; die Kritik war wirklich sehr ungerecht-witzig, und ich lege meine Hand, die blinde, auf die andere Hand, die schon seit der Gedächtniskirche auf ihrer schwachen Schulter liegt, und sage: Mach dir nichts draus!
Gantenbein räumt immer wieder die Küche auf und spült das Geschirr. Lila mag das nicht.
Er weiß, man soll einer Frau keine praktischen Ratschläge erteilen, es verletzt sie bloß und ändert nichts.
Also spült er nur noch so viel, dass sie zwar nichts merkt, aber dennoch immer ausreichend Geschirr vorfindet. Und wenn sie heimkommt, sitzt er demonstrativ im Schaukelstuhl und raucht eine Zigarre.
… und Lila ist erleichtert, dass er sich nicht mehr glaubt um die Küche kümmern zu müssen.
„Siehst du“, sagt sie, „es geht auch so.“
Alltag ist nur durch Wunder erträglich.
Er stellt sich vor:
Lila betrügt mich (um dieses sehr dumme Wort zu gebrauchen) von Anfang an, aber sie weiß nicht, dass ich es sehe …
Wenn sie von Dreharbeiten nach Hause fliegt, holt er sie im Flughafen ab. Da sie glaubt, er sei blind, ahnt sie nicht, dass er beobachtet, wie sie jedes Mal von einem Mann begleitet wird – es ist immer derselbe –, der ihr das Gepäck trägt und sich dann mit einem Kuss von ihr verabschiedet, während Gantenbeins Hund Patsch, der „dumme Köter“, schon an der Leine zerrt und winselt.
Einmal kommt sie allein. Wie immer zeigt sie ihre Freude über das Wiedersehen. Das irritiert Gantenbein:
Jahrelang hat Gantenbein getan, als glaubte er daran, und sieht erst jetzt, wie vollkommen ihr Spiel gewesen ist, haargenau wie die Wirklichkeit jetzt.
Jeden zweiten Tag kommt ein Brief für Lila mit einer dänischen Briefmarke, die Adresse immer in derselben Handschrift. Ihr Mann unterschlägt zwei, drei dieser Briefe und überlegt, was er damit machen soll. Verbrennen? Nein. In einem Banksafe deponieren?
Vorteil: sie wären, sollten sie je erwähnt werden, jederzeit auslieferbar. Nachteil: sie blieben jederzeit lesbar, ausgenommen die Sonn- und allgemeinen Feiertage.
Als frühmorgens ein junger Mann läutet, ist sich der Erzähler sofort sicher, dass es sich um den dänischen Liebhaber handelt. Lila schläft noch. Ihr Mann führt den Besucher ins Schlafzimmer und weckt sie.
Wer ist da? fragt sie mit einem Gähnen, und der Student im offenen Mantel, Student oder Tänzer, der es sich anders erwartet hat, scheint es, tut, als wisse er von nichts, seine Pfeife wieder in der Hand; Lila aber schreit, als stünde ein Kaminfeger im Schlafzimmer, und schreit ein einziges Wort: meinen Namen, der, wie ich finde, mit der Sachlage wenig zu tun hat.
Er sperrt die beiden im Schlafzimmer ein und fährt eine Weile spazieren. Als er wieder zurückkommt, ist die Schlafzimmertür aufgesprengt, und die beiden sitzen im Wohnzimmer: Der junge Mann studiert Medizin, möchte aber zum Theater, und lässt sich von Lila beraten. Er ist „nach wie vor etwas verdutzt über die Bräuche in unserem Haus“.
Eine Woche später verlässt Lila ihren Mann. Sie könne nicht länger mit einem Wahnsinnigen zusammen leben.
„Ich bleibe Gantenbein“
Ein Mann sitzt im Mantel in einer leeren Wohnung. Die Fensterläden sind geschlossen, die Polstermöbel mit weißen Tüchern abgedeckt, auf dem Rest Burgunder in der Flasche hat sich Schimmel gebildet und die Nahrungsmittel im Kühlschrank sind kaputt.
Von den Personen, die hier dereinst gelebt haben, steht fest: eine männlich, eine weiblich.
Eines Tages wird er verhört, ob er der Ehemann oder der Liebhaber sei. Schulterzucken. Da sagt sein Gegenüber „nicht ohne einen Unterton von Drohung“:
Die Untersuchung hat ergeben, dass es eine Person namens Camilla Huber beispielsweise nicht gibt und nie gegeben hat, ebenso wenig wie einen Herrn namens Gantenbein –
Immer wieder schwankt der Erzähler:
Ich bleibe Gantenbein.
Aber ich bin nicht Svoboda.
Bin ich Svoboda?
Er räsoniert:
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Ich möchte nicht das Ich sein, das meine Geschichten erlebt, Geschichten, die ich mir vorstellen kann …
Dann wieder zweifle ich, ob die Geschichten, die ich mir vorstellen kann, nicht doch mein Leben sind. Ich glaub’s nicht. Ich kann nicht glauben, dass das, was ich sehe, schon der Lauf der Welt ist.
Der Titel lautet nicht „Mein Name ist Gantenbein“, sondern „Mein Name sei Gantenbein“. Es geht also nicht um jemand, der Gantenbein heißt, sondern bloß um eine Möglichkeit. „Ich probiere Geschichten an wie Kleider“, gesteht der Ich-Erzähler. Es handelt sich um „Entwürfe zu einem Ich“:
„Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält“, sage ich, „oder eine ganze Reihe von Geschichten“, sage ich, bin aber zu betrunken, um meinen eignen Gedanken wirklich folgen zu können …
Max Frisch verzichtet nicht nur auf einen klar fassbaren Protagonisten, sondern auch auf den üblichen Versuch, das Erzählte glaubwürdig erscheinen zu lassen. Er erzählt Geschichten, die er nicht als Realität ausgibt, sondern als Fiktionen darstellt. Dabei wechselt die Erzählperspektive zwischen Ich und Er hin und her; Gantenbein verwandelt sich in Enderlin und umgekehrt; mal identifiziert sich der Erzähler mit dem betrogenen Ehemann, dann wieder mit dessen Gegenbuhler.
Versuchsweise ändert der Erzähler Lilas Beruf. Dann ist sie nicht Schauspielerin, sondern Medizinerin oder eine katholische, venezianische, dem Morphium verfallene Contessa – über die es gleich wieder eine abenteuerliche Geschichte zu erzählen gibt. Aber mit dieser Variante ist der Erzähler nicht zufrieden:
Ich verstehe nicht, wie ich auf diese Idee habe kommen können.
Er fragt sich, welche Berufe für Gantenbein in Frage kämen, ohne dass dieser seine Rolle als Blinder aufgeben müsste, und kommt auf die herrliche Idee, Gantenbein könne als Reiseführer auf der Akropolis arbeiten: Der angeblich blinde Reiseführer weist die Touristen nicht auf die Sehenswürdigkeiten hin, sondern er fragt sie darüber aus, was sie sehen und öffnet ihnen durch Nachfragen die Augen.
Schließlich begegnet der Erzähler Enderlin. Dann wieder meldet das Dienstmädchen dem Erzähler, in der Eingangshalle warte ein Herr Gantenbein auf ihn. Der Erzähler wundert sich: Offenbar haben er und seine Frau Dienstboten. Man hört Hundegebell. Als der Erzähler in die Halle hinuntergeht, stellt er fest, dass es drei Doggen sind, die sich bei seinem Anblick gleich beruhigen. Über seinen Besucher meint er:
Da er zu dem Matisse, der hier in der Halle hängt, nichts sagt, darf ich annehmen, dass er wirklich blind ist.
Aber damit nicht genug der Kapriolen. Als der Erzähler Svobodas Frau in der Bar begegnet, spaltet sich die Romanfigur auf: in „ich“ und einen „fremden Herrn“.
Und als der fremde Herr endlich seine Hand wegnimmt, da ich sie brauche, um meinen Whisky zu ergreifen …
Es kommt gleich noch turbulenter:
Ich sah den fremden Herrn in meinem dunklen Abendanzug, wie er auf dem Platz ihres Mannes sitzt, und mich selbst als ihren Mann, der verreist ist …
Nicht nur, dass hier ständig die Identitäten gewechselt und variiert werden; obendrein erzählt Gantenbein während der Maniküre auch noch Fabeln.
Voller Fabulierlaune und berstend vor originellen Einfällen, brennt Max Frisch in diesem Roman ein aus komischen, wahnwitzigen Episoden bestehendes Feuerwerk ab. Die treffsicheren Szenen kreisen um einen betrogenen Ehemann, der vorgibt blind zu sein, um über die Untreue seiner Frau hinwegsehen zu können.
„Mein Name sei Gantenbein“ ist gewissermaßen eine übersteigerte Fortsetzung zu „Stiller“ und der krasse Gegensatz zu der nur aus authentischem Material aufgebauten Erzählung „Montauk“. Aufgrund der revolutionären Konzeption gilt der Roman als Meilenstein in der deutschsprachigen Literaturgeschichte.
Aber zuallererst handelt es sich bei „Mein Name sei Gantenbein“ um ein ganz außergewöhnliches Lesevergnügen.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2002
Textauszüge: © Suhrkamp Verlag
Max Frisch (Kurzbiografie)
Max Frisch: Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie
Max Frisch: Stiller
Max Frisch: Homo faber
Max Frisch: Biedermann und die Brandstifter
Max Frisch: Andorra
Max Frisch: Montauk
Max Frisch: Der Mensch erscheint im Holozän