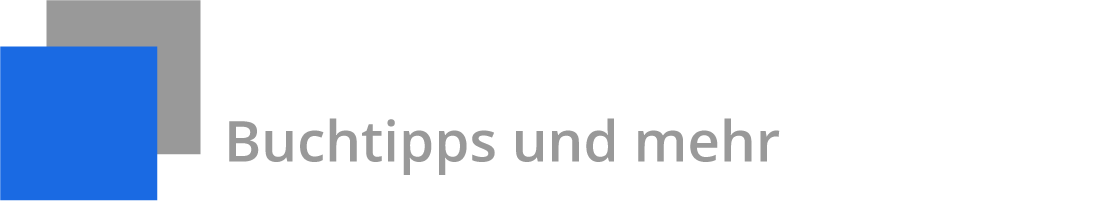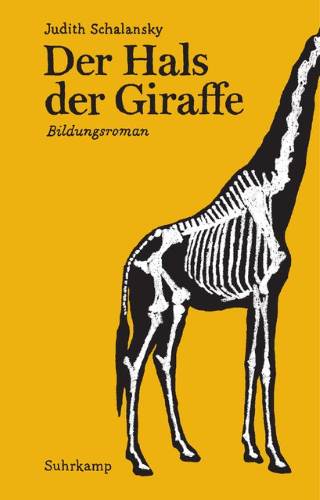Episches Theater
Bertolt Brecht (1898 – 1956) wollte nicht, dass die Theaterbesucher von der Illusion des Bühnengeschehens mitgerissen werden, denn es ging ihm darum, das Publikum zu aktivieren. Zu diesem Zweck führte er ein „episches Theater“ ein.
Statt wie bei der aristotelischen Tragödie eine durchlaufende Handlung auf einer Guckkastenbühne möglichst störungsfrei ablaufen zu lassen, werden beim epischen Theater zum Beispiel nüchtern-lehrhafte Beispiele möglichen Verhaltens in loser Folge aneinandergereiht. Um den Verfremdungseffekt weiter zu steigern, verzichtet das epische Theater weitgehend auf Kulissen und Requisiten. Auch eine Kommentierung der Aufführung durch einen „Spielleiter“, einen Chor oder die Darsteller selbst erschwert es dem Publikum, mit einer Bühnenfigur mitzufühlen oder sich in einer Illusion zu verlieren. Episches Theater will keine Emotionen hervorrufen, sondern die Zuschauer mit gesellschaftlichen Problemen konfrontieren und zu eigenständigem Denken anregen.
© Dieter Wunderlich 2005
Bertolt Brecht (Kurzbiografie)
Bertolt Brecht: Baal (Verfilmung)
Bertolt Brecht: Die Dreigroschenoper
Bertolt Brecht: Dreigroschenroman
Bertolt Brecht: Leben des Galilei
Bertolt Brecht: Der gute Mensch von Sezuan