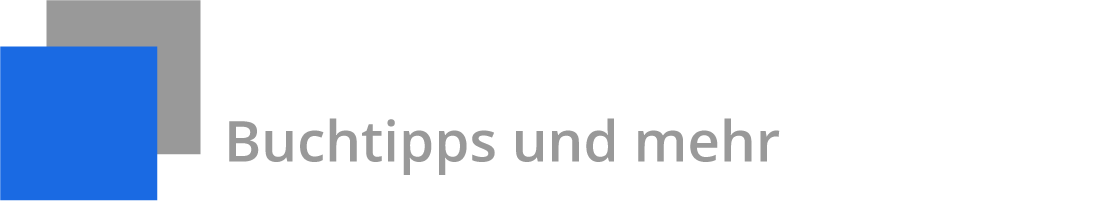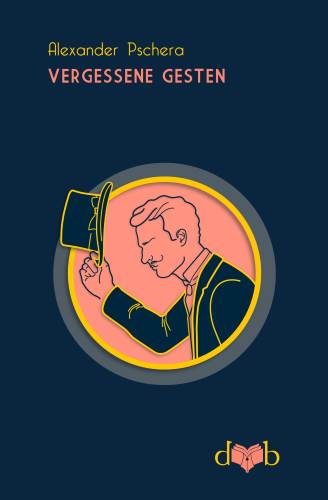Leon de Winter
Leon de Winter wurde am 26. Februar 1954 in ’s-Hertogenbosch, der Hauptstadt der niederländischen Provinz Nordbrabant, geboren, und zwar als Sohn jüdischer Eltern, die den Holocaust als Kinder überlebt hatten, weil sie jahrelang von katholischen Geistlichen und Klosterschwestern vor den Nationalsozialisten versteckt worden waren.
Als Schüler lernte Leon de Winter neben Holländisch auch Deutsch. Weil er sich vor allem für Filmkunst begeisterte, besuchte er nach dem Schulabschluss die Bavaria Film Akademie in München, brach dann aber sein Studium an der Filmakademie Amsterdam ein Jahr vor dem Examen ab.
1979 veröffentlichte Leon de Winter seinen ersten Roman: „Die (Ver)Bildung des jüngeren Dürer“. Damit begann seine Karriere als Schriftsteller.
Verheiratet ist Leon de Winter mit der siebeneinhalb Jahre jüngeren Schriftstellerin, Übersetzerin und Literaturkritikerin Jessica Durlacher, der Tochter des Soziologen und Schriftstellers Gerhard Durlacher (1928 – 1996), der als Einziger aus seiner Familie Auschwitz überlebt hatte. Das Ehepaar schrieb gemeinsam das Libretto für das am 8. Mai 2014 im eigens dafür errichteten Theater Amsterdam uraufgeführte Musical „Anne“ über Anne Frank.
Leon de Winter sorgte auch durch islamkritische Meinungsäußerungen für Aufsehen. Er solidarisierte sich mit Ayaan Hirsi Ali, die den fundamentalistischen Islam als rückständig und frauenfeindlich anprangerte. Für ihn ist der Islamismus eine Form des Faschismus im 21. Jahrhundert, und im Kampf gegen islamistischen Terror hält er auch außerordentliche staatliche Maßnahmen für gerechtfertigt.
Die aufgeklärten Europäer haben keine Vorstellung davon, was die Fanatiker antreibt. es ist die Idee vom herrlichen Leben nach dem Tode. Alles andere sind Ausreden, Vorwände, Rationalisierungen des Irrationalen. Wir haben es mit einem neuen Totalitarismus zu tun. Nein, er ist nicht neu, er ist nur anders. Nach dem linken Faschismus der Sowjets, nach dem rechten Faschismus der Nazis, ist der Islamismus der Faschismus des 21. Jahrhunderts.
(Leon de Winter im Interview mit Henryk M. Broder, Der Spiegel, 1. August 2005)Reguläre Armeen können mit dem Terrorismus nicht fertig werden und reguläre Gesetze taugen nicht für die Bekämpfung und Bestrafung der Terroristen. Die machen, was sie wollen, und wenn sie dabei erwischt werden, verlangen sie, dass man sie nach den Regeln behandelt, die sie verachten und die sie nie praktizieren würden, wenn sie das Sagen hätten. (Leon de Winter, a. a. O.)
Besonders heftig attackiert hatte ihn der Filmregisseur Theo van Gogh (1957 – 2004). Der warf ihm eine Vermarktung des Judentums vor.
Van Gogh wurde in der Sendung auf etwas angesprochen, das er über meine Frau Jessica und mich geschrieben hatte, nämlich: „Wenn die miteinander ficken, wickelt sie einen Stacheldraht um seinen Penis. Und wenn er kommt, ruft er: ‚Treblinka! Treblinka!'“ Das war seine Art, Witze zu machen. Aber was dann kam, war noch unglaublicher. In der Sendung rechtfertigte sich van Gogh damit, dass ihm ein befreundeter Jude erzählt habe, ich würde Stacheldraht von Vernichtungslagern sammeln. (Leon de Winter im Interview mit Volker Hage und Martin Doerry, Der Spiegel, 26. August 2013)
Leon de Winter: Bibliografie (Auswahl)
- Die (Ver)Bildung des jüngeren Dürer (1979 / D 1986; Neuausgabe: Nur weg hier! Die Abenteuer eines neuen Taugenichts, 1992)
- Place de la Bastille (1981 / D 2005)
- Leo Kaplan (1986 / D 2001 – Hörspiel, 2010)
- Hoffmanns Hunger (1990 / D 1994)
- SuperTex (1991 / D 1994 – Verfilmung, 2003)
- Sokolows Universum (1992 / D 2001)
- Das Zeichen (Drehbuch, Regie: Rudolf van den Berg, 1992)
- Hoffmans Hunger (Drehbuch und Regie, 1993)
- Serenade (1995 / D 1996)
- Zionoco (1995 / D 1997)
- Der Himmel von Hollywood (1997 / D 1998 – Verfilmung 2001)
- Malibu (2002 / D 2003)
- Das Recht auf Rückkehr (2008 / D 2009)
- Ein gutes Herz (2013 / D 2013)
- Geronimo (2015 / D 2016)
© Dieter Wunderlich 2014