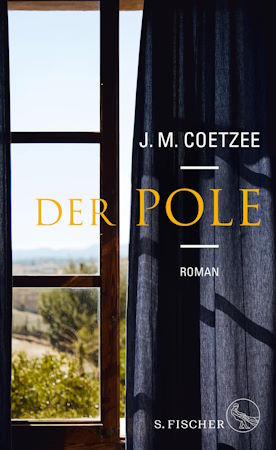André Heller : Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein

Inhaltsangabe
Kritik
Paul Silberstein wurde von seinem zum Katholizismus konvertierten jüdischen Vater im Jesuiten-Internat Kollegium Attweg in Wien untergebracht. Es gelingt dem Jungen nicht, sich dort einzuwöhnen.
Überall stieß man auf das Wort „Sünde“.
Fünfzig Zöglinge schlafen in einem Saal, in dem ihre Eisenbetten in fünf Reihen aufgestellt sind. Gabor Benedek wird relegiert, weil er einem Mitschüler eine Fotografie von dessen Mutter, der er wunderschön findet, aus dem Spind stahl. Ein anderer Zögling muss das Kollegium Attweg verlassen, nachdem seine Eltern sich scheiden ließen. Aber auch Pater Mokloszi, der sich an einigen der Jungen vergangen haben soll, wird von drei Fremden in Soutanen abgeholt. Paul, der nur eine unklare Vorstellung von der Verfehlung hat, für die der Pater sich vor Gericht verantworten muss, reagiert verstört auf den Vorfall.
Einmal, als er verbotenerweise während einer Hausaufgaben-Stunde das Klapp-Pult öffnet, um einen Radiergummi herauszunehmen, schlägt der junge Ladiner aus Südtirol, der die Zöglinge beaufsichtigt, mit den Fäusten auf die Klappe und quetscht Pauls Hand so, dass sie blutet und auf der Krankenstation verbunden werden muss.
Von der Krankenstation aus sieht er durchs Fenster ein offenbar im Nachbarhaus wohnendes Mädchen mit lockigem Haar, das auf einem Shetland-Pony im Kreis herum trabt. Durch eine Dachluke schickt er vergeblich Papierflieger mit Liebesbotschaften hinüber.
Paul hängt seinen fantasievollen Vorstellungen nach.
In einem Asbest-Anzug als erster Mensch in das Innere des Vesuvs hinabzusteigen, um in der glühenden Lava nach Feuerfischen zu suchen, war einer meiner Pläne. Inhaber des Eichkatzl-Fütterungsmonopols im Park von Schönbrunn ein anderer, und der dritte lautete: Weltmeister im Unsichtbarsein. Auf nichts davon wurde man im Kollegium vorbereitet. Am falschen Ort und bei den falschen Leuten.
Im November 1958 erbricht sich ein Mitschüler während des Zeichenunterrichts. Professor Koplenig, einer der wenigen weltlichen Lehrer, verlangt von Paul, dass er das Erbrochene mit dem Tafeltuch aufwischt. Paul, dem unlängst klar wurde, dass er für sich selbst verantwortlich ist, lässt sich seine Würde nicht nehmen.Er taucht den Lappen in das Erbrochene – und wirft ihn dann dem Lehrer ins Gesicht. Sogar die Mitschüler beschimpfen ihn daraufhin, aber das macht ihm nichts aus. Ratlose Patres und der Leiter des Internats schütteln ihn, fragen ihn, aber er sagt kein Wort. Weil man sein unverständliches Verhalten für das Symptom einer nervlichen Zerrüttung hält, kommt er ins Krankenrevier, wo er weiter schweigt und sich auch von Schwester Immaculata nicht umstimmen lässt, als diese sagt:
„Wenn du mit mir sprichst, nehme ich die Schwanenhaube ab, und du darfst meinen Zopf, den noch nie ein Mann sah, berühren.“
Am sechsten Tag kommt seine Mutter ins Kollegium Attweg. Paul glaubt, sie hole ihn ab, weil er relegiert worden sei, aber er täuscht sich: Sein Vater ist gestorben.
Der jüdische Süßwarenfabrikant Kommerzialrat Roman Silberstein verschied in seiner Bibliothek im Alter von vierundsechzig Jahren. Angereist kommen Pauls vierzehn Jahre älterer Bruder, der als Volontär in einem Bankhaus in Kopenhagen beschäftigt ist, und die Brüder des Verstorbenen, die nach ihren Wohnorten genannt werden: Onkel Bel aus Belfast, Onkel Monte aus Montevideo und Onkel York aus New York. Ihre Frauen, die einander nicht ausstehen können, haben sie zu Hause gelassen.
Onkel Monte erzählt seinem zwölfjährigen Neffen, dass sich die Uruguayerinnen niemals die Achselhaare rasieren, um sich nicht des Geruchs zu berauben, mit dem sie die Wollust der Männer befeuern. Er verspricht ihm, zu seinem sechzehnten Geburtstag wiederzukommen und ihm dann zu erklären, wie er rauschhafte Orgasmen erleben könne, ohne zu ejakulieren. Denn das Ejakulieren müsse er unbedingt vermeiden, der damit verbundene Energieverlust führe zu vorzeitiger Vergreisung und Verblödung.
Mit Onkel York redet Paul über seinen Vater, von dem er weiß, dass er vom Hausarzt Drogen verschrieben bekam.
„Vater war krank“, sagte ich, „er hat Gifte genommen, bis er selbst Gift war.“ „Er hat sich veruntreut“, antwortete Onkel York. „Hör zu: Geboren wird man als Entwurf zu einem Menschen, und dann muss man Zeit seines Lebens aus sich einen wirklichen Menschen machen. Das kriegt man nicht geschenkt, das kann man auch nicht […] kaufen, das muss man sich erarbeiten.“
Beim Umtrunk nach der Beerdigung auf dem Döblinger Friedhof herrscht eine „ausgelassene Stimmung, wie sie zu Vaters Lebzeiten in diesen Räumen undenkbar gewesen wäre“. Entsetzen herrscht bei der Testamentseröffnung, denn es stellt sich heraus, dass das Familienvermögen so gut wie aufgebraucht ist und die Süßwarenfabrik wohl bald geschlossen werden muss.
Paul erinnert sich daran, was er über seinen Vater weiß, den er insgeheim „Beflecker“ nennt, seit er gelernt hat, dass die Jungfrau Maria den Heiland unbefleckt empfing.
Es zählt zu den nachhaltigsten Traurigkeiten meiner Kindheit, dass Mutter mich nicht unbefleckt empfangen hat. Was besaß die Mutter Gottes, dachte ich damals, das meiner Mutter fehlte?
Roman Silberstein kämpfte im Ersten Weltkrieg als k. u. k. Offizier an der italienischen Front. Das bewahrte ihn nicht davor, dass er gleich nach dem Einmarsch der Deutschen im März 1938 festgenommen wurde und im Kamelhaarmantel, mit den angesteckten Kriegsorden unter dem Gejohle Schaulustiger in der Mariahilferstraße mit einer Zahnbürste den Gehsteig säubern musste. Nach vier Tagen in Haft kam er frei, und zwar auf Betreiben Mussolinis, dem er beträchtliche Spendengelder hatte zukommen lassen.
Am 4. April 1938 emigrierte Roman Silberstein nach Paris. Vorher ließ er sich noch von seiner „arischen“ Frau scheiden, in der Hoffnung, dass diese die Süßwarenfabrik „Simon und Jurek Silberstein“ weiterführen könne. Als sich jedoch herausstellte, dass ein Urgroßvater von Pauls Mutter jüdische Ahnen gehabt hatte, arisierte man das Familienunternehmen zugunsten eines Jagdfreundes von Hermann Göring.
Roman Silberstein erhielt im Januar 1939 die französische Staatsbürgerschaft. Als die Deutschen in Paris einmarschierten, setzte er sich nach England ab und schloss sich den von Charles de Gaulle geführten Freifranzosen an.
Im Mai 1945 kam er mit seiner Einheit zurück nach Wien. Dort übte er Vergeltung, zum Beispiel an dem über fünfzig Jahre alten Metzgermeister-Ehepaar Wanschura, das im „Dritten Reich“ Regimekritiker denunziert hatte, darunter auch eine der Geliebten Roman Silbersteins. Nun verhinderte er, dass die Wanschuras von einem Gericht abgeurteilt wurden, um seine eigenen Methoden anwenden zu können. Er suchte sie regelmäßig auf, komplimentierte die gerade anwesenden Kunden aus dem Laden und brachte die Wanschuras dann dazu, den Spruch aufzusagen, den er ihnen beigebracht hatte: „Bitte, Herr Kommerzialrat, bestrafen Sie uns. Wir wissen, dass wir weniger wert sind als der Dreck unter den Fingernägeln der Rauchfangkehrer.“ Dann mussten sie sich ausziehen, zwei armlange Stücke Fleisch aus einer Schweinehälfte schneiden und sich gegenseitig damit unter unflätigen Beschimpfungen schlagen, bis sie erschöpft umsanken.
Während Roman Silberstein – der nun erneut mit Pauls Mutter verheiratet war – angeblich monatelang in Paris, Turin oder London zu tun hatte, ging seine Frau mit anderen Männern aus.
Paul erinnert sich an ein Ereignis vor drei Jahren:
1955, an einem gewitterschwülen Augustnachmittag, in Fürberg am Wolfgangsee, wo es während der großen Ferien regelmäßig zu „Sommerfrische“ genannten Familientreffen kam, blattelte Vater mit Zehngroschenstücken. Das heißt, er versuchte, die Münzen derart geschickt aufs Wasser zu werfen, dass sie abprallten und auf der Oberfläche zwei- oder dreimal weiterhüpften. Dazu sang er mit einer passablen Baritonstimme: „Ich hab das Fräuln Helen baden sehn, das war schön “ Da schrie Mutter, die sich knapp hinter ihm befand: „Ich bring mich um. Ich ertrag’s nicht mehr.“ Dann lief sie ans Ende des hölzernen Stegs und ließ sich mit einem Dirndl […] bekleidet in den See fallen. Ihre Arme hielt sie dabei über der Brust verschränkt wie ein tanzender Donkosak. Vater hob den Kopf und drehte ihn sehr langsam nach links und rechts. Dann sagte er ganz beiläufig: „Verreck! Du bist keine Träne wert.“ Mutter versank, tauchte wieder auf, schlug um sich und röchelte. Jetzt bestieg Vater bedächtig unser Ruderboot und löste das Tau, mit dem es an einem Ring am Landungssteg befestigt war. Ich dachte, das er die Ertrinkende trotz seiner bösen Worte retten würde, aber als er endlich auf ihrer Höhe war, schlug er sie mit einem Ruder auf den Kopf. „Verreck! Es ist für alle das Beste.“ Dieser Satz vertrieb meine und meines Bruders Erstarrung. Wir sprangen mit Hemd, Lederhose und Schuhen in den See, um Mutter beizustehen, und erst im Wasser fiel mir ein, dass ich nicht schwimmen konnte. „Hilfe!“, schrie ich, und dieser Schrei lenkte Vaters Aufmerksamkeit auf mich. Er ließ davon ab, seine Frau zu erschlagen, und streckte das Ruder mir entgegen, damit ich Halt finden konnte. Währenddessen gelang es meinem Bruder, Mutter aus dem See zu bergen […] Vater zog mich mit einem Ruck zu sich ins Boot […] Einige Minuten trieben wir schweigend und führungslos auf den flachen Wellen. Vater hielt sein Gesicht zwischen den Händen verborgen, und ich wagte nicht, meine Schuhe auszuziehen, um das darin gesammelte Wasser zu entleeren. Dann sagte er sehr leise und an niemanden gerichtet: „Wie weit herab kann man noch sinken?“
Am vierten Abend nach der Abreise ihrer Schwäger geht die Mutter erstmals seit dem Tod ihres Mannes wieder aus und vertraut Paul der Obhut einer vollbusigen Frau Berta an. Die stiftet den Jungen dazu an, mit ihr ins Gasthaus „Urdil“ zu gehen, das im gehobenen Bürgertum als „Kommunisten-Spelunke“ verschrien ist. Dort schaut Paul dabei zu, wie unter den anwesenden Frauen die mit den schönsten Krampfadern gewählt wird.
Er fühlt sich allein.
Mutter konnte man nur sehr lieb haben, aber guten Rat konnte sie mir nicht erteilen. Sie brauchte im Gegenteil beständig selbst hilfreiche Hinweise, um das Leben einigermaßen zu meistern.
Schließlich nimmt er sich ein Herz und fährt zu dem Haus neben dem Kollegium Attweg. Auf dem Türschild steht „Degasperi“. Er klingelt. Eine alte Frau öffnet, und als er nach dem Pony reitenden Mädchen fragt, prallt sie zurück. Kurz darauf taucht eine jüngere Frau am Fenster auf und teilt Paul mit, dass ihre Tochter Leonore an Kinderlähmung erkrankt sei und im Wilhelminenspital liege.
Unverzüglich lässt Paul sich von einem Taxi hinfahren und gibt sich beim Pförtner als Leonore Degasperis Bruder aus. Er darf zu ihr. Sie liegt auf der Intensivstation in einer Eisernen Lunge. Paul erklärt ihr, er habe sie beim Ponyreiten beobachtet und legt ihr ein Stück Lava aus dem Vesuv auf die Eiserne Lunge: Der Brocken werde ihr helfen, wieder gesund zu werden.
In seiner Erzählung „Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein“ greift André Heller nach eigener Aussage Themen und Begebenheiten aus seiner Kindheit auf und macht daraus die fiktive Geschichte des zwölfjährigen Jungen Paul Silberstein aus dem Wiener Großbürgertum, der sich nach dem Tod seines Vaters daran erinnert, was er über ihn weiß beziehungsweise mit ihm erlebte.
Während André Heller (* 1947) im Jesuiteninternat Kollegium Kalksburg in Wien erzogen wurde, treffen wir den zwölfjährigen Paul Silberstein 1958 im fiktiven Wiener Jesuiteninternat Kollegium Attweg an. Pauls Familie besitzt die Süßwarenfabrik „Simon und Jurek Silberstein“. André Hellers Großvater war tatsächlich Mitbegründer der Wiener Süßwarenfabrik „Gustav & Wilhelm Heller“. Welche der Szenen in „Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein“ authentisch sind und welche nicht, lässt sich nicht ohne weiteres unterscheiden.
Dem Buch fehlt die Form. Bei „Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein“ handelt es sich um eine Aneinanderreihung von teils skurrilen, teils tragikomischen Anekdoten sowohl aus dem Leben des zwölfjährigen Ich-Erzählers als auch seines verstorbenen Vaters. Das Niveau dieser Miniaturen ist unterschiedlich. Vieles wird nur angerissen, aber nicht weiter vertieft.
Die Erzählung „Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein“ gibt es auch als Hörbuch, gelesen von André Heller (Berlin 2008, ISBN 978-3-8291-2205-4, 3 CDs).
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2011
Textauszüge: © S. Fischer Verlag
André Heller und Othmar Schmiderer: Im toten Winkel. Hitlers Sekretärin