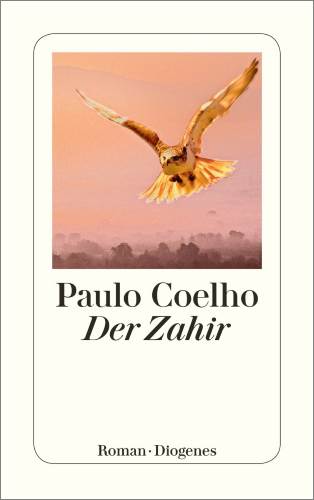Henry Miller : Ein Teufel im Paradies
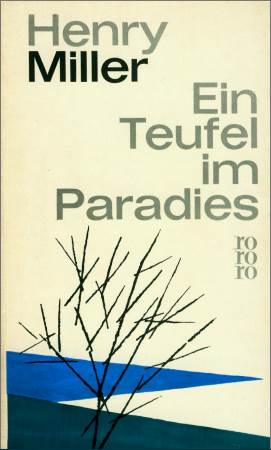
Inhaltsangabe
Kritik
Im Herbst 1936 lernt Henry Miller durch seine Geliebte Anaïs Nin in Paris den fünf Jahre älteren Astrologen und Okkultisten Conrad Moricand kennen, der zwar mittellos ist und in einem einfachen Zimmer im Hotel Modial von der Hand in den Mund lebt, aber gepflegt gekleidet ist. Der vierundvierzigjährige amerikanische Schriftsteller schätzt Moricand als sprachgewandten Unterhalter, der das Französische „wie ein Dichter“ spricht.
Er war vor allem ein Mensch, der Feinheiten und Nuancen liebte. (Seite 10)
Insgesamt muss ich ihm als ein ziemlich sonderbarer Heiliger vorgekommen sein. Ein frankophiler Amerikaner aus Brooklyn, ein Vagabund, ein Schriftsteller, der gerade erst seine Laufbahn anfing, naiv, empfänglich und aufnahmefähig wie ein Schwamm, an allem interessiert und scheinbar ohne Ruder umhertreibend. So sehe ich mich selbst, wenn ich an die damalige Zeit zurückdenke. (Seite 11)
Obwohl Henry Miller selbst nicht gerade reich ist, lädt er Moricand des Öfteren zum Essen ein, und um Geld zu sparen, kocht er selbst, statt ins Restaurant zu gehen. Moricand trägt stets eine frisch gebügelte Hose und ist ausgesprochen ordnungsliebend. Trotz seiner prekären Situation bevorzugt er Delikatessen. Eines Tages schenkt er Henry Miller eine Ausgabe des Romans „Seraphita“ von Honoré de Balzac.
Als Henry Miller im Juni 1939 Paris verlässt, bricht der Kontakt mit Moricand ab.
Sieben oder acht Jahre lang hört Henry Miller nichts mehr von Moricand. Dann erhält er in dem abgelegenen kalifornischen Küstenort Big Sur, wo er seit fünf Jahren mit seiner Frau June Edith Smith und seiner Tochter Val lebt, einen Brief aus Vevey in der Schweiz. Moricands Lebensumstände haben sich nicht gebessert: Er wohnt in einer bescheidenen Pension und weiß kaum, wie er die Miete bezahlen soll. Henry Miller hat nicht genügend Geld, um ihn in Europa finanziell unterstützen zu können, aber er überredet seine Frau, Moricand in Big Sur als Gast aufzunehmen. Dabei verfügen sie nicht einmal über ein eigenes Schlafzimmer, sondern schlafen im Wohnzimmer. Um Moricand den Flug nach England, die Überfahrt nach New York und den Weiterflug nach San Francisco bezahlen zu können, leiht Henry Miller Geld von Bekannten.
Ende 1946 trifft Moricand in Big Sur ein. Am nächsten Morgen fragt er nach Rasierpuder, aber die Marke, die Henry Miller benützt, ist ihm nicht gut genug. Er besteht auf Yardley und erwartet vom Gastgeber, dass dieser ihm den gewünschten Rasierpuder und gutes Briefpapier im DIN-A-4-Format aus der Stadt besorgt.
Von diesem Augenblick an wusste ich, dass meine Frau Recht gehabt und ich einen schweren Fehler gemacht hatte. In diesem Augenblick spürte ich den Blutegel, den Anaïs von sich geschleudert hatte. Ich sah das verzogene Kind, den Faulpelz, der nie in seinem Leben einen Handschlag ehrlicher Arbeit getan hatte, den Habenichts, der zu stolz war, offen zu betteln, aber dem es nichts ausmachte, einen Freund bis auf den letzten Tropfen auszumelken. (Seite 42)
Er hatte eine weibliche Nase für preziöse Dinge. (Seite 48)
Damit sein Gast nicht das beschämende Gefühl zu haben braucht, nur auf Kosten seines Wohltäters zu leben, bittet Henry Miller ihn, seiner Tochter Französisch-Unterricht zu erteilen, aber Moricand mag keine Kinder und kommt mit Val nicht zurecht.
Henry Miller und seine Frau legen ein Gemüsebeet an. Weil es Moricand peinlich ist, einer Frau bei schwerer körperlicher Arbeit zusehen zu müssen, nimmt er ihr den Spaten ab. Nach einer halben Stunde kann er nicht mehr.
Um seine Nerven zu beruhigen, verlangt Moricand Codein. Henry Miller erfährt in der Apotheke, dass Codein rezeptpflichtig ist. Zwei von ihm aufgesuchte Ärzte weigern sich, ein entsprechendes Rezept auszustellen. Moricand lässt sich deshalb von einem Apotheker in der Schweiz Codein schicken, obwohl die Einfuhr in die USA verboten ist und er damit auch seinen Gastgeber in Schwierigkeiten bringen könnte.
Als Moricand über Juckreiz und aufgekratzte Beine klagt, lässt Henry Miller einen befreundeten Arzt aus einer mehrere hundert Meilen entfernten Stadt kommen. Der hält das Leiden für psychosomatisch und rät dem Schriftsteller:
„Sehen Sie zu, dass Sie ihn loswerden […]
Die Sache ist einfach. Er will nicht gesund werden. Er möchte, dass man Mitgefühl für ihn hat und ihn betreut. Er ist kein Mann, sondern ein Kind. Ein verzogenes Kind.“ (Seite 71)
Nach drei Monaten klagt Moricand, er halte es in Big Sur nicht mehr aus, er sei das Stadtleben gewohnt und wolle nach San Francisco. Henry Miller versucht ihm klarzumachen, dass dies seine finanziellen Möglichkeiten übersteigt. Daraufhin will Moricand nach Monterey ins Krankenhaus gebracht werden. Weil Henry Millers Wagen seit Monaten kaputt ist, ersucht er seinen Freund Lilik – der Moricand auch schon vom Flughafen in San Francisco abgeholt hatte –, seinen Gast abzuholen. Lilik schafft es, obwohl die Straßen nach einem Unwetter kaum passierbar sind, er immer wieder Geröll wegräumen muss und die Steinschlag-Gefahr groß ist. Im Krankenhaus ist zwar kein Bett frei, aber der Arzt will sich Moricand mehrmals ansehen und schlägt vor, ihn für eine Woche in einem Hotel unterzubringen. Gleich bei der ersten Untersuchung stellt der Arzt fest, dass Moricand früher morphiumsüchtig war. Wie er die Sucht überwunden habe, fragt er, und Moricand behauptet, es sei ihm allein durch Willensanstrengung gelungen.
Statt von Monterey nach Big Sur zurückzukehren, fährt Moricand nach San Francisco, angeblich, um sich dort Arbeit zu suchen. Da er jedoch nur ein Besuchervisum hat, bekommt er keine Arbeitsgenehmigung und ist weiter auf Henry Miller angewiesen. Der Schriftsteller, der noch nicht einmal die Schulden zurückzahlen konnte, die er gemacht hatte, um seinem Gast die Reise nach Amerika zu bezahlen, ärgert sich darüber, dass Moricand behauptet, sich aufgrund seiner nicht perfekten Englischkenntnisse in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht sicher zu fühlen und deshalb ausschließlich Taxis benutzt.
Henry Millers Freund Raoul Bertrand besorgt Moricand eine kostenlose Überfahrt auf einem Frachtdampfer nach Europa, aber der sieht sich außerstande, innerhalb von zwei Tagen abzureisen und beschwert sich über die Zumutung. Bertrand versucht es mit einem Flugticket und einer längeren Vorlaufzeit, aber unter irgendeinem Vorwand verpasst Moricand die Maschine. Varda, ein anderer Bekannter Henry Millers, verschafft Moricand eine Einladung bei einer steinreichen ungarischen oder österreichischen Gräfin in San Francisco, die sich nicht nur für Astrologie und Okkultismus interessiert, sondern auch gern bizarre Gestalten in ihrem Salon hat, doch Moricand redet in der Gesellschaft kaum ein Wort, und wenn, dann schimpft er über die Eitelkeit und Dummheit älterer Emigrantinnen. Als Bertrand erneut ein Flugticket auftreibt, erklärt Moricand sich endlich bereit, nach Europa zurückzukehren – unter der Bedingung, dass Henry Miller ihm 1000 Dollar zur Verfügung stellt. Außerdem droht er dem Schriftsteller mit Enthüllungen. Der bricht daraufhin den Kontakt ab und öffnet Moricands Briefe nicht mehr.
Sieben Jahre später liest Henry Miller in der Sommer-Ausgabe 1954 der Zeitschrift „Le Goéland“, dass Conrad Moricand gestorben ist. Einzelheiten erfährt er von Théophile Briant, dem Herausgeber des Blatts und Moricands letztem Freund. Irgendwie muss Moricand sich bis Herbst 1949 in San Francisco durchgeschlagen haben, dann wurde er von der Einwanderungsbehörde ausgewiesen, und Ende September 1949 tauchte er bei Théophile Briant in der Bretagne auf. Dieser brachte ihn am 17. Oktober im Hotel Modial in Paris unter, aber schließlich blieb Moricand nichts anderes übrig, als mit dem von seinen Eltern gegründeten Altersheim in Paris vorliebzunehmen. Dort erlag er am 31. August 1954 im Alter von siebenundsechzig Jahren einem Herzanfall.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)In dem Roman „Big Sur and the Oranges of Hieronymus Bosch“ (1957; „Big Sur und die Orangen des Hieronymus Bosch“, 1958) beschreibt Henry Miller sein Leben in dem abgelegenen kalifornischen Küstenort Big Sur. Im ersten Teil befasst er sich mit dem Ort, im zweiten mit den dort lebenden Menschen, und im dritten Teil – „Ein Teufel im Paradies“ („A Devil in Paradise“) – schildert er, wie ein skurriler Schmarotzer in das Refugium einbricht. Diesen letzten Teil brachte der Rowohlt Verlag, der 1958 die von Kurt Wagenseil übersetzte deutschsprachige Ausgabe des Romans veröffentlicht hatte, 1961 ebenfalls in Buchform heraus: „Ein Teufel im Paradies“. Es handelt sich um ein brillantes, mit viel Selbstironie erzähltes Kabinettstück und das faszinierende Porträt einer bizarren Persönlichkeit.
In Form eines Dialoges mit dem Schnorrer Conrad Moricand formuliert Henry Miller auch einige seiner grundlegenden Ansichten:
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Mein Interesse besteht darin, dass ein Mensch aus den Möglichkeiten, die in ihm liegen, etwas macht. (Seite 66)
Ich verabscheue Menschen, die alles durch die einzige Sprache, die sie kennen, hindurchfiltern müssen, ob diese nun Astrologie, Religion, Yoga, Politik, Wirtschaft oder sonstwie heißt. Das einzige, was mir an diesem unserem Weltall rätselhaft ist, was mir zum Bewusstsein bringt, dass es wirklich göttlich ist und kein Wissen seine Tiefe ergründen kann, ist die Tatsache, dass jeder mit Leichtigkeit es so ausdeuten kann, wie er will. Alle Ansichten, die wir uns darüber bilden, sind gleichzeitig richtig und unrichtig […] Und alle Auffassungen, die wir von dem Weltall haben, ändern es in keiner Weise … (Seite 67)
[…] für einen Psychoanalytiker bin ich etwas anderes, für einen Marxisten wieder etwas anderes und so weiter. Was soll mir das alles? Was geht mich das an, wie euer fotografischer Apparat arbeitet? Um einen Menschen ganz und richtig zu sehen, muss man eine andere Art Kamera benutzen, man muss ein Auge haben, das objektiver ist als die fotografische Linse. Man muss durch die verschiedenen Facetten sehen, deren gleißender Widerschein uns für die wahre Natur eines Menschen blind macht. Je mehr wir lernen, desto weniger wissen wir, je besser unsere Apparatur ist, desto weniger können wir sehen. Erst wenn wir den Versuch aufgeben, etwas sehen und wissen zu wollen, sehen und wissen wir wirklich etwas. (Seite 70)
Wir wissen zu viel – und zu wenig. Der Intellekt bringt uns in Schwierigkeiten. (Seite 66)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2007
Textauszüge: © Rowohlt Verlag
Henry Miller (Kurzbiografie)
Henry Miller: Das Lächeln am Fuß der Leiter
Henry Miller: Stille Tage in Clichy (Verfilmung)