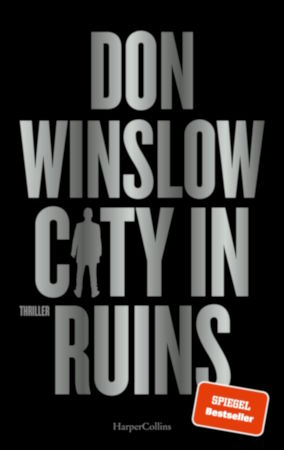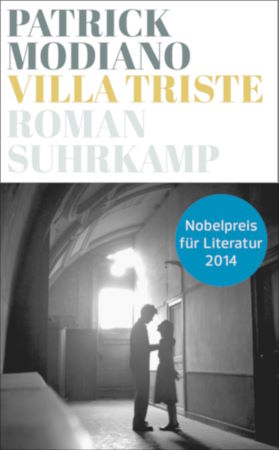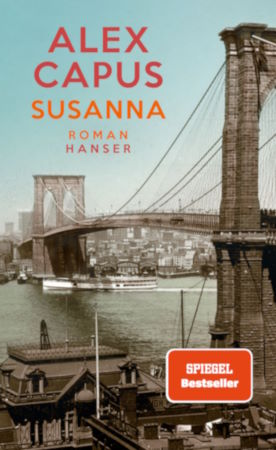John Burnside : Die Spur des Teufels
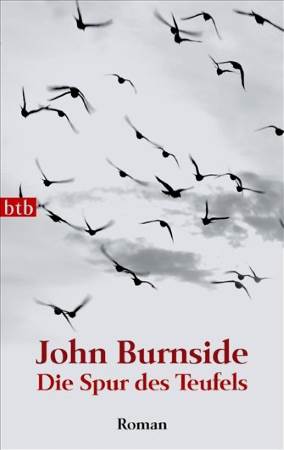
Inhaltsangabe
Kritik
Das Ehepaar Michael und Amanda Gardiner wohnt in Whitland House, einem georgianischen Landhaus auf einer Landzunge außerhalb des schottischen Fischerorts Coldhaven am Firth of Forth.
Michaels Mutter Catherine stammte aus Massachusetts. Durch ein für sie angelegtes Treuhandvermögen war sie finanziell unabhängig, aber sie wollte ernsthaft malen und studierte deshalb in Paris Kunst. Ihr Bruder Thomas Mallon war mit einem Fotografen namens Gardiner befreundet. Die beiden arbeiteten bei derselben Zeitung. Während eines Aufenthalts in Guatemala wurden sie entführt. Während Gardiner die Flucht gelang, überlebte Mallon die Folterungen nicht.
Gardiner und Catherine Mallon kamen sich in Paris näher. Sie heirateten und zogen schließlich nach Coldhaven. Zugereiste, die in Paris und London gelebt hatten, noch dazu eine Künstlerin und ein Fotograf, der in seiner Freizeit Vögel beobachtete, wurden von den Einheimischen in dem Fischerort nicht nur ausgegrenzt, sondern regelrecht gemobbt.
Der Fehler meiner Eltern bestand natürlich darin, dass sie waren, wie sie waren.
Ihr Sohn Michael war neun, als sie Coldhaven verließen und in das abgelegene Haus auf der Landzunge zogen.
Die Eltern hatten von Anfang darauf geachtet, dass Michael so wenig wie möglich von den bösen Briefen, gemeinen Anrufen und anderen Schikanen mitbekam. Umgekehrt verschwieg aber auch Michael, dass er von seinen Mitschülern gemobbt wurde, besonders von dem zwei Jahre älteren Malcolm Kennedy. Der schlug ihn, demütigte ihn und erpresste Geld von ihm. Einmal zertrat Malcolm vor Michaels Augen ein Teichhuhn-Küken. Bei einer anderen Gelegenheit lockte er den Dreizehnjährigen in eine Ruine, um ihn dort zu verprügeln und zu treten. Mrs Collings verscheuchte Malcolm schließlich und lieh Michael ein Taschentuch für seine blutende Nase.
Bei Mrs Collings handelte es sich um eine einsame Witwe, eine verschrobene Alte. Ihr Mann Frank hatte angeblich mit einer Geliebten ein Baby mit zwei Köpfen gezeugt, das gleich nach der Geburt gestorben war. Die Frau verschwand, und drei Monate später erlag Frank Collings einer Krankheit. Die Witwe verkaufte das Bauunternehmen des Verstorbenen und ihren Blumenladen. Als einzige Kontaktperson blieb ihr eine geisteskranke Nachbarin. Mrs Collings freut sich, dass Michael ihr nach ein paar Tagen das von seiner Mutter gewaschene Taschentuch zurückbringt und er sie auch danach immer wieder besucht. Sie ermutigt den Dreizehnjährigen, sich nicht alles gefallen zu lassen und rät ihm, Malcolm einige Tage lang unauffällig zu beobachten, bis er eine Gelegenheit finden würde, um ihm die Stirn zu bieten.
Zwei Wochen später passte Michael seinen Widersacher ab und erzählte ihm, er habe ein Gartenspötter-Nest entdeckt. Damit lockte er ihn in eine Fabrikruine, wo er dafür sorgte, dass Malcolm in eine nach Diesel stinkende, mit schwarzem Wasser gefüllte Grube fiel, aus der er sich nicht selbst befreien konnte. Michael redete sich ein, er wolle Malcolm nur ein wenig Angst einjagen, aber statt ihn nach einer Weile herauszuziehen, ging er einfach weg und war dann sogar ein wenig erstaunt, als am nächsten Schultag die Nachricht kursierte, Malcolm sei ertrunken. Alle glaubten, Malcolm sei allein in der verlassenen Fabrik gewesen und dort verunglückt.
Bis heute, zwanzig Jahre später, hat Michael Gardiner niemandem die Wahrheit über Malcolms Tod erzählt.
Aber die Erinnerungen kommen wieder hoch, als er in der Zeitung liest, dass Moira Birnie mit ihren beiden vier bzw. drei Jahre alten Söhnen Malcolm und Jimmie im Auto verbrannte. Der Mädchenname der Zweiunddreißigjährigen lautete Kennedy; sie war die Schwester des von Michael ermordeten Jungen.
Die Untersuchung ergibt, dass sie mit ihren drei Kindern losfuhr und ihre vierzehnjährige Tochter Hazel unterwegs aussetzte. Dann hielt sie auf einem Feldweg sieben Meilen vor Coldhaven an, betäubte ihre Söhne und legte Feuer. Vorher soll Moira mit einem Messer auf ihren Ehemann Tom Birnie losgegangen sein, weil sie ihn für einen Teufel hielt. Sie trank zu viel, wie er, und die Hausarbeit überließ sie ihrer Tochter. Warum verschonte sie Hazel vor dem erweiterten Suizid? Vielleicht, weil Tom nicht der Vater des Mädchens ist? Michael Gardiner überlegt: Hazel wurde 1990 geboren. Das war nachdem er als Student eine kurze Affäre mit der damals achtzehnjährigen Moira Kennedy gehabt hatte und bevor sie Tom Birnie heiratete. Michael kommt zu dem Schluss, dass wahrscheinlich er der Vater der Vierzehnjährigen ist. Und er beginnt Hazel zu beobachten.
Mein Leben war auf die eine oder andere Weise mit ihr verknüpft. Falls ich nicht ihr Vater war, dann nur aus Zufall, und mit ihrer Mutter war ich ganz bestimmt verbunden, auch mit dem Tod ihrer Brüder hatte ich zu tun – einer der beiden hieß immerhin Malcolm –, und selbst wenn es noch andere Gründe für Moiras Abstieg in den Wahnsinn gab, so war der grässliche, von mir verschuldete Tod ihres Bruders ein Anfang gewesen, ein Teil, der zum Ende beigetragen hatte.
Michael studierte noch, als seine Mutter als Fußgängerin totgefahren wurde, von Peter Tone, einem Alkoholiker, der ausnahmsweise einmal nüchtern war und herumfuhr, obwohl ihm der Führerschein entzogen worden war. Einige Zeit später starb auch Michaels Vater.
Nachdem mein Vater gestorben war, wohnte ich allein in Whitland House – und war glücklich.
Das Erbe und die Tantiemen für die Fotos seines Vaters ersparen es ihm, arbeiten zu müssen. Amanda, die seit neun Jahren mit ihm verheiratet ist und jeden Morgen ins Büro geht, drängte ihn, sich einen Job zu suchen, nicht wegen des Geldes, sondern um mit seinem Leben etwas anzufangen und nicht so viel allein zu sein, aber Michael hörte nicht auf sie. Als er anfängt, Hazel nachzuspüren und im Schlaf den Namen seiner Mutter murmelt, verdächtigt Amanda ihn, eine Affäre zu haben. Er leugnet es, aber sie glaubt ihm nicht. Offenbar hält sie es aufgrund ihres Argwohns nicht länger für nötig, sich ihrerseits zurückzuhalten: Sie wird die Geliebte eines Aufsteigers in ihrer Firma und kommt oft erst mitten in der Nacht nach Hause. Dass Michael sich nicht dafür interessiert, ob sie ihn betrügt oder nicht, macht ihr bewusst, dass die Ehe gescheitert ist.
Michael schleicht Hazel nach, bis sie ihn ertappt und fragt, was er von ihr wolle. Er kann es ihr nicht sagen, denn er weiß es selbst nicht, aber von da an braucht er sich nicht mehr zu verstecken, sondern sie führen kurze Gespräche miteinander.
Als er erwähnt, dass er bereit wäre, sie von ihrem gewalttätigen Vater zu befreien, nimmt sie ihn beim Wort. Da zuckt er zurück, gibt ihr zu bedenken, dass das auf eine strafbare Entführung hinauslaufen würde, aber am Ende lässt er sich von ihr überreden. Noch in der Nacht, bevor Amanda von ihrem Geliebten zurückkommt, verlässt er das Haus, und am Morgen fährt er mit Hazel im Auto los. Plan- und ziellos. Sie nehmen sich Zweibettzimmer in einfachen Hotels, aber Michael rührt die Vierzehnjährige nicht an.
Wenn Sie noch nicht erfahren möchten, wie es weitergeht,
überspringen Sie bitte vorerst den Rest der Inhaltsangabe.
Am vierten Tag schleppt sie ihn zu einem Rummelplatz. Dort trifft sie sich mit drei Kerlen, deren Anführer offensichtlich ihr Freund ist. Sie bleibt bei ihnen, während Michael niedergeschlagen ins Hotel zurückkehrt, an der Bar noch etwas trinkt und nach dem ungewohnten Alkoholkonsum sofort einschläft.
Als er am nächsten Morgen aufwacht, steht sein Auto nicht mehr auf dem Parkplatz. Seine Schlüssel, sein Geld, die Kreditkarten: Hazel und ihre Freunde haben ihm alles gestohlen.
Ohne zu bezahlen, schleicht er sich davon und geht hundertfünfzig Kilometer nach Hause.
In Coldhaven hat es geschneit. Michael fällt eine seltsame Spur auf. Sie erinnert ihn an die Legende, derzufolge der Teufel an einem Wintermorgen aus dem Meer auftauchte und durch die Stadt ging, wobei er eine deutlich sichtbare Fährte hinterließ.
Hausschlüssel hat er keine mehr, aber mit einem außerhalb des Hauses versteckten Schlüssel für die Terrassentüre gelangt er ins Gebäude. Amanda ist fort und hat ihre Sachen mitgenommen. Er findet einen Brief von ihr, liest jedoch nur die ersten Zeilen, denn das Schreiben hat keine Bedeutung mehr für ihn. Der Kühlschrank ist leer. Immerhin kann er sich noch Tee zubereiten.
Er schläft ein. Als er die Augen aufschlägt, fällt sein Blick auf die Haushälterin Mrs K. Von ihr erfährt er, dass er am Montag zurückkam und es inzwischen Donnerstag ist.
Er zeigt den Diebstahl des Autos und der Kreditkarten an. Weil er sich nicht sofort meldete, gibt es Ärger, aber am Ende erklärt man die tagelange Verzögerung mit einer Depression.
Ein Jahr vergeht. Hazel bleibt verschwunden. Niemand erfährt, dass Michael ihr half, Coldhaven zu verlassen. Man nimmt an, dass sie mit einem Freund durchgebrannt ist.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)In seinem Roman „Die Spur des Teufels“ benutzt der schottische Lyriker und Schriftsteller John Burnside (* 1955) Versatzstücke eines Thrillers, um eine finstere Geschichte über Schuld und Verlust bedächtig zu erzählen. Dabei überlässt John Burnside das Wort dem Protagonisten, den seine Erinnerungen nicht loslassen, Erinnerungen an Ereignisse vor einem Jahr und weiter zurück bis in seine Kindheit. Dementsprechend wechselt er immer wieder von einer Zeitebene zur anderen. Dass der Mitdreißiger einer Vierzehnjährigen verfällt und mit ihr tagelang herumfährt, erinnert an den Roman „Lolita“ von Vladimir Nabokov. Eingerahmt werden die Erlebnisse des Protagonisten durch die Legende, der Teufel sei einmal an einem Wintermorgen durch Coldhaven, den (fiktiven) Hauptschauplatz des Geschehens, gegangen.
Lesenswert ist „Die Spur des Teufels“ vor allem wegen der gelungenen Komposition des Zeitengefüges und der poetischen Sprache. Gleich mit den ersten Sätzen signalisiert John Burnside, dass wir es mit einem geschliffenen Text zu tun haben:
In Coldhaven, einem kleinen Fischernest an der Ostküste Schottlands, wachten die Menschen vor langer Zeit an einem düsteren Morgen Mitte Dezember auf und sahen nicht nur, dass ihre Häuser tief und traumverloren unter einer so dicken Decke Schnee begraben lagen, wie sie nur ein- oder zweimal in jeder Generation ausgebreitet wird, sondern dass darüber hinaus, während sie geschlafen hatten, etwas Seltsames geschehen war, etwas, was sie sich nur mit Geschichten und Gerüchten zu erklären wussten, die sie allerdings, da sie ein braves und gottesfürchtiges Volk waren, höchst ungern weitererzählten, Geschichten, in denen der Teufel vorkam oder ein Gespenst, Geschichten, die widerstrebend eine verborgene Macht in der Welt anerkannten, deren Vorhandensein sie die meiste Zeit lieber ignorierten. Coldhaven sah in jenen Tagen kaum anders aus als heute, ein Gewirr aus Häusern, Gärten und mit Unrat übersäten Bootsliegeplätzen, das sich in engen, regenfarbenen Straßen und schmalen Kopfsteinpflastergassen zum Meer hinab zog. Die Menschen damals waren die Vorfahren jener Nachbarn, mit denen ich seit nunmehr über dreißig Jahren zusammenlebe: ein raues Seefahrervolk mit sonderbarem Aberglauben, ureigener Logik und Erinnerungen an Sandbänke, Gezeiten und die Tücken der See; doch auch wenn ihre Kindeskinder den nahen Bezug zum Meer verloren haben, glaube ich, diese Menschen zu kennen, wenn auch nur ein wenig und wie aus großer Entfernung. Es mag reine Fantasie sein, so selten diese auch vorkommt, doch bilde ich mir ein, ich könnte in ihren lethargischen Abkömmlingen die Geister jener alten Seefahrer ausmachen, die allzu viele Male gezwungen waren, sich durch dichten Nebel oder gnadenlosen Sturm den Weg nach Hause zu suchen, oder die jener Frauen, deren Blick am Horizont nicht innehielt, sondern weiterwanderte zu den Riffen und Untiefen, die sie nur von Karten und Wettervorhersagen kannten, was sie zu Seherinnen machte, zu Orakeln und Harpyien. Es muss eine grauenhafte Last für sie gewesen sein, eine schreckliche, wenn auch alltägliche Fertigkeit, diese für wenige kritische Augenblicke entwickelte und auf ein ganzes Leben ausgeweitete, zu starren Mienen der Voraussicht und Vorahnung verzerrte und entstellte Sehweise. Einen solchen Blick habe ich sogar in den Augen der Postbotin erkannt, eine Gabe, die sie nicht braucht, die sie aber auch nicht ablegen kann. Letzte flüchtige Spuren davon fand ich selbst in den Augen von Schulmädchen und einigen jungen Frauen, die, während sie ihrer Arbeit nachgingen, auf die Katastrophe warteten.
Jene, die am lang vergangenen Wintermorgen als Erste aus den Betten waren, die Bäcker und Schiffsausrüster, Frauen, die aus dem Haus traten, um Kohlen zu holen, und Männer, die an diesem Tag nicht zum Fischen gefahren, aber aus Gewohnheit oder Rastlosigkeit früh aufgestanden waren; sie sollten die Ersten sein, die jenes Phänomen bemerkten, das die ganze Stadt später „die Spur des Teufels“ nannte, eine Bezeichnung, die nicht nur haften blieb, sondern aus Gründen, die sich dieBewohner von Coldhaven nie eingestanden, zugleich eine verschroben klingende Umschreibung dessen war, was für Außenstehende und die eigene Nachwelt stets in Unglaube oder Ironie gehüllt bleiben sollte. Die Spur des Teufels: ein Titel wie der einer Ballade oder eines an einem verregneten Nachmittag aus der Bücherei entliehenen und später als eine seltsame alte Ansammlung von Unsinn abgetanen Buches, Worte, die stets nur gleichsam mit Anführungszeichen ausgesprochen wurden, falls man sie denn überhaupt laut aussprach, so als wäre der von ihnen gewählte Name für das Gesehene von der falschen Seite des Jenseits gekommen, geradeso wie die Spuren im Schnee, diese sauberen, tintenklecksigen Fährten eines spalthufigen Wesens, einer Kreatur, die nicht nur auf zwei Beinen von einem Ende des Städtchens zum anderen durch die Straßen und Gassen spaziert, sondern auch die Hausmauern hinauf gestapft war und hohe, von Krähenspuren übersäte Dächer auf ihrem schnurgeraden Weg über die Schlafgemächer hinweg überquert hatte. Auf der Suche nach einer Erklärung, die es ihnen erlaubte, unbeschwert und sorgenfrei an ihre Küchenherde zurückzukehren, zu ihren Fischernetzen und Spülbecken, sollten sie das Phänomen später ein wenig genauer in Augenschein nehmen und feststellen, dass die Spuren an der Küste begannen, gleich vor dem kleinen Friedhof am westlichen Ende der Stadt, so als wäre das Geschöpf dem Meer entstiegen, hätte den schmalen, flutgespülten Strand überquert, auf dem kein Schnee liegen geblieben war, um dann lautlos und zielgerichtet über die James Street zu staksen, der Shore Street zu folgen, das Dach der Kirche hinauf und wieder hinab, über das Rinnsal von einem Bach zu hüpfen, der Coldhaven Wester von Coldhaven Easter trennte, und so weiter, auf und ab, über die Dächer der Häuser in der Toll Wynd zu laufen, ehe es sich am anderen Ende dann in die Felder schlug, dem Landesinneren zu, wohin ihm zu folgen niemand der Sinn gestanden hatte. Sie sollten nie erfahren, wie weit jene Reihe ordentlicher schwarzer Abdrücke noch reichte, nur waren sie sich später, als der Schnee schmolz und Gegenteiliges nicht mehr hätte bewiesen werden können, hinsichtlich der Natur der Kreatur, die diese Spuren hinterlassen hatte, alle sicher oder doch zumindest einig. Das waren nicht die Fußspuren eines Menschen, sagten sie, auch nicht die eines Tieres, jedenfalls keines Wesens, weder vom Lande noch aus der See, das man in diesen Teilen der Welt je gesichtet hätte. Es waren scharf umrissene, dunkle Hufabdrücke, die Spuren eines trittsicheren Geschöpfs, das sich rasch – der Eindruck schneller Bewegung war unbestritten, wenn auch durch nichts belegt – durch ihre eng bebaute Siedlung bewegt hatte, so als flöhe es vor einem grausigen, übernatürlichen Entschluss oder jagte ihm hinterher. Es gab welche, die behaupteten, es müsse eine vernünftige Erklärung für dieses Phänomen geben, jene, die meinten, alles unter dem Himmel müsse sich erklären lassen, denn Gott allein entzöge sich der Erkenntnis, doch fanden sich die meisten Einwohner mit der Behauptung ab, es sei der Teufel gewesen, der vorbeigekommen war, ein Geschöpf, das man nie gänzlich für real gehalten, aber dennoch für eben eine solche Gelegenheit in Reserve gehalten hatte, so wie den Butzemann, die Elfen oder übrigens auch Gott selbst.
Das war natürlich nur Gerede. Mir wurde diese Geschichte als Kind erzählt, beziehungsweise habe ich sie damals heimlich aufgeschnappt […]
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2011
Textauszüge: © Albrecht Knaus Verlag