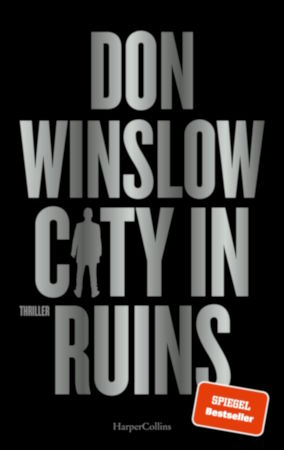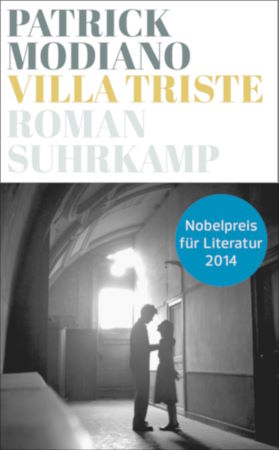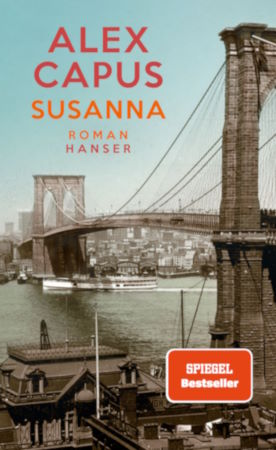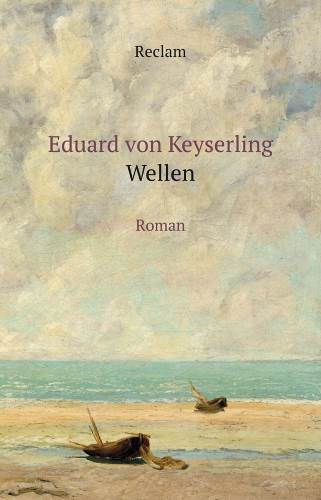Arthur Schnitzler : Spiel im Morgengrauen

Inhaltsangabe
Kritik
Wilhelm („Willi“) Kasda ist Leutnant beim k. u. k. Infanterie-Regiment Nr. 98 und wohnt in der Alserkaserne in Wien. Sein Vater starb vor fünf Jahren als Oberstleutnant in Temesvar.
An einem Sonntagmorgen, als er noch im Bett liegt, meldet ihm sein Bursche Joseph den Besuch des früheren Kameraden Otto von Bogner, eines Spielsüchtigen, der vor drei Jahren seinen Abschied nehmen musste. Erst jetzt erfährt Kasda, dass der ehemalige Oberleutnant verheiratet ist, einen vierjährigen Sohn hat und als Kassierer in einem Büro für elektrische Installation angestellt ist. Zufällig habe er gehört, erklärt von Bogner, dass am Montag, also schon am nächsten Morgen, eine Revision in der Firma durchgeführt werden soll. Bis dahin müsse er die 1000 Gulden auftreiben, die er sich aus der Kasse geliehen habe. Kasdas Barschaft beläuft sich auf gerade einmal 120 Gulden. Aber er macht seinem Besucher einen Vorschlag: Er wolle ohnehin aufs Land fahren, nach Baden, und dort die Familie Keßner besuchen. Da werde er an der sonntäglichen Hasardpartie im Café Schopf teilnehmen und 100 Gulden für von Bogner setzen. Vielleicht gewinne er 1000 Gulden und könne ihm dann damit aushelfen. Die Männer verabreden sich für den nächsten Morgen vor der Alserkirche.
Kasda fährt also, wie geplant, mit dem Zug nach Baden und besucht die Keßners, deren Tochter er umwirbt. Obwohl er gern noch geblieben wäre, verabschiedet er sich nach dem Mittagessen und dem Kaffee.
So blieb ihm nichts übrig, als sich zu empfehlen, dem einstigen Oberleutnant Bogner zuliebe, gerade als die Unterhaltung im besten Gange war. Man gab sich den Anschein, als wollte man ihn zurückhalten, er bedauerte sehr; leider sei er verabredet, und vor allem musste er einen Kameraden im Garnisonsspitale besuchen, der hier ein altes rheumatisches Leiden auskurierte. […] Ob denn dieser Besuch den ganzen Nachmittag in Anspruch nähme, fragte Frau Keßner, verheißungsvoll lächelnd. Willi zuckte unbestimmt die Achseln. Nun, jedenfalls würde man sich freuen, falls es ihm gelänge, sich frei zu machen, ihn im Laufe des heutigen Abends wiederzusehen.
Als er das Haus verließ, fuhren eben zwei elegante junge Herren im Fiaker vor, was Willi nicht angenehm berührte. Was konnte in diesem Hause sich nicht alles ereignen, während er genötigt war, für einen entgleisten Kameraden im Kaffeehaus tausend Gulden zu verdienen?
Kasda geht zum Café Schopf, wo bereits gespielt wird. Es dauert nicht lang, bis er 1000 Gulden gewonnen hat. Zufrieden geht er wieder zu den Keßners. Aber er trifft nur noch das Stubenmädchen an: die Herrschaften haben einen Ausflug ins Helenental unternommen.
Also kehrt Kasda ins Café Schopf zurück. Bis zum Nachtmahl verdoppelt sich sein Gewinn auf 2000 Gulden. Nach dem Essen beabsichtigt er, den letzten Zug nach Wien zu nehmen, und Konsul Schnabel stellt ihm für den Weg zum Bahnhof seine Kutsche zur Verfügung. Auf dem Weg zum Ausgang des Restaurants entdeckt Kasda an einem der Tische die Keßners mit ihren Gästen. Er grüßt und wechselt ein paar Worte mit den Herrschaften, die sich vor allem für den Schauspieler von Elrief am Tisch der Spieler interessieren.
Willi küsste allen Damen die Hand, grüßte noch einmal hinüber zu dem Tisch der Offiziere, und eine Minute drauf saß er im Fiaker des Konsuls. „G’schwind“, sagte er dem Kutscher, „Sie kriegen ein gutes Trinkgeld.“ In der Gleichgültigkeit, mit der der Kutscher dieses Versprechen hinnahm, glaubte Willi einen ärgerlichen Mangel an Respekt zu verspüren. Immerhin liefen die Pferde vortrefflich, und in fünf Minuten war man beim Bahnhof. In dem gleichen Augenblick aber setzte sich auch oben in der Station der Zug, der eine Minute früher eingefahren war, in Bewegung. Willi war aus dem Wagen gesprungen, blickte den erleuchteten Waggons nach, wie sie sich langsam und schwer über den Viadukt fortwälzten, hörte den Pfiff der Lokomotive in der Nachtluft verwehen, schüttelte den Kopf und wusste selbst nicht, ob er ärgerlich oder froh war. Der Kutscher saß gleichgültig auf dem Bock und streichelte das eine Ross mit dem Peitschenstiel. „Da kann man nix machen“, sagte Willi endlich. Und zum Kutscher: „Also fahren wir zurück zum Café Schopf.“
Als Kasda vom Bahnhof zurückkommt, sitzt Mizi Riboscheck neben ihrem Liebhaber, dem Konsul von Ecuador, und schaut ihm in die Karten. Der Leutnant steigert seinen Gewinn bis auf 4200 Gulden, aber dann verlässt ihn das Glück, und nach einiger Zeit besitzt er nur noch die 120 Gulden, mit denen er nach Baden kam. Vorsichtig setzt er weiter, gewinnt 20, dann 50 Gulden. Weil mit kleinen Einsätzen nun einmal nicht viel zu erreichen ist, bittet er von Elrief, ihm 200 Gulden zu leihen. Der Schauspieler behauptet, nicht so viel Geld bei sich zu haben, obwohl alle wissen, dass der lügt. Wortlos schiebt der Konsul dem Leutnant 1500 Gulden hin und später dann noch einmal 2000. Als die Herren im Morgengrauen das Spiel beenden, steht Kasda beim Konsul mit 11 000 Gulden in der Kreide. Das entspricht dem Drei- oder Vierfachen seines Jahreseinkommens. Der Leutnant weiß nicht, wie er die Summe aufbringen soll.
Der Konsul nimmt ihn in seiner Kutsche mit zurück nach Wien. Spielschulden gelten als Ehrenschulden und sind innerhalb von 24 Stunden zu begleichen. Konsul Schnabel will allerdings nicht in seiner Nachtruhe gestört werden und verlängert die Frist deshalb bis Dienstagmittag. Vergeblich erbittet Kasda einen längeren Aufschub. Der Konsul erzählt ihm, er sei zwar noch nie in Ecuador gewesen, werde aber am Dienstagabend zu seiner Familie und seinen Geschäften in Baltimore reisen. Er bringt den Leutnant bis vors Kasernentor und fordert ihn noch einmal höflich zur fristgemäßen Bezahlung seiner Spielschulden auf. Andernfalls müsse er ihn beim Regimentskommando anzeigen, fügt er warnend hinzu.
In der Kaserne lässt Kasda sich erst einmal von seinem Burschen krankmelden. Und zur vereinbarten Zeit schickt er Joseph zur Alserkirche, damit er Otto von Bogner ausrichtet, dass der Leutnant nichts erreicht habe.
Verzweifelt überlegt er, was er tun könnte. Wenn er nicht bis Dienstagmittag 11 000 Gulden auftreibt, wird er unehrenhaft entlassen. Und was soll er dann machen? Er stammt aus einer Offiziersfamilie und hat nichts anderes gelernt.
Er befürchtet zwar, dass sein Onkel Robert Wilram, den er über zwei Jahre lang nicht gesehen hat, ihn nicht empfangen werde, aber eine andere Möglichkeit, sich das Geld zu besorgen, fällt ihm nicht ein. Unterwegs trifft er Otto von Bogner, der ihm mitteilt, dass die Revision auf Dienstag verschoben worden sei.
Wider Erwarten freut Robert Wilram sich über den Besuch seines Neffen. Helfen kann er ihm allerdings nicht. Vor zweieinhalb Jahren habe er das Blumenmädchen Leopoldine Lebus geheiratet, erklärt Robert Wilram, und vor eineinhalb Jahren habe er seiner Ehefrau das gesamte Vermögen überschrieben. Allerdings lebt sie inzwischen getrennt von ihm in Wien, und er muss mit der Leibrente auskommen, die sie ihm zahlt.
Kasda kennt die junge Frau, die nun seine Tante ist. Er lernte sie vor drei Jahren im Beisein seines Onkels kennen – und verbrachte anschließend die Nacht mit ihr. Davon darf der Onkel nichts erfahren.
Beim Meldungsamt besorgt Kasda sich Leopoldine Wilrams Adresse. Ein Dienstmädchen öffnet und will den Besucher abweisen, aber zufällig kommt Leopoldine dann selbst an die Türe, erkennt den Leutnant und bittet ihn herein. Ihr Vermögen sei fest angelegt, erklärt sie ihm. Da lasse sich vermutlich nichts machen. Immerhin will sie in einer ohnehin für den Abend angesetzten Besprechung mit ihrem Rechtsanwalt darüber reden, ob eine Möglichkeit besteht, 11 000 Gulden für ihn zu beschaffen. Der Leutnant werde noch am Abend von ihr Bescheid bekommen, verspricht Leopoldine.
Überraschenderweise schickt sie keine Vertrauensperson, sondern kommt selbst zu Kasda in die Kaserne. Sie plaudern miteinander, aber Leopoldine sagt nichts von dem Geld, und der Leutnant wagt es nicht, von sich aus die Sprache darauf zu bringen. Durch ihre Freundlichkeit ermutigt, lädt er seine Besucherin zum Abendessen ein, beauftragt den Burschen mit entsprechenden Besorgungen und wundert sich darüber, dass Leopoldine tatsächlich bleibt. Sie schläft sogar mit ihm.
Als er am Morgen aufwacht, steht sie bereits fertig angezogen im Zimmer. Noch hat sie nichts von den 11 000 Gulden gesagt, die er innerhalb weniger Stunden benötigt.
Sie beugte sich zu ihm herab, strich ihm den kleinen Schnurrbart von den Lippen zurück, küsste ihn flüchtig, flüsterte „Adieu“ und erhob sich. In der nächsten Sekunde konnte sie bei der Tür draußen sein. Willi stand das Herz still. Sie wollte fort? So wollte sie fort?! Doch eine neue Hoffnung wachte in ihm auf. Vielleicht hatte sie, aus Diskretion gewissermaßen, das Geld unbemerkt irgendwohin gelegt. Ängstlich, unruhig irrte sein Blick im Zimmer hin und her – über den Tisch, zur Nische des Ofens. – Oder hatte sie es vielleicht, während er schlief, unter die Kissen verborgen? Unwillkürlich griff er hin. Nichts. Oder in sein Portemonnaie gesteckt, das neben seiner Taschenuhr lag? Wenn er nur nachsehen könnte! Und zugleich fühlte, wusste, sah er, wie sie immer seinem Blick, seinen Bewegungen gefolgt war, mit Spott, wenn nicht gar mit Schadenfreude.
Als Leopoldine bereits die Türklinke in der Hand hat, greift sie in den Ausschnitt ihres Kleides, zieht eine Banknote heraus und legt sie auf den Tisch. Kasda kann es kaum fassen: Es ist nur ein Schein. Es können also höchstens 1000 Gulden sein. Höhere Scheine gibt es nicht. Verzweifelt weist er Leopoldine auf das vermeintliche Missverständnis hin: Er benötigt nicht 1000 sondern 11 000 Gulden.
Sie sah ihn an, als verstünde sie nicht recht. Dann nickte sie ein paarmal, als werde ihr jetzt erst alles klar: „Ah so“, sagte sie, „du hast gedacht “ Und mit einer verächtlich-flüchtigen Kopfwendung zu der Banknote hin: „Darauf hat das keinen Bezug. Die tausend Gulden, die sind nicht geliehen, die gehören dir – für die vergangene Nacht.“ […] „Ist doch nicht zu wenig? Was hast du dir denn eigentlich vorgestellt? Tausend Gulden! – Von dir hab‘ ich damals nur zehn gekriegt, weißt noch?“ […] „Das soll kein Vorwurf sein“, sagte sie. „Ich hab‘ ja auf mehr nicht Anspruch gehabt damals. Zehn Gulden – war ja genug, zu viel sogar.“ Und das Auge noch tiefer in das seine: „Wenn man’s genau nimmt, gerade um zehn Gulden zu viel.“
Da begreift er, dass er sie damals irrtümlich für eine Hure hielt und sie beleidigte. Leopoldine geht.
Mit dem Geldschein schickt Kasda seinen Burschen zu Otto von Bogner. Dessen Problem sollte damit gelöst sein.
Drei Stunden später kommt Bogner herüber. Zur gleichen Zeit lässt sich der Regimentsarzt Tugut melden, der zur Spielerrunde in Baden gehörte und sich besorgt nach der Lage der Dinge erkundigen möchte. Weil Kasdas Türe verschlossen ist und er auf Klopfen nicht reagiert, lassen die Herren schließlich von Joseph den Regimentsschlosser holen. Leutnant Wilhelm Kasda lehnt auf dem Sofa. Auf dem Fußboden vor ihm liegt sein Revolver. Er hat sich durch einen Kopfschuss getötet.
Robert Wilram betritt den Raum. Dass sein Neffe tot ist, will er zunächst gar nicht glauben. Er hat 11 000 Gulden für ihn bei sich. Nachdem Leopoldine ihm das Geld an diesem Morgen gegeben hatte, machte er sich sofort auf den Weg. Als er sich über den Toten beugt, glaubt er Leopoldines Parfüm zu riechen. Aber den aufkommenden Verdacht verwirft er gleich wieder.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)In der formvollendeten Erzählung „Spiel im Morgengrauen“ veranschaulicht Arthur Schnitzler auf eindrucksvolle Weise die Diskrepanz zwischen den gesellschaftlichen Fassaden und dem Leben dahinter. Der k. u. k. Offizier Wilhelm Kasda denkt – zumindest in den zwei Tagen, an denen sich die Handlung abspielt – außer an sein Glück bei Frauen und im Spiel an seine Offiziers-Ehre, die allerdings mit Moral und Anstand wenig zu tun hat. Der Zufall entscheidet nicht nur beim Spiel über sein Schicksal. „Spiel im Morgengrauen“ dreht sich um die zerstörerischen Kräfte des Geldes, des Glücksspiels und erotischer Abenteuer. Eros und Thanatos sind miteinander verbunden.
Arthur Schnitzler schildert das Geschehen zwar in der dritten Person, aber nicht als auktorialer Erzähler, sondern fast ausschließlich aus der subjektiven Perspektive der Hauptfigur. Dabei verwendet er auch innere Monologe.
Manche sehen in Otto von Bogner den Tod und in Konsul Schnabel den Teufel, der den Protagonisten ins Verderben lockt.
Arthur Schnitzler bezeichnet das Kartenspiel der Herren zwar als Bakkarat, aber Einzelheiten der Beschreibung passen eher zu Macao, einem aus Ungarn stammenden (aber nach Macao, dem „Monte Carlo des Ostens“ benannten) Vorläufer dieses Glücksspiels.
Götz Spielmann verfilmte die Erzählung „Spiel im Morgengrauen“ von Arthur Schnitzler.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Originaltitel: Spiel im Morgengrauen – Regie: Götz Spielmann – Drehbuch: Götz Spielmann nach der Erzählung „Spiel im Morgengrauen“ von Arthur Schnitzler – Kamera: Martin Gschlacht – Schnitt: Niki Mossböck – Musik: Walter W. Cikan, Eddie Siblik – Darsteller: Fritz Karl, Birgit Minichmayr, Karlheinz Hackl, Peter Matic, Nina Proll, Götz Spielmann, Lukas Miko, Ernst Konarek, Roland Jaeger, Peter Strauss, Rainer Frieb, Karl Fischer, Elisabeth Augustin, Anna Morawetz, Florentín Groll, Hannes Fretzer, Patricia Hirschbichler, Silvia Meisterle, Aron Karl, Brigitte Karner, Peter Moucka, Florian Teichtmeister u.a. – 2001; 90 Minuten
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2014
Arthur Schnitzler (Kurzbiografie / Bibliografie)
Arthur Schnitzler: Die Toten schweigen
Arthur Schnitzler: Reigen. Zehn Dialoge
Arthur Schnitzler: Leutnant Gustl
Arthur Schnitzler: Fräulein Else
Arthur Schnitzler: Traumnovelle