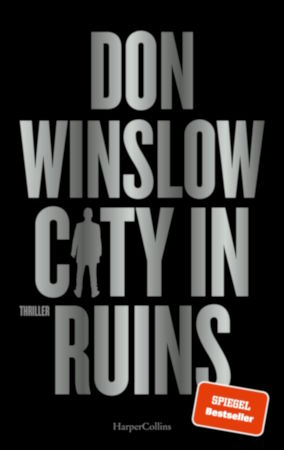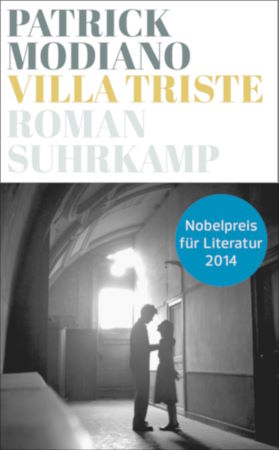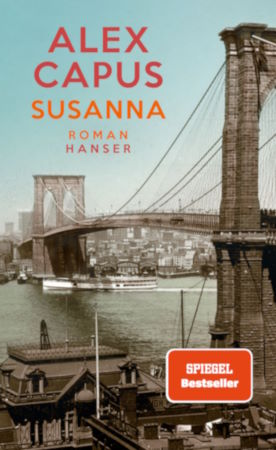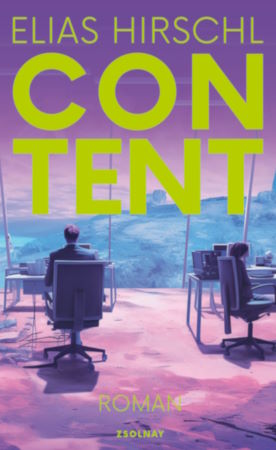Hermann Hesse : Das Glasperlenspiel
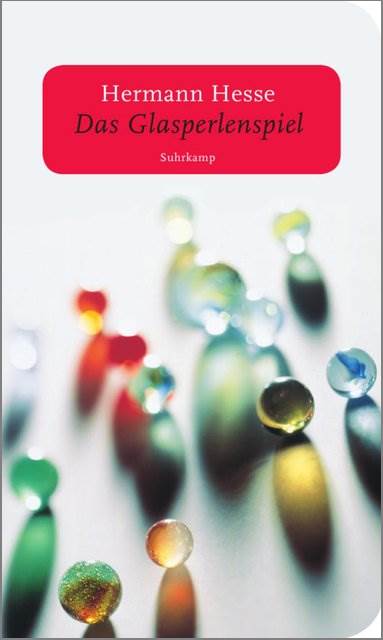
Inhaltsangabe
Kritik
Der anonyme Erzähler gibt sich als Historiker aus, der aus Briefen, Aufzeichnungen und anderem Archivmaterial die Lebensgeschichte des Glasperlenspielmeisters Josef Knecht rekonstruiert hat. Zwar gelte inzwischen das Ideal der Anonymität und es sei nicht mehr üblich, Biografien zu schreiben, aber es komme ihm auch nicht – wie den Autoren des „feuilletonistischen Zeitalters“ – darauf an, das Einmalige, Normwidrige oder gar Pathologische eines Individuums herauszustellen, sondern ein Beispiel zu geben für den Dienst eines Menschen am Überpersönlichen.
In der Einleitung erinnert der Autor kurz an die Entwicklung der europäischen Kulturgeschichte vor der Gründung des kastalischen Ordens. „Die Entwicklung des geistigen Lebens in Europa scheint vom Ausgang des Mittelalters an zwei große Tendenzen gehabt zu haben: die Befreiung des Denkens und Glaubens von jeglicher autoritativer Beeinflussung, also den Kampf des sich souverän und mündig fühlenden Verstandes gegen die Herrschaft der Römischen Kirche und – andererseits – das heimliche, aber leidenschaftliche Suchen nach einer Legitimierung dieser seiner Freiheit, nach einer neuen, aus ihm selbst kommenden, ihm adäquaten Autorität.“ Für eine bürgerliche Epoche, in der das Individuelle mehr als die Gemeinschaft geschätzt und eine Flut verantwortungsloser Zeitungsartikel geschrieben wurde, prägte „Plinius Ziegenhalß“ den Begriff „feuilletonistisches Zeitalter“. Die Vernunft gebrauchten die Machthaber nur gelegentlich, und auch dann nur als Kampfmittel. In diesen gewalttätigen, kriegerischen Zeiten konnten die Menschen kaum noch ihre Angst vor Tod, Anarchie und Untergang verdrängen, zumal auch die Kirchen keinen wirkungsvollen Trost mehr spendeten. Um sich abzulenken, fuhren die Menschen Auto, spielten Karten oder lösten Kreuzworträtsel, aber das Bedürfnis nach Recht und Wahrheit, Vernunft, Ordnung und Neubeginn nahm ständig zu, bis das feuilletonistische Zeitalter überwunden wurde und die Freude an den exakten Wissenschaften neu erwachte. Damals gründete eine Gruppe verzweifelter Morgenlandfahrer den kastalischen Orden, der sich politischer und wirtschaftlicher Geschäfte enthielt, auf schöpferisches Künstlertum verzichtete und stattdessen die allumfassende Synthese von Kunst und Wissenschaft anstrebte.
In den Eliteschulen von Kastalien werden die begabtesten und charakterlich geeignetsten Söhne des Landes in strenger Zucht und Askese erzogen. Weil der Orden Werte und Wissen pflegt und von Generation zu Generation weitergibt, finanziert ihn die Regierung. Ohne sich um profane Angelegenheiten sorgen zu müssen, leben die Mitglieder abgeschieden von der Alltagswelt in einer streng hierarchisch geordneten Provinz. Zwar unterhalten die katholische Kirche und der Orden seit einiger Zeit freundschaftliche Beziehungen, aber er gehört keiner Kirche an, bekennt sich zu keinem Gott und keiner Religion.
Die höchste Errungenschaft des Ordens ist das Glasperlenspiel.
Als Idee existierte das Glasperlenspiel bereits bei den alten Chinesen, in der Antike und bei den Mauren. Eine Vorform des Spiels entstand gleichzeitig in Deutschland und England als witzige Spiel-, Gedächtnis- und Kombinationsübung für Musiker. Das eigentliche Glasperlenspiel wurde von Bastian Perrot aus Calw an der Musikhochschule von Köln erfunden. (Bei einem Calwer Turmuhrmacher namens Heinrich Perrot ging Hermann Hesse in die Lehre.) Damals erhielt das Spiel seinen Namen, der darauf zurückgeht, dass Perrot anstelle von Buchstaben, Zahlen und Musiknoten eine Art Abakus mit Glasperlen verschiedener Größe, Form und Farbe verwendete. Als das Glasperlenspiel zwei, drei Jahrzehnte später bei den Musikern an Beliebtheit einbüßte, übernahmen es – zuerst in Frankreich und England, dann auch in Deutschland – die Mathematiker, deren Disziplin gerade eine Blütezeit erlebte. Nun konnten auch mathematische Formeln im Glasperlenspiel dargestellt werden. Vor allem ein unbekannter Schweizer Musikgelehrter und Liebhaber der Mathematik, dem man später den Namen Joculator oder Lusor Basiliensis gab, brachte Musik und Mathematik auf einen gemeinsamen Nenner. Während der weiteren Entwicklung bereicherte nahezu jede Wissenschaft das Glasperlenspiel um spezielle Formeln, Abbreviaturen und Kombinationsregeln, sodass eine von allen Künsten und Wissenschaften gespeiste Weltsprache entstand. Endlich kam als wesentlicher Bestandteil die Kontemplation hinzu. In jedem Land wurden eine Spielkommission und ein oberster Spielleiter bestimmt, und über sie alle wacht seither eine Weltkommission des Glasperlenspiels.
Im Glasperlenspiel vereinigen sich die Schönheit der Kunst und die Exaktheit vieler wissenschaftlicher Disziplinen. Es handelt sich weder um eine Philosophie noch eine Religion. Im Charakter ähnelt das Glasperlenspiel am ehesten der Kunst. Theoretisch ließe sich mit diesem Instrument der ganze geistige Weltinhalt reproduzieren. Alles Wissen der Welt wurde symmetrisch und synoptisch auf ein Zentrum hin geordnet und zusammengefasst. Auf diese Weise existieren die Wissenschaften nicht mehr nebeneinander, sondern sie greifen ineinander. Jedes Symbol und jede Kombination von Symbolen zielt „ins Zentrum, ins Geheimnis und Innerste der Welt, in das Urwissen“. „Das Glasperlenspiel ist also ein Spiel mit sämtlichen Inhalten und Werten unserer Kultur, es spielt mit ihnen, wie etwa in den Blütezeiten der Künste ein Maler mit den Farben seiner Palette gespielt haben mag.“
Zur Veranschaulichung kann man den Glasperlenspieler mit einem Organisten vergleichen. Manuale, Pedale und Register sind zwar vorgegeben und neue Inhalte werden allenfalls nach strenger Kontrolle durch die Spielkommissionen aufgenommen, aber dem einzelnen Spieler steht „eine ganze Welt von Möglichkeiten und Kombinationen“ zur Verfügung. Um das Glasperlenspiel auch für Leser, die es nicht aus eigener Anschauung kennen, begreiflich zu machen, vergleicht es der Autor auch mit einer Schachpartie. Aber die Bedeutungen der Figuren und die Möglichkeiten ihrer gegenseitigen Einwirkungen sind um ein Vielfaches komplexer. Außerdem symbolisieren jeder Zug und jede Konstellation einen bestimmten Inhalt. Einmal im Jahr steht Kastalien ganz im Zeichen des Glasperlenspiels: Zu den öffentlichen Jahresspielen, die früher drei bis vier Wochen dauerten – inzwischen jedoch auf ein bis zwei Wochen verkürzt wurden – lädt Kastalien auch Repräsentanten der Regierung und der Städte ein. Wie ein Hohepriester schreibt der weiß und golden gekleidete Ludi Magister mit einem Goldgriffel Zeichen um Zeichen auf eine Tafel. Hundertmal vergrößert erscheinen sie sofort an der Saalwand. Sprecher rufen sie aus, und man verbreitet sie im ganzen Land.
Als Josef Knecht Ludi Magister war, hatte das Glasperlenspiel seinen Höhepunkt bereits überschritten. (Jahresangaben fehlen, doch ist anzunehmen, dass Josef Knecht etwa im 23. oder 24. Jahrhundert lebte.)
Über Josef Knechts Kindheit ist kaum etwas bekannt. Vermutlich hat er seine Eltern früh verloren, oder die Erziehungsbehörde nahm ihn aus ungünstigen Verhältnissen heraus. Jedenfalls blieb ihm der Konflikt zwischen Elternhaus und Eliteschule erspart.
Mit zwölf oder dreizehn Jahren war er Lateinschüler in einem Internat in Berolfingen am Rand des Zaberwalds. Da geschah, was man in Berolfingen seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt hatte: Der Musikmeister kam persönlich in die Kleinstadt. Nur wenige wussten, dass es bei seinem Besuch fast ausschließlich um Josef Knecht ging, den das Lehrerkollegium – besonders der Musiklehrer – wegen seiner ungewöhnlichen musikalischen Begabung mehrmals zur Aufnahme in die Eliteschulen von Kastalien empfohlen hatte. Der Magister Musicae achtete weniger auf die Kenntnisse des Schülers als auf dessen Wesen. Er prüfte zum Beispiel, ob man ihn begeistern konnte und ob er bereit war, sich in eine Gemeinschaft einzuordnen.
Nach einer vierjährigen Ausbildung in der Eliteschule von Eschholz wurde Josef Knecht mit 17 Jahren zur nächsthöheren Schulstufe nach Waldzell versetzt. Jede Eliteschule in Kastalien hat ihren Schwerpunkt. Waldzell gilt als Zentrum der musischen Bildung sowie der Verbindung von Kunst und Wissenschaft. Der Ort ist auch der Sitz des Glasperlenspiels und des Ludi Magister.
Schon in der Schulzeit staunte Josef Knecht über Mitschüler, die Kastalien verlassen mussten: „…diese Abgefallenen haben trotz allem für mich etwas Imponierendes, so wie der abtrünnige Engel Luzifer etwas Großes hat. Sie haben vielleicht das Falsche getan, vielmehr, sie haben ganz ohne Zweifel das Falsche getan, aber immerhin: sie haben etwas getan, sie haben etwas vollzogen, sie haben einen Sprung gewagt, es gehörte Mut dazu.“
In Waldzell befreundete sich Josef Knecht mit dem Hospitanten Plinio Designori. (Das Privileg, einen Sohn in Kastalien ausbilden zu lassen, obwohl aus ihm kein Ordensmitglied werden sollte, stand nur wenigen hochgestellten Familien offen.) Plinio war sich seiner Sonderstellung bewusst und machte sich einen Spaß daraus, die Lehrer der Eliteschule und die Meister des Ordens als Priesterkaste zu diffamieren. Seine Mitschüler kritisierte er als „gegängelte und kastrierte Horde“, die in einer „ewigen Kindheit“ und „leidenschaftslosen, sauber umzäunten, wohlaufgeräumten Spiel- und Kindergartenwelt“ gehalten werde, wo man jedes starke Gefühl sofort durch Meditation neutralisiere.
Im Alter von 24 Jahren galt Josef Knechts Schulbildung als abgeschlossen, und es begann seine Studienzeit. Zehn Jahre später wurde er durch eine feierliche Zeremonie des Musikmeisters in den Orden aufgenommen.
Gleich darauf schickte ihn der Orden in das Benediktinerkloster Mariafels, das um die Entsendung eines Glasperlenspiellehrers gebeten hatte. Jahrelang hielt sich Josef Knecht unter den Benediktinern auf. Weil er sich in dieser Zeit mit Pater Jakobus befreundete, konnte er seinem eigenen Orden von großem Nutzen sein, denn er gewann den einflussreichen, hoch angesehenen Kleriker dafür, dem Apostolischen Stuhl die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit dem Orden von Kastalien zu empfehlen. Ungleich größeren Nutzen aber zog Josef Knecht selbst aus dieser Begegnung, denn Jakobus, „der bedeutendste Geschichtsschreiber des Benediktinerordens“, öffnete ihm die Augen für historische Entwicklungen, und indem er seinen Orden in Disputen mit dem skeptischen Pater verteidigte, vertiefte er sein Verständnis für die in Kastalien geltenden Regeln.
Josef Knecht war noch keine 40 Jahre alt, als Glasperlenspielmeister Thomas von der Trave starb und man ihn zum Nachfolger ernannte. Es graute ihm vor der „unpersönlichen Vollkommenheit und Zucht“, die dieses Amt von ihm erforderte. Als Ludi Magister hörte er beinahe auf, ein Individuum zu sein; er wurde „Träger eines Ornats und Amtes, ein Stein in einer Krone, ein Pfeiler im Bau der Hierarchie“.
Josef Knecht war mit dem hervorragenden Glasperlenspieler Fritz Tegularius befreundet, einem kränklichen, launischen Ordensmann und genialen Narren, der sich nicht einordnen mochte. Dieser Eigenbrötler stellte für seinen Freund ein mahnendes Vorzeichen dar. Durch Pater Jakobus im historischen Denken geschult, begriff Josef Knecht, dass auch Kastalien vergänglich und sein Glanz gefährdet war.
Eines Tages kam Plinio Designori als Mitglied einer offiziellen Regierungsdelegation nach Waldzell. Er war Jurist geworden und hatte die Tochter des Führers einer politischen Partei geheiratet. Durch ihn wurde Josef Knecht auf die Welt außerhalb des Ordens aufmerksam, und im achten Amtsjahr besuchte er ihn und seine Familie mehrmals in der Hauptstadt des Landes.
Obwohl Josef Knecht wusste, dass es die oberste Behörde des Ordens ablehnen musste, schrieb er ein Gesuch. Durch die noch nie dagewesene Bitte eines Glasperlenspielmeisters, sein Amt aufgeben und außerhalb des Ordens eine bescheidene Erziehungsaufgabe ausführen zu dürfen, wollte er seinen mahnenden Ausführungen ein besonderes Gewicht verleihen. Um sein Anliegen zu veranschaulichen, verglich er seine Situation mit der eines Gelehrten, der in der Dachstube eines Hauses riecht, dass in einem Stockwerk darunter Feuer ausgebrochen ist. Vernünftigerweise wird er nicht seine Gelehrtenarbeit fortsetzen, sondern hinunterlaufen und versuchen, das Haus zu retten. Der Frieden im Land, so Knecht weiter, werde vom Osten her bedroht. Wenn das Land jedoch aufgrund eines Krieges sparen müsse, sei damit zu rechnen, dass die Bürger nicht mehr für den Orden aufkommen wollen. Das Glasperlenspiel – das „kostbarste und das unnützeste, das geliebteste und zugleich das zerbrechlichste Kleinod“ des Ordens – würden sie wohl als erstes für einen entbehrlichen Luxus halten. Um sich dieser bedrohlichen Entwicklung entgegenzustemmen, sehe er seine Aufgabe nunmehr darin, außerhalb des Ordens erzieherisch zu wirken.
Als die oberste Behörde das Gesuch wie erwartet zurückwies, erklärte Josef Knecht seinem Stellvertreter, er werde für unbestimmte Zeit verreisen und übertrug ihm die Amtsführung. Nach den Statuten stand es ihm frei, sein Amt aus Gewissensgründen niederzulegen und den Orden zu verlassen – aber das war noch nie vorgekommen! Vergeblich bemühte sich Josef Knecht vor der Abreise aus Kastalien, den Ordensvorstand, Meister Alexander, von seinen lauteren Beweggründen zu überzeugen. Sein revolutionärer Schritt war weder Untreue noch Willkür, auch kein Rückfall in die Individualität, sondern der Gehorsam einer neuen Bindung gegenüber. Josef Knecht betrachtete seinen Werdegang als Fortschreiten von Stufe zu Stufe und fühlte sich nicht als Flüchtling, sondern als Gerufener, nicht als Herr, sondern als Diener.
Seine erste Aufgabe außerhalb von Kastalien sah er in der Erziehung von Plinios Sohn Tito. Zu diesem Zweck zog er sich mit ihm in die Berghütte „Belpunt“ zurück, die seinem Freund gehörte. Bei seiner Ankunft im Gebirge fühlte er sich krank, verbarg es aber vor Tito. Josef Knecht führte die Unpässlichkeit auf den Höhenunterschied zurück und hoffte, sich in ein paar Tagen zu erholen. Am nächsten Morgen beobachtete er, wie Tito am Rand des Gebirgsees neben der Hütte im Licht der aufgehenden Sonne in einem Taumel der Begeisterung tanzte. Als Tito wieder zu sich kam, war es ihm peinlich, und um rasch über seine Verlegenheit hinweg zu kommen, forderte er seinen Lehrer zu einem Wettschwimmen auf. Josef Knecht mochte den Knaben nicht enttäuschen und folgte ihm deshalb in das eiskalte Wasser. Tito blickte wiederholt zurück. Als er seinen Lehrer plötzlich nicht mehr sah, tauchte er nach ihm, bis ihn seine Kräfte verließen. Indem er sich am Tod des Meisters mitschuldig fühlte, „überkam ihn mit heiligem Schauer die Ahnung, dass diese Schuld ihn selbst und sein Leben umgestalten und viel Größeres von ihm fordern werde, als er bisher je von sich verlangt hatte“.
Der zweite Teil des Buches besteht aus einer Reihe von Gedichten und drei Aufsätzen, die angeblich von Josef Knecht selbst stammen. Unter den Studenten in Kastalien war es Sitte, als Sprachübung und Mittel zur Selbsterkenntnis regelmäßig eine Art Lebenslauf im Stil einer früheren Epoche in einer anderen Kultur abzufassen.
In seiner ersten Schrift versetzte sich Josef Knecht einige tausend Jahre zurück in ein Matriarchat, wo er das Amt des Regenmachers versah. Als das Dorf von Dürre und Not heimgesucht wurde, ließ sich der Regenmacher in einer feierlichen Zeremonie den Dämonen opfern.
Die zweite Geschichte handelt von Josephus Famulus, der sich mit etwa sechsunddreißig Jahren als Einsiedler in die Wüste zurückzog. Weil er gut zuhören konnte, kamen die Menschen zu ihm und beichteten – bis er sich dieser Aufgabe nicht mehr gewachsen fühlte und selbst zu einem Beichtvater namens Dion Pugil pilgerte, den er auf halber Wegstrecke traf, weil dieser ebenfalls ratsuchend losgezogen war.
Im „indischen Lebenslauf“ geht es um Dasa (Sanskrit: Diener), den Sohn von Rajah Ravana. Früh verlor er seine Mutter und stand dann der Stiefmutter, die ihren eigenen Sohn Nala auf den Thron bringen wollte, im Weg. Um ihn vor ihr in Sicherheit zu bringen, gab ihn der Hofbrahmane Vasudeva Hirten mit, die mit ihren Herden in die Berge zogen. Als die Hirten wieder einmal in die Nähe der Stadt kamen, wurde dort die Inthronisation Nalas gefeiert. Am Rande der Festlichkeiten lernte Dasa die schöne Pravati kennen, verliebte sich in sie, verließ die Hirten und heiratete. Ein Jahr später kam Rajah Nala in die Gegend. Dasa überraschte seine Frau mit ihm, tötete den Rivalen mit einer Steinschleuder und flüchtete in die Berge. Er erinnerte sich an einen Yogin, der dort einsam im Wald lebte und ließ sich neben ihm nieder. Als der Yogin ihn einmal zum Wasserholen schickte, erblickte er Pravati. Inzwischen hatte man ihn als rechtmäßigen Nachfolger seines Vaters zum Rajah ausgerufen und suchte ihn überall. Glücklich regierte Rajah Dasa und zeugte mit Pravati einen Sohn, den er nach seinem Vater Ravana nannte. Als ihn der von Dasas Stiefmutter beratene Rajah des Nachbarlandes Govinda wiederholt angriff, musste Dasa in den Krieg ziehen, obwohl es ihm widerstrebte. Gleichzeitig suchte er nach einer Möglichkeit, die Spirale der Angriffe und Gegenangriffe zu durchbrechen. Aber die von seiner ehrgeizigen Frau angeführte Kriegspartei wollte das benachbarte Land erobern. Als sich Pravati mit Vishwamitra, dem Oberbefehlshaber der Reiter zusammentat, fiel Dasa auf, dass sie ihn erst gesucht hatte, als er zum Rajah ausgerufen worden war. Er verlor die Schlacht, wurde gefangen genommen und traf im Kerker auf Pravati mit seinem toten Sohn im Schoß. Da erwachte Dasa mit einer Wasserschale in der Hand im Wald.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Dieses Buch begann Hermann Hesse 1931 zu schreiben. Am 29. April 1942 war das Manuskript fertig. Obwohl Peter Suhrkamp alles versuchte, konnte es zunächst nicht in Deutschland veröffentlicht werden. Die zwei Bände erschienen deshalb am 18. November 1943 in Zürich. Erst 1946 folgte eine Ausgabe in Deutschland.
In einem Brief schrieb Hermann Hesse: „Ich kann Ihnen keine Fragen beantworten, ich kann meine eigenen Fragen nicht beantworten. Ich stehe ebenso ratlos und ebenso bedrückt vor der Grausamkeit des Lebens wie Sie. Dennoch habe ich den Glauben, dass die Sinnlosigkeit überwindbar sei, indem ich immer wieder meinem Leben doch einen Sinn setze. Ich glaube, dass ich für die Sinnhaftigkeit oder Sinnlosigkeit des Lebens nicht verantwortlich bin, dass ich aber dafür verantwortlich bin, was ich mit meinem eigenen, einmaligen Leben anfange.“
Der Tiefe und Komplexität dieses in einer erhabenen Sprache geschriebenen umfangreichen Werkes kann keine Interpretation gerecht werden. Man kann nur versuchen, einen oder zwei der Hauptgedanken anzudeuten.
Die Idee eines individuellen, aber überzeitlichen Lebenslaufes stand am Anfang. 1955 schrieb Hermann Hesse in einem Brief an Rudolf Pannwitz: „Ich dachte mir einen Menschen, der in mehreren Wiedergeburten die großen Epochen der Menschheitsgeschichte miterlebt.“ In einer von den Verbrechen des NS-Regimes und den Gräueln des Zweiten Weltkrieges geprägten Zeit verschob sich der Schwerpunkt der Dichtung zur Konzeption einer geordneten Welt der Vernunft und des Humanismus: „Ich musste, der grinsenden Gegenwart zum Trotz, das Reich des Geistes und der Seele als existent und unüberwindlich sichtbar machen, so wurde meine Dichtung zur Utopie, das Bild wurde in die Zukunft projiziert, die üble Gegenwart in eine überstandene Vergangenheit gebannt.“ (a.a.O.)
Josef Knecht (!) verwirklicht sich, indem er seine persönlichen Belange zurücknimmt und zunächst der Provinz Kastalien dient und später – auf einer höheren Entwicklungsstufe – dem Land bzw. einer Familie oder deren Sohn. „Das Glasperlenspiel“ ist keine futuristische Prophezeiung, sondern eine an keine bestimmte Zeit und Umgebung gebundene Idee über die Einordnung des individuellen Lebens in eine überpersönliche Gemeinschaft. Das verlangten auch die Nationalsozialisten und der Stalinismus. Diesen und anderen Diktaturen setzt Hermann Hesse jedoch zutiefst humane Organisationen entgegen, und obwohl er offenbar eine streng hierarchische Ordnung, in der die Amtsträger ihre Individualität fast aufgeben, nicht abschreckend findet, bleiben die Angehörigen doch frei: Die kastalische Ordensleitung kann Joseph Knechts revolutionären Schritt zwar nicht billigen, aber er darf ungehindert seinen Weg gehen.
Ein weiterer zentraler Gedanke ist die Gegensätzlichkeit des geistigen und des natürlichen Lebens. „Wir sollen nicht aus der Vita activa in die Vita contemplativa fliehen, noch umgekehrt, sondern zwischen beiden wechselnd unterwegs sein, in beiden zu Hause sein“, sagt Josef Knecht. Er hat damit angefangen, und wir können hoffen, dass Plinios Sohn Tito dem Vorbild folgen und die beiden Pole zusammenführen wird.
Hermann Hesse betont auch in diesem Buch (wie in „Siddhartha“), dass er nicht an eine bestimmte Lehre glaube. Jeder Mensch müsse Stufe für Stufe seinen eigenen Weg gehen – wie Josef Knecht, dem er die folgenden Worte in den Mund legt: „Die Wahrheit wird gelebt, nicht doziert.“
1946 erhielt Hermann Hesse den Nobelpreis für Literatur.
Verena Specht-Ronique (Konzept) und Sven Eric Panitz (Text) schufen das Theaterstück „GPS. Eine Standortbestimmung mit Hermann Hesses Glasperlenspiel“. Die Uraufführung ist für 18. Oktober 2012 im EXPERIMINTA ScienceCenter in Frankfurt/Main geplant (Musik und Sound: Elvira Plenar, Inszenierung: Sabine Koch).
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2002 / 2012
Hermann Hesse (Kurzbiografie)
Hermann Hesse: Unterm Rad
Hermann Hesse: Siddhartha. Eine indische Dichtung
Hermann Hesse: Der Steppenwolf
Hermann Hesse: Narziß und Goldmund
Hermann Hesse: Die Morgenlandfahrt