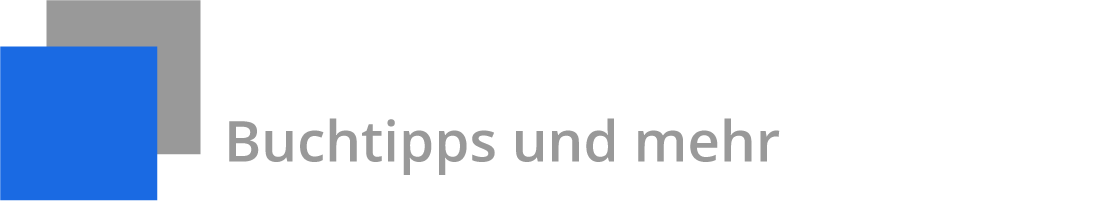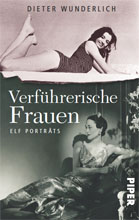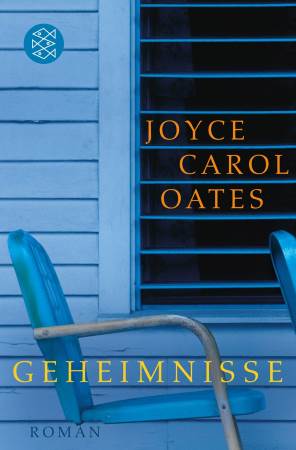Kleopatra
336 v. Chr.: Mit dem Regierungsantritt Alexanders des Großen beginnt der Hellenismus.
332 / 331 v. Chr.: Alexander der Große erobert Ägypten, und der persische Satrap Mazakes kapituliert vor ihm.
331 v. Chr.: Alexander der Große gründet Alexandria an der Stelle der ägyptischen Siedlung Rachotis.
10. Juni 323 v. Chr.: Alexander der Große stirbt in Babylon.
Statt eines Angehörigen des makedonischen Königshauses werden Alexanders Feldherren seine Nachfolger (Diadochen). Da keiner von ihnen mächtig genug ist, um sich als Alleinherrscher durchzusetzen, kommt es zu Kriegen (Diadochenkriege) und Umverteilungen. Schließlich herrschen die Antigoniden in Makedonien (bis 148 v. Chr.), die Seleukiden in Vorderasien (bis 64 v. Chr.) und die Ptolemäer in Ägypten (bis 30 v. Chr.).
Die Dynastie der Ptolemäer wird 323 v. Chr. von dem Feldherrn Ptolemaios in Ägypten gegründet.
Wie ihre Vorgänger sind die Ptolemäer auf den Rückhalt in der Priesterschaft angewiesen, die sich wiederum ihre privilegierte gesellschaftliche und wirtschaftliche Stellung von der Krone absichern lässt.
168 v. Chr.: Der Seleukidenkönig Antiochos IV. von Syrien erobert Ägypten im sechsten Syrischen Krieg, aber bevor er Alexandria einnehmen kann, fordert ihn der römische Gesandte Gaius Popilius Laenas in Eleusis, einem Vorort von Alexandria, zum Abzug auf (Tag von Eleusis). Da Antiochos sich nicht mit der neuen Hegemonialmacht im Osten des Mittelmeers anlegen will, gibt er nach und beendet den Krieg.
100 v. Chr. Gaius Julius Caesar wird geboren.
84 v. Chr.: Caesar heiratet Cornelia, die Tochter des Konsuls Lucius Cornelius Cinna.
80 v. Chr.: Ptolemaios XII. Auletes wird letzter männlicher Pharao. Seine Schwestergemahlin Kleopatra VI. Tryphaina bringt die Tochter Berenike IV. zur Welt.
70 v. Chr.: In Rom fungieren Gnaeus Pompeius Magnus und Marcus Licinius Crassus Dives als Konsuln.
69 v. Chr.: Kleopatra VI. fällt bei ihrem Mann in Ungnade.
69 v. Chr. Kleopatra VII. wird als ältestes Kind in der zweiten Ehe des Pharaos Ptolemaios XII. in Alexandria geboren. Sie bekommt noch eine Schwester, Arsinoë, und zwei Brüder.
68 v. Chr.: Caesar beginnt seine Ämterlaufbahn als Quästor.
67 v. Chr.: Der römische Feldherr Gnaeus Pompeius Magnus erhält ein außerordentliches Kommando für den Krieg gegen die Seeräuber.
67 v. Chr.: Nach dem Tod seiner ersten Frau heiratet Caesar Pompeia, eine wohlhabende Enkelin Sullas, und nutzt ihren Reichtum für seine politische Karriere.
66 v. Chr.: Pompeius besiegt Mithridates VI., den König von Pontos, und beginnt, den Osten neu zu ordnen.
65 v. Chr.: Der kurulische Ädil Caesar scheitert mit seinem Versuch, sich ein außerordentliches Imperium zur Einziehung Ägyptens als römische Provinz zu verschaffen.
Ein litarisches Porträt von Kleopatra finden Sie in dem Buch
„Verführerische Frauen. Elf Porträts“ von Dieter Wunderlich.
Piper Verlag, München 2012 – Leseprobe
64 / 63 v. Chr.: Pompeius hält sich weiter im Orient auf und macht Syrien zur römischen Provinz. Damit bleibt Ägypten der letzte noch nicht von den Römern besetzte Nachfolgestaat des ehemaligen Alexander-Reiches. Ptolemaios XII. übernimmt den Unterhalt von 8000 Reitern des Römers, um dessen Wohlwollen zu gewinnen.
62 v. Chr.: Praetur Casears
60 v. Chr.: Erstes Triumvirat. Strategische Partnerschaft Caesars mit Pompeius, dem erfolgreichen Feldherrn, und Crassus, dem reichsten Mann Roms.
April 59 v. Chr.: Caesar vermählt sich in dritter Ehe mit Calpurnia, einer Tochter des römischen Senators Lucius Calpurnius Piso Caesoninus. Parallel dazu verheiratet er – ebenfalls aus politischen Gründen – seine zwischen siebzehn und vierundzwanzig Jahre alte Tochter Julia mit seinem siebenundvierzigjährigen politischen Partner Gnaeus Pompeius Magnus.
59 v. Chr.: Konsulat Caesars
58 v. Chr.: Zypern wird römische Provinz.
Sommer 58 v. Chr.: Caesar beginnt den Gallischen Krieg.
58 v. Chr.: Ptolemaios XII. flieht vor dem Zorn des Volkes aus dem Land und über Rhodos nach Rom. Zuflucht findet er auf einem Pompeius gehörenden Landgut etwa zwanzig Kilometer südöstlich von Rom. Kleopatra VII. begleitet vermutlich den Vater.
In Alexandria reißt seine verstoßene erste Ehefrau Kleopatra VI. mit ihrer Tochter Berenike IV. die Macht an sich.
Um Bestechungsgelder für die Römer aufzutreiben, muss Ptolemaios XII. unter anderem bei dem römischen Bankier Gaius Rabirius Postumus gewaltige Kredite aufnehmen. Immerhin erreicht er dadurch, dass Caesar – dessen Augenmerk ohnehin von Ägypten nach Gallien wechselt – einen Bündnisvertrag durchsetzt und Ptolemaios XII. zu den Freunden und Verbündeten des römischen Volkes (amici et socii populi Romani) zählt.
Ende 57 v. Chr.: Ptolemaios XII. wartet in Ephesos ab, dass die Römer ihn nach Ägypten zurückbringen.
55 v. Chr.: Pompeius, der Konsul des Jahres 55, ignoriert anders lautende Senatsbeschlüsse und veranlasst Aulus Gabinius, den römische Statthalter Syriens, in Ägypten einzumarschieren und Ptolemaios XII. wieder als Pharao bzw. König einzusetzen. Mit Gabinius‘ Streitmacht kommt Marcus Antonius nach Ägypten. Er ist zwischen siebenundzwanzig und einunddreißig Jahre alt und sammelt als Reiteroffizier erste militärische Erfahrungen.
Ptolemaios XII. kehrt nach Alexandria zurück.
Kleopatra VI. ist inzwischen gestorben. Berenike wird von ihrem Vater zum Tod verurteilt und hingerichtet.
Gabinius zieht wieder nach Syrien, lässt jedoch zum Schutz von Ptolemaios XII. Truppen in Ägypten zurück. Einige dieser Soldaten („Gabiniani“) vermählen sich mit einheimischen Frauen.
Seinen bedeutendsten Gläubiger Gaius Rabirius Postumus muss Ptolemaios XII. zum Dioiketes (Finanzminister) ernennen. Der Römer beutet das Land aus, um seine Schulden einzutreiben. (Als ein Aufstand droht, lässt Ptolemaios XII. ihn zu seinem eigenen Schutz festnehmen – und kurz darauf entkommen.)
54 v. Chr.: Caesars mit Pompeius verheiratete Tochter Julia stirbt.
53 v. Chr.: Crassus fällt im Krieg gegen die Parther.
53 v. Chr.: Von Caesar protegiert, beginnt Antonius als Quästor seine Ämterlaufbahn in Rom.
52 v. Chr.: Ptolemaios XII. setzt seine Tochter Kleopatra VII. als Mitregentin ein.
52 v. Chr.: Caesar schlägt den Aufstand der gallischen Stämme unter Vercingetorix nieder.
51. v. Chr.: Die Parther stoßen nach Syrien vor. Marcus Calpurnius Bibulus trifft Ende des Jahres in als Statthalter in der Provinz ein. Weil seine Truppen zu schwach sind, die Parther zu vertreiben, hofft er auf die Legionäre, die Aulus Gabinius als Söldner in Ägypten zurückließ.
51 v. Chr.: Caesar richtet die Provinz Gallia ein.
Juni 51 v. Chr.: Es wird bekanntgegeben, dass Ptolemaios XII. tot ist. Wahrscheinlich starb er bereits einige Monate vorher.
Nach dem in Rom und Alexandria hinterlegten Testament des Verstorbenen sollten die älteste noch lebende Tochter und der älteste Sohn die Nachfolge antreten. Das wären nun die achtzehnjährige Kleopatra VII. und ihr acht Jahre jüngerer Bruder Ptolemaios XIII. Kleopatra beansprucht die Herrschaft jedoch für sich allein und gibt sich den Beinamen Thea Philopator (vaterliebende Göttin). In der alten Königsstadt Memphis gilt Kleopatra als weiblicher Pharao, in ihrer Residenzstadt Alexandria als griechische Königin.
Marcus Calpurnius Bibulus schickt seine beiden Söhne mit der Bitte zu Kleopatra, ihm die Gabiniani für den Krieg gegen die Parther zu überlassen. Diese wollen jedoch ihr angenehmes Leben in Ägypten nicht aufgeben und ermorden die Abgesandten. Kleopatra ordnet unverzüglich an, die Mörder zu ergreifen und sie Bibulus zu schicken. Damit demonstriert sie ihre Entschluss- und Tatkraft.
Gegen die Alleinherrschaft Kleopatras intrigiert der Eunuch Potheinos, der Erzieher von Ptolemaios XIII., zusammen mit den beiden anderen Vormündern des Thronfolgers, dem General Achillas und dem Rhetoriklehrer Theodotos von Chios.
27. Oktober 50. v. Chr.: In einem Erlass, in dem es um Getreidelieferungen nach einer Dürreperiode in Unterägypten geht, wird Ptolemaios XIII. vor Kleopatra VII. genannt. Offenbar haben Potheinos, Achillas und Theodotos Kleopatra inzwischen gewungen, ihren Bruder an der Regierung zu beteiligen.
Anfang Januar 49 v. Chr.: Der Senat in Rom fordert Caesar am Ende des Gallischen Krieges vergeblich auf, seine zehn Legionen zu entlassen.
10. Januar 49 v. Chr.: Ungeachtet des Verbots, gegen den Willen des Senats Militär auf die Apenninenhalbinsel zu führen, überschreitet Caesar mit einer seiner Legionen den Grenzfluss Rubicon. Pompeius flieht vor ihm nach Brundisium (Brindisi) und weiter nach Griechenland. Bürgerkrieg zwischen Caesar auf der einen und dem Senat und Pompeius auf der anderen Seite.
Frühjahr 49. v. Chr.: Ägypten hält zunächst weiter zu Pompeius und unterstützt ihn mit 50 Kriegsschiffen und 500 Gabiniani.
Spätsommer 49 v. Chr.: Potheinos vertreibt Kleopatra aus Alexandria. Sie flieht zuerst nach Oberägypten und dann nach Palästina. Dort wirbt sie Söldner an, um ihre Rückkehr mit Waffengewalt zu erzwingen. Inzwischen erkennt der römische Exilsenat in Thessaloniki Ptolemeios XIII. als Alleinherrscher in Ägypten an.
48 v. Chr.: Caesar amtiert als Konsul.
48 v. Chr.: Potheinos übernimmt in Alexandria das Amt des Dioiketen (Finanzminister).
9. August 48 v. Chr.: Caesar schlägt Pompeius vernichtend bei Pharsalos.
28. September 48 v. Chr.: Der Unterlegene flieht mit den Resten seiner Flotte zu den mit ihm verbündeten Ptolemäern. Achillas, ein hoher ägyptischer Offizier, kommt ihm mit den römischen Offizieren Lucius Septimius und Salvius in einem Ruderboot entgegen, um ihn an Land zu bringen. Pompejus lässt seine Frau an Bord des Flaggschiffes und steigt in Begleitung von vier Offizieren in das Boot. An der Küste erdolcht Lucius Septimius ihn im Auftrag des von Potheinos geführten Regentschaftsrates.
1. Oktober 48 v. Chr.: Caesar, der Pompeius mit einer kleinen Streitmacht verfolgt, kommt mit zehn Kriegsschiffen von Rhodos nach Ägypten. Theodotos, ein einflussreicher Hofbeamter, übergibt ihm den Siegelring und eine abgetrennte Hand des Ermordeten. Die Hoffnung, Caesar damit zum Weiterziehen bewegen zu können, erfüllt sich nicht: Ägypten ist reich, und Caesar benötigt Geld für die Fortsetzung des Kampfes gegen Pompejus‘ Anhänger.
Kleopatra kehrt aus dem Exil zurück, obwohl die Armee ihres Halbbruders den Landweg nach Alexandria versperrt und die Flotte die Zufahrt auf dem Wasser blockiert. Um unbemerkt von ihren Gegnern zu Caesar vordringen zu können, lässt Kleopatra sich in einem Bettsack (nicht Teppich) an den Wachen vorbei in den Palast tragen. Mit dem mutigen Streich, ihrem selbstsicheren Auftreten, ihrer Klugheit und ihrem Aussehen beeindruckt sie Caesar.
Caesar setzt Kleopatra neben ihrem Bruder Ptolemeios XIII. als Königin ein, gibt Zypern an Ägypten zurück und bestimmt die Geschwister des Königspaares, Arsinoë und Ptolemeios XIV., zu Regenten der Mittelmeerinsel.
Mitte November 48 v. Chr.: Potheinos und Achillas widersetzen sich den neuen Regelungen, denn sie fürchten Kleopatras Rache. General Achillas marschiert mit einer „bunt zusammengewürfelte[n] Truppe aus Gabiniern, Flüchtlingen, Guerillas, Kriminellen, ehemaligen Seeräubern und entlaufenen Sklaven“ (Grant 102) auf, die Caesars Streitmacht zahlenmäßig fünffach überlegen ist. Damit beginnt der Alexandrinische Krieg. Caesar setzt Arsinoë, ihre beiden Brüder und Potheinos im Palast gefangen und verschanzt sich dort.
Trotz seiner quantitativen Unterlegenheit gelingt es Caesar, die ägyptische Flotte in einem kurzen Gefecht zu überwältigen und die gekaperten Schiffe zu verbrennen. (Später heißt es, dabei sei auch die berühmte Bibliothek von Alexandria vernichtet worden, aber das entspricht nicht den historischen Tatsachen.) Außerdem besetzt er den Pharos, von dem aus die Einfahrt in den Großen Hafen kontrolliert werden kann.
Arsinoë flieht zu Achillas und wird zur Gegenkönigin ausgerufen, doch nach einem Streit mit dem General lässt sie diesen mit dem Schwert töten und ersetzt den Befehlshaber durch ihren Erzieher, den Eunuchen Ganymedes. Potheinos, der mehrmals vergeblich versucht haben soll, Caesar zu vergiften, wird in der Zwischenzeit hingerichtet, Ptolemaios XIII. dagegen freigelassen. Der junge König löst Ganymedes ab und übernimmt das Kommando über die ägyptische Armee. Warum ließ Caesar das zu? Vermutlich spekulierte er darauf, dass Ptolemaios XIII. sich ins Unrecht setzen würde und man dann seine Absetzung begründen könnte.
Januar 47 v. Chr.: Caesar gewinnt mit Hilfe der Verstärkung, die ihm Mithridates von Pergamon schickt die Entscheidungsschlacht gegen die zahlenmäßig weit überlegene ägyptische Armee. Der vierzehnjährige König Ptolemaios XIII., der seine Truppen kommandiert, flieht und ertrinkt im Nil als sein überfülltes Schiff sinkt. Alexandria kapituliert. Kurz darauf zieht Caesar in der Stadt ein.
Statt Ägypten zu annektieren, bestätigt Caesar Kleopatra als Königin und ernennt ihren zwölfjährigen Bruder, Ptolemaios XIV., zum Mitregenten. Hätte er das reiche Ägypten zur römischen Provinz gemacht, könnte sie später einmal einem seiner Konkurrenten in Rom als Machtbasis dienen.
Arsinoë wird gefangen genommen, Zypern wieder von Alexandria aus regiert.
Caesar unternimmt mit Kleopatra und vielleicht auch Ptolemeios XIV. an Bord der 115 Meter langen Prunkbarke „Thalamegos“ eine Kreuzfahrt auf dem Nil. Der zweiundfünfzigjährige Römer beginnt eine Romanze mit der einunddreißig Jahre jüngeren Königin Kleopatra VII.
Juni 47 v. Chr.: Caesar verlässt Ägypten.
2. August 47 v. Chr.: Er besiegt Pharnakes II., den König des Schwarzmeerreiches Pontos bei Zela („veni, vidi, vici“).
Nach Caesars Abreise lässt Kleopatra ihm zu Ehren ein Heiligtum in Alexandria errichten.
47 v. Chr.: Kleopatra bringt einen wahrscheinlich von Caesar gezeugten Sohn zur Welt, der den Namen Caesar bzw. Kaisar bekommt.
Dezember 47 v. Chr.: Caesar bricht nach Nordafrika auf. Dort haben sich Pompeius‘ Anhänger mit Juba I. von Numidien verbündet.
Frühjahr 46 v. Chr.: In der Schlacht bei Thapsus besiegt Caesar seinen Gegner Quintus Caecilius Metellus Pius Scipio.
Spätsommer 46 v. Chr.: In einem seiner vier Triumphzüge in Rom führt Caesar, der sich inzwischen vom Senat für zehn Jahre diktatorische Vollmachten erteilen ließ, auch Kleopatras Schwester Arsinoë gefesselt mit. Anschließend schickt er sie ins Exil nach Kleinasien.
Kleopatra reist mit Kaisar und ihrem Brudergemahl nach Rom.
Caesar bringt sie in einer Villa in seinen ausgedehnten Gartenanlagen jenseits des Tibers (Trastevere) unter, reiht sie unter die „Freunde und Bundesgenossen des Römischen Volkes“ ein und lässt in dem von ihm errichteten Tempel der
Venus Genetrix auf dem Caesarforum eine vergoldete Statue von ihr aufstellen. Kleopatra entfaltet eine glänzende Hofhaltung, veranstaltet Bankette und Gartenfeste. Sie führt auch philosophische Diskussionen. Mit gebildeten Römern spricht Kleopatra wahrscheinlich in ihrer griechischen Muttersprache, aber sie beherrscht auch einige andere Sprachen, darunter – und das tat noch kein Ptolemäer vor ihr – das Ägyptische. Obwohl Caesar mit Calpurnia verheiratet ist, führt er eine eheähnliche Beziehung mit Kleopatra. Scheiden lässt er sich nicht, denn die Ehe mit der Tochter des einflussreichen Senators und Konsuls Piso sichert seine Machtbasis in Rom. Cicero und andere Senatoren empören sich über Caesars Lotterleben und den Hochmut der ägyptischen Vasallenkönigin.
Ende 46 v. Chr.: Caesar bricht nach Spanien auf.
17. März 45 v. Chr.: Mit seinem Sieg in der Schlacht bei Munda in Südspanien beendet Caesar einen Aufstand der beiden Söhne des Pompeius.
In Spanien hat Caesar eine Affäre mit Eunoë, der Ehefrau des Königs Bogud II. von Mauretanien.
September 45 v. Chr.: Caesar kehrt nach Rom zurück und hinterlegt sein privates Testament bei den Vestalischen Jungfrauen.
Oktober 45 v. Chr.: Er nimmt die Liebesbeziehung mit Kleopatra wieder auf und lässt sich die diktatorischen Vollmachten vom Senat auf Lebzeiten übertragen (dictator designatus perpetuo).
Gerüchten zufolge beabsichtigt Caesar, den Regierungssitz nach Alexandria zu verlegen.
44 v. Chr.: Caesar und Antonius amtieren als Konsuln.
Caesar plant, am 17. März zu einem Feldzug gegen die Parther aufzubrechen.
15. März 44 v. Chr.: An den Iden des März geht Caesar mit Antonius zur Senatssitzung ins Theater des Pompeius. Der Verschwörer Gaius Trebonius verwickelt Antonius in ein Gespräch, um ihn abzulenken. Währenddessen stürzen sich andere Republikaner mit Dolchen auf Caesar. „Auch du, mein Sohn?“, fragt Caesar angeblich beim Anblick von Marcus Iunius Brutus. Dreiundzwanzig Stiche töten ihn. (Manche vermuten, dass Antonius bereits im Voraus von dem geplanten Attentat wusste und es absichtlich nicht verhinderte.)
Der Anschlag vereitelt Kleopatras Plan, sich in einer noch zu definierenden offiziellen Stellung neben Caesar an der Weltherrschaft Roms zu beteiligen und ihr eigenständiges Reich Ägypten von dort aus zu regieren.
Plötzlich steht Kleopatra allein da, zumal sie sich mit ihrem hochfahrenden Wesen mehr Feinde als Freunde gemacht hat und aufgrund ihres orientalischen Herrscherverständnisses den Republikanern verhasst ist. Mutig bleibt sie zunächst in der Stadt, um die politische Entwicklung vor Ort zu beobachten.
Antonius bemächtigt sich des Staatsschatzes aus dem Tempel der Ops und lässt sich von der Witwe Calpurnia die Papiere und das Privatvermögen ihres Mannes übergeben.
20. März 44 v. Chr.: Unter tumultartigen Umständen wird Caesar bestattet. Antonius hetzt angeblich das Volk durch eine demagogische Trauerrede auf. Der Mob verbrennt die Leiche auf einem improvisierten Scheiterhaufen und versucht anschließend, die Häuser der Attentäter zu stürmen. Aufgrund einer Verwechslung wird der Dichter Gaius Helvius Cinna auf offener Straße totgeschlagen.
April 44 v. Chr.: Kleopatra reist überstürzt ab.
Bald nach ihrer Ankunft in Ägypten vergiftet sie ihren Brudergemahl, wahrscheinlich um zu verhindern, dass Ptolemaios XIV. zum Kristallisationskern einer Oppositionsbewegung wird. Als Mitregenten setzt sie ihren drei Jahre alten Sohn Kaisar mit dem Königsnamen Ptolemaios XV. ein. Sie macht kein Hehl daraus, dass sie ihn als Erben des römischen Alleinherrschers Caesars betrachtet.
Hungersnöte zwingen sie zu entsprechenden Verwaltungsmaßnahmen im Land, aber sie muss auch den weiteren Verlauf des Bürgerkriegs in Rom im Auge behalten. Der überlebende Konsul, Antonius, führt den Kampf gegen die Attentäter. Aber da taucht ein Rivale auf: Gaius Octavius bzw. Octavian, ein neunzehnjähriger Großneffe Caesars, den dieser testamentarisch adoptierte und als Haupterben einsetzte. Um auf seine Ansprüche hinzuweisen, nennt er sich Gaius Iulius Caesar.
2. September 44 v. Chr.: Cicero ruft in der ersten von vierzehn „Philippischen Reden“ zum Kampf gegen Antonius auf. (Die letzte hält er am 21. April 43.)
Oktober 44 v. Chr.: Octavian fühlt sich in Rom gefährdet und verlässt die Stadt. Obwohl er dazu kein Mandat hat, wirbt er ein Heer an.
Daraufhin verständigen sich die Republikaner mit ihm.
Oktober 43 v. Chr.: Auf einer Insel im Fluss Lavinius nahe Bononia verständigen sich Octavian, Antonius und der weniger bedeutende Marcus Aemilius Lepidus über die Bildung eines zweiten Triumvirats.
November 43 v. Chr.: Das Triumvirat wird von der Volksversammlung in Rom beschlossen.
Kleopatra unterstützt die Caesarianer und verbündet sich mit Ciceros Schwiegersohn Publius Cornelius Dolabella, der im Oktober 44 v. Chr. zu der ihm von Caesar zugesagten Provinz Syria aufgebrochen, jedoch auf den Widerstand des Verschwörers Gaius Cassius Longinus gestoßen war. Er erkennt ihren Sohn als ihren Mitregenten an, und sie stellt ihm die vier in Ägypten stationierten römischen Legionen zur Verfügung. Allerdings vermag sie damit nicht Dolabellas Niederlage zu verhindern.
Juli 43 v. Chr.: In aussichtsloser Lage befiehlt Dolabella einem seiner Soldaten, ihn mit dem Schwert zu töten.
Cassius beabsichtigt, gegen Kleopatra zu marschieren. Die illusionslose Realpolitikerin spielt bereits mit dem Gedanken, angesichts der Bedrohung die Seiten zu wechseln, und Sarapion, ihr Statthalter auf Zypern, liefert Cassius Kriegsschiffe aus.
Ende 43 v. Chr.: Als Cassius von seinem Mitverschworenen Brutus nach Kleinasien gerufen wird und die geplante Invasion Ägyptens sein lässt, atmet Kleopatra auf und schickt eine Kriegsflotte zur Unterstützung von Antonius und Octavian los, die jedoch durch einen Sturm zerstört wird.
7. Dezember 43 v. Chr.: Cicero, „die Seele des Widerstandes gegen Antonius“ (Alfred Heuss, S. 228), wird von politischen Gegnern ermordet.
Oktober / November 42 v. Chr.: Bei Philippi in Makedonien besiegen die Caesarianer in zwei Schlachten die Tyrannenmörder.
Im Triumvirat übernimmt Antonius die Verantwortung für den östlichen Mittelmeerraum. Kleopatra tut also gut daran, sich gut mit ihm zu stellen.
Das Schwanken der Klientelkönigin war Antonius nicht entgangen. Er bestellt sie deshalb in sein Hauptquartier in Kilikien. Das Heck ihrer mit purpurfarbenen Segeln bestückten Prachtgaleere ist vergoldet. Statt Antonius aufzusuchen, lädt sie ihn zu mehreren Festmählern auf ihr Schiff ein und bewirtet und beschenkt ihn pompös.
Kleopatra stilisiert sich und Antonius als Aphrodite und Dionysos. Das verleiht ihrer Beziehung eine religiöse Bedeutung, die das Volk beeindruckt. Wolfgang Schuller vermutet, dass Kleopatra sich in ihrem Verhalten gegenüber Caesar und Antonius zuerst von der Staatsräson leiten ließ, sich dann aber wirklich in sie verliebte.
Antonius liefert ihr den inzwischen gefangen genommenen Statthalter Sarapion aus, und um zu demonstrieren, dass sie auf der Seite der Caesarianer steht, befiehlt Kleopatra, ihn hinzurichten. Außerdem überredet sie Antonius, ihre Schwester Arsinoë, die im Tempel der Artemis Leukophryne in Ephesos Schutz gesucht hat, zu ermorden.
Winter 41/40 v. Chr.: Kleopatra kehrt nach Alexandria zurück, und Antonius folgt ihr.
In Alexandria erwartet Antonius ein Leben in Saus und Braus. Einer Anekdote zufolge gewinnt Kleopatra eine Wette, indem sie eine Perle, die ein Vermögen wert ist, in einem Glas Essig auflöst und die Flüssigkeit schlürft.
Antonius vergnügt sich in Alexandria, obwohl von Osten her die Parther verstoßen und seine (dritte) Ehefrau Fulvia und sein Bruder Lucius auf der Apenninenhalbinsel Krieg gegen Octavian führen (Perusinischer Krieg). Kleopatra ermahnt ihn schließlich, seine Pflichten nicht zu vernachlässigen.
Anfang 40 v. Chr.: Antonius verlässt Ägypten.
Herbst 40 v. Chr: Antonius trifft sich mit Octavian, der inzwischen Fulvia und Lucius besiegt hat, in Brundisium (Brindisi), und die beiden teilen ihre Einflussgebiete auf: Octavian beherrscht weiterhin den Westen einschließlich der Apenninenhalbinsel, Antonius den Osten. Lepidus wird mit Afrika abgespeist. Um das Abkommen von Brundisium zu bekräftigen, heiratet Antonius nach Fulvias Tod (Mitte 40 v. Chr.) Octavians ebenfalls verwitwete Schwester Octavia. Deren Aufgabe soll es sein, das Einvernehmen zwischen ihrem Ehemann und ihrem Bruder zu sichern und einen weiteren Bürgerkrieg zu verhindern. Außerdem erzieht sie die beiden Söhne von Antonius und Fulvia.
Herbst 40 v. Chr.: Kleopatra bringt ein von Antonius gezeugtes Zwillingspaar zur Welt: Alexandros Helios und Kleopatra Selene.
Ende 40 v. Chr.: Prunkvoll empfängt Kleopatra in Alexandria den jüdischen König Herodes, der auf der Flucht vor den Parthern ist. Nachdem er das Angebot, in ihre Dienste zu treten, zurückgewiesen hat, reist er mit einem ägyptischen Schiff weiter nach Rom. Die Triumvirn ernennen ihn zum jüdischen König und versprechen, ihm gegen die Parther beizustehen. Diese Entwicklung missfällt Kleopatra, denn sie würde gern Teile von Judäa an sich reißen.
Herbst 39 v. Chr.: Antonius reist nach Griechenland, lässt sich mit Octavia in Athen nieder und verwaltet von dort aus den Osten.
Das Ehepaar bekommt zwei Töchter.
Frühjahr 37 v. Chr.: Antonius reist mit Octavia nach Tarent, um mit Octavian über die geplanten Kriege gegen die Parther und gegen Sextus Pompejus zu verhandeln und sich über eine Verlängerung des Triumvirats bis 33 v. Chr. zu verständigen. Der Vertrag von Tarentum wird durch die Hochzeit von Marcus Antonius Antyllus, des ältesten Sohnes aus der Ehe von Antonius und Fulvia, mit Octavians Tochter Julia besiegelt. – Von Tarent aus begleitet Octavia ihren Ehemann nach Korkyra (Korfu). Während Antonius nach Syrien weiterreist, kehrt Octavia mit ihren Kindern und Stiefkindern nach Rom zurück.
Winter 37 / 36 v. Chr.: Statt von Syrien aus gegen die Parther zu ziehen, schickt Antonius Fonteius Capito nach Alexandria, um Kleopatra nach Antiochia zu holen. Er überlässt ihr Kyrene (Libyen), Syrien, den östlichen Teil der Insel Kreta und den Süden von Kilikien. Sie erweitert ihr Reich dadurch beträchtlich, aber sie annektiert die neuen Herrschaftsgebiete nicht, sondern regiert sie als Klientelkönigin Roms.
Frühjahr 36 v. Chr.: Kleopatra begleitet Antonius auf dem Marsch gegen die Parther bis zum Euphrat. Auf dem Rückweg besucht sie Herodes. Angeblich versucht sie ihn zu verführen, aber er lässt sich auf nichts ein und spielt sogar mit dem Gedanken, sie zu töten. Aber seine Berater bringen ihn davon ab, und er gibt Kleopatra am Ende sogar das Geleit bis zur Grenze.
36 v. Chr.: Kleopatra bringt einen dritten Sohn zur Welt: Ptolemaios Philadelphos.
Herbst 36 v. Chr.: Octavian entmachtet Lepidus.
Ende 36 v. Chr.: Hätte Antonius die Parther vernichtet, wäre Herodes von allen Seiten unter Druck geraten. Antonius kehrt jedoch erfolglos, mit dezimierten Streitkräften zurück und befürchtet vor seinem Wiedersehen mit Kleopatra in Phönikien deren Zorn.
Januar 35 v.Chr.: Kleopatra begrüßt ihren Geliebten jedoch freudig.
Den restlichen Winter verbringen die beiden zusammen in Alexandria.
Anfang 35 v. Chr.: Antonius bereitet einen neuen Feldzug gegen die Parther vor. Octavian schickt ihm Octavia mit Truppen, Geld und Ausrüstung. Aber in Athen erhält sie einen Brief ihres inzwischen nach Syrien gezogenen Ehemanns, in dem er ihre Unterstützung ablehnt. Gedemütigt kehrt sie nach Rom zurück. Über die Motive Antonius‘ können wir nur rätseln. Plutarch vermutet, Kleopatra habe Octavia als Rivalin gefürchtet und Antonius deshalb dazu gebracht, zu ihr nach Alexandria zurückzukehren, statt mit Unterstützung seiner Ehefrau einen neuen Parther-Feldzug zu beginnen.
Sommer 35 v. Chr.: Antonius lädt König Herodes nach Laodikeia in Phrygien vor. Kleopatra hatte zuvor mit Herodes‘ Ehefrau Mariamne konspiriert und erreicht, dass Herodes 36 v. Chr. widerstrebend Mariamnes Schwager Aristobulos zum Hohepriester machte. Als er den Sechzehnjährigen einige Zeit später ertränken ließ, überredete Kleopatra ihren Geliebten, ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Ihre Hoffnung, auf diese Weise doch noch Judäa in die Hand zu bekommen, erfüllt sich jedoch nicht, denn Antonius spricht den jüdischen Klientelkönig frei. (29. v. Chr. lässt Herodes seine Frau Mariamne hinrichten.)
34 v. Chr.: Statt gegen die Parther marschiert Antonius nach Westarmenien, bedroht Artaxata, die Hauptstadt des Königs Artavasdes II., zwingt diesen zur Unterwerfung und präsentiert ihn bei einem Triumphzug in Alexandria (!) als Gefangenen in goldenen Ketten. Für Kleopatra wurde aus diesem Anlass eigens ein goldener Thron auf einer silbernen Plattform errichtet. (Weil Artavasdes nicht um Gnade bittet und Kleopatra die Proskynese verweigert, lässt diese ihm nach der Schlacht bei Actium den Kopf abschlagen.)
Antonius bestätigt anschließend Kleopatra und ihren Sohn Ptolemaios Kaisar als Herrscher in Ägypten, Zypern und der Kyrenaika, spricht seinem Sohn Alexandros Helios alles (noch zu erobernde) Land östlich des Euphrats zu und macht Ptolemaios Philadelphos zum Herrscher des Gebiets zwischen Euphrat und Hellespont. Kleopatra befindet sich am Zenit ihrer Macht. Dabei ist festzuhalten, dass der Triumvir durch die „Schenkungen von Alexandria“ keineswegs römische Eroberungen verschleudert, wie Octavian behauptet, denn er bleibt in jedem Fall der oberste Machthaber.
Januar 33 v. Chr.: Octavian übernimmt für ein Jahr das Konsulat.
Antonius und Kleopatra ziehen mit sechzehn Legionen und achthundert Schiffen nach Ephesos.
Januar 32 v. Chr.: Die Konsuln Gnaeus Domitius Ahenobarbus und Gaius Sosius treten ihr Amt an. Sosius hält im Senat eine leidenschaftliche Rede gegen Octavian. Weil er und sein Amtskollege sich danach in Rom nicht mehr sicher fühlen, fliehen sie mit einigen Senatoren zu Antonius in den Osten, während Octavian – der eigentlich nur noch Privatmann ist – zwei neue Konsuln ausruft.
Domitius Ahenobarbus und Sosius raten Antonius, die hochmütige ägyptische Königin nach Hause zu schicken, um Octavians Propaganda die Grundlage zu entziehen. Sie überwerfen sich deshalb mit dem Feldherrn und wechseln daraufhin die Seiten.
April 32 v. Chr.: Antonius und Kleopatra verlegen ihr Hauptquartier nach Samos.
Mai 32 v. Chr.: In Athen, wo man Antonius und Kleopatra je eine Ehrenstatue auf der Akropolis errichtet, setzen sie ihr verschwenderisches Treiben fort, und Antonius erklärt seine Ehe mit Octavia für geschieden.
In Rom verbreitet Octavian das Gerücht, Antonius sei Kleopatra hörig und verschleudere den Osten des Reiches. Widerrechtlich verschafft er sich Antonius‘ im Tempel der Vestalinnen in Rom hinterlegtes Testament und gibt (möglicherweise gefälschte) Passagen bekannt, die geeignet sind, die Empörung über seinen Gegner zu schüren.
32 v. Chr.: Octavian erklärt Kleopatra – nicht etwa Antonius – den Krieg.
32 / 31 v. Chr.: Antonius stellt eine Armee aus Römern, Ägyptern und dreizehn verbündeten Königreichen auf. 100.000 Fußsoldaten, 12.000 Reiter und Tausende von Pferden werden auf fünfhundert Kriegsschiffen nach Griechenland transportiert. Die Kriegsvorbereitungen ziehen sich hin.
Den Winter verbringen Antonius und Kleopatra in Patras.
März 31. v. Chr.: Octavians Feldherr Marcus Vipsanius Agrippa segelt mit einem großen Teil der Flotte Octavians über das Ionische Meer und nimmt den strategisch wichtigen Flottenstützpunkt der Gegner in Methoni in Messenien ein.
Agrippa schließt die Flotte von Antonius und Kleopatra bei Actium am Golf von Ambrakia ein, und eine monatelange Blockade beginnt. In dem Sumpfklima erkranken viele der Soldaten von Antonius und Kleopatra. Kleopatra setzt schließlich im Kriegsrat ihren Plan durch, die feindlichen Linien nicht zu Lande, sondern auf dem Wasser zu durchbrechen. Andernfalls hätte Antonius sie und die Flotte aufgeben müssen.
2. September 31 v. Chr.: Die Schlacht bei Actium beginnt. Weil es aufgrund der Seuche an Ruderern fehlt, verbrennen Antonius und Kleopatra die Schiffe, die sie nicht bemannen können. Sie ließen Segel mit an Bord nehmen, obwohl diese bei einem Seegefecht eher hinderlich sind, denn sie haben die Hoffnung auf einen Sieg aufgegeben und wollen dem Gegner nur noch entkommen. Am Nachmittag durchbricht Kleopatra mit sechzig nicht an der Seeschlacht beteiligten Schiffen planmäßig die feindlichen Linien und flieht mit der Kriegskasse nach Süden. Antonius folgt ihr, während seine Streitkräfte noch stundenlang weiterkämpfen. Die Fußtruppen ergeben sich erst eine Woche nach der Flucht ihres Feldherrn.
Antonius segelt zur Kyrenaika, wo er vier Legionen unter Lucius Pinarius Scarpus zurückließ. Aber der zum Sieger der Schlacht bei Actium übergelaufene Befehlshaber tötet den Boten des Verlierers. Auch König Herodes und alle anderen Klientelkönige bis auf Kleopatra schließen sich Octavian an. In seiner aussichtslosen Lage erwägt Antonius einen Selbstmord, aber seine Getreuen bringen ihn davon ab und überreden ihn, nach Alexandria zu Kleopatra reisen.
Kleopatra versucht vergeblich, ihn von seiner Depression zu befreien. Sie hat inzwischen politische Gegner töten lassen und deren Besitz konfisziert. Mit dem Geld reorganisiert sie ihre Streitkräfte, und sie verhandelt mit potenziellen Bundesgenossen wie den Medern. Möglicherweise wendet sie sich an Octavian mit der Bitte, wenigstens ihren Kindern die Herrschaft in Ägypten zu belassen.
Zur Sicherung der Nachfolge werden Ptolemaios Kaisar und Marcus Antonius Antyllus, der Sohn von Antonius und Fulvia, feierlich unter die Epheben aufgenommen.
Kleopatra schickt ihren Sohn mit seinem Erzieher Rhodon und einem Teil des Schatzes nilaufwärts. Von dort aus soll er durchs Rote Meer nach Indien segeln. Durch den Transport von Schiffen auf dem Landweg vom Mittelmeer nach Heroonpolis am Golf von Suez bereitet sie ihre eigene Flucht vor, aber der Nabatäerkönig Malchos überfällt den Hafen und verbrennt die Schiffe.
Anfang 30 v. Chr.: Octavian segelt von Brundisium über Korinth und Rhodos nach Kleinasien. Auf Rhodos empfängt er Herodes, der ihm Treue schwört. Antonius bietet ihm an, seine Ämter niederzulegen, und Kleopatra bittet Octavian zweimal, die ägyptische Herrschaft ihren Kindern überlassen zu dürfen. Octavian antwortet entweder gar nicht oder ausweichend.
Antonius stellt sich ihm entgegen. Vor der ägyptischen Stadt Pelusium im Osten des Nildeltas gelingt es ihm, Octavians Reiterei in die Flucht zu schlagen. Aber damit vermag er die endgültige Niederlage nicht abzuwenden.
1. August 30 v. Chr.: Antonius‘ Streitmacht ergibt sich Octavian kampflos.
Während Octavian in die Stadt einmarschiert, verbarrikadiert sich Kleopatra mit den kostbarsten Stücken aus ihrer Schatzkammer in ihrem Mausoleum neben dem Isistempel.
Auf die Nachricht, Kleopatra habe Selbstmord verübt, befiehlt Antonius seinen Männern, ihn zu töten, aber niemand wagt es, Hand an ihn zu legen. Schließlich stürzt er sich in sein Schwert. Trotz seiner schweren Verletzung lebt er noch, als er erfährt, dass die Nachricht falsch war. Verzweifelt lässt er sich zu Kleopatras Grabmal bringen und angeblich zu einem Fenster hinaufziehen. Der Legende zufolge verblutet in den Armen seiner Geliebten.
Octavian nimmt Alexandria ein.
Die stolze Königin will verhindern, dass Octavian sie nach Rom deportiert und bei einem Triumphzug präsentiert. Plutarch schildert, wie sie die Wirkung verschiedener Gifte an inhaftierten Verbrechern ausprobiert.
Bevor Kleopatra sich das Leben nehmen kann, gelingt es dem mit Octavian befreundeten Eques (Ritter) Gaius Proculeius, unbemerkt mit zwei Helfern über eine Leiter durch ein Fenster in das Mausoleum einzudringen, während der Dichter Gaius Cornelius Gallus zum Schein durch die verschlossene Tür mit Kleopatra verhandelt. Die List ermöglicht es Proculeius, Kleopatra zu überwältigen und gefangen zu nehmen.
Nach der von Octavian gestatteten prunkvollen Bestattung ihres Lebensgefährten versucht Kleopatra sich in der Gefangenschaft tot zu hungern, aber als Octavian droht, ihre Kinder zu töten, stellt sie das Vorhaben ein.
12. August 30 v. Chr.: Obwohl Octavian Kleopatra von dem Freigelassenen Epaphroditos scharf bewachen lässt, gelingt es ihr, sich zu vergiften. Plutarch behauptet, ein Bauer habe ein mit Feigen gefülltes Weidenkörbchen an den Wachen vorbeigeschmuggelt, und darin sei eine Giftschlange versteckt gewesen. Als Octavian eine Brieftafel von Kleopatra erhält, ahnt er sofort, was sie vorhat, aber er kommt zu spät: Sie ruht tot auf dem Bett, und ihre beiden Zofen Eiras und Charmion liegen im Sterben. – Dass Kleopatra wirklich durch einen Schlangenbiss starb, ist eher zu bezweifeln. Wahrscheinlicher ist es, dass sie sich, Eiras und Charmion auf andere Weise vergiftete. Es könnte auch sein, dass Octavian sie heimlich ermorden ließ.
Octavian lässt Kleopatra ebenso feierlich bestatten wie Antonius.
Ihren Sohn Ptolemaios Kaisar, der mit seinem Erzieher Rhodon aus Alexandria floh, lockt er zurück und ermordet ihn, denn solange ein leiblicher Sohn Caesars lebt, kann er sich als Adoptivsohn des toten Alleinherrschers nicht sicher fühlen. Auch Antyllus wird getötet. Hingegen lässt Octavian die drei Kinder von Kleopatra und Antonius von seiner Schwester Octavia in Rom erziehen.
Die dreihundertjährige Ptolemäerherrschaft ist zu Ende. Octavian zieht Ägypten als persönliche römische Provinz ein und ernennt Gaius Cornelius Gallus zum praefectus Aegypti.
29. v. Chr.: Bei seinem Triumphzug in Rom führt Octavian ein Bildnis Kleopatras mit.
13. bis 16. Januar 27 v. Chr.: In einem mehrtägigen Staatsakt begründet Octavian das Prinzipat und nimmt den neuen Ehrennamen Augustus an. Faktisch wird Rom damit zum Kaiserreich.
Während in der arabischen Rezeption Kleopatras kulturelle Leistungen hervorgehoben werden, kreist das Interesse in Europa seit jeher um die tragischen Liebesgeschichten.
Kleopatra regte viele Künstler zu Werken an. Als Beispiele seien die Tragödie „Antonius und Kleopatra“ (1606/07) von William Shakespeare, die Oper „Julius Caesar in Ägypten“ (1723) von Georg Friedrich Händel, das Gemälde „Das Gastmahl der Kleopatra“ (1733/34) von Giovanni Battista Tiepolo und die Komödie „Caesar und Kleopatra“ (1899) von George Bernard Shaw genannt. Über hundert Filme wurden über Kleopatra gedreht, darunter „Cleopatra“ (1934) von Cecil B. DeMille mit Claudette Colbert und „Cleopatra“ (1963) von Joseph L. Mankiewicz mit Liz Taylor in der Titelrolle.
April 2009: Der ägyptische Archäologe Zahi Hawass behauptet, im Tempel Taposiris Magna bei Alexandria das Grab von Kleopatra und Antonius entdeckt zu haben.
Literatur über Kleopatra:
- Uwe Baumann: Kleopatra (Rowohlt, Reinbek 2003, ISBN 3-499-50509-6)
- Ilse Becher: Das Bild der Kleopatra in der griechischen und lateinischen Literatur (Leipzig 1961)
- Joachim Brambach: Kleopatra (Eugen Diederichs, München 1996, ISBN 3-424-01239-4)
- Manfred Clauss: Kleopatra (Beck, München 2000, ISBN 3-406-39009-9)
- Michael Grant: Kleopatra. Eine Biographie. (Lübbe, Bergisch Gladbach 1998, ISBN 3-404-61416-X)
- Heinz Heinen: Kleopatra-Studien. Gesammelte Schriften zur ausgehenden Ptolemäerzeit (Universitäts-Verlag Konstanz 2009, ISBN: 978-3-87940-818-4)
- Heinz Heinen: Rom und Ägypten von 51 bis 47 v. Chr. Untersuchungen zur Regierungszeit der 7. Kleopatra und des 13. Ptolemäers (Dissertation, Tübingen 1966)
- Jack Lindsay: Kleopatra (Diederichs, Düsseldorf / Köln 1972, ISBN 3-424-00459-6)
- Christoph Schäfer: Kleopatra (Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2006, ISBN 3-534-15418-5)
- Stacy Schiff: Cleopatra. A Life (Little, Brown and Company 2010, ISBN 978-0316001922)
- Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen (Albatros, Düsseldorf 2002, ISBN 3-491-96053-3)
- Wolfgang Schuller: Kleopatra. Königin in drei Kulturen (Rowohlt, Reinbek 2006, ISBN 978-3-498-06364-1)
- Pat Southern: Kleopatra. Ein Lebensbild (Magnus, Essen 2003, ISBN 3-88400-013-6)
- Hans Volkmann: Kleopatra. Politik und Propaganda (Oldenbourg, München 1953)
- Diana Wenzel: Kleopatra im Film. Eine Königin Ägyptens als Sinnbild für orientalische Kultur (Gardez, Remscheid 2005, ISBN 3-89796-121-0)
- Ortrud Westheider und Karsten Müller (Hg.): Kleopatra und die Caesaren. Eine Ausstellung des Bucerius-Kunst-Forums Hamburg, 28. Oktober 2006 bis 4. Februar 2007 (Hirmer, München 2006, ISBN 3-7774-3245-8)
- Dieter Wunderlich: Verführerische Frauen. Elf Porträts (Piper, München 2012, ISBN 978-3-492-27274-2)
© Dieter Wunderlich 2010
Wolfgang Schuller: Kleopatra. Königin in drei Kulturen
Ein litarisches Porträt von Kleopatra finden Sie in dem Buch
„Verführerische Frauen. Elf Porträts“ von Dieter Wunderlich