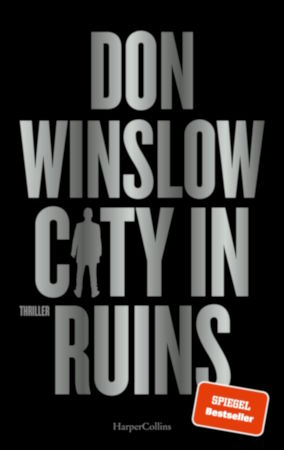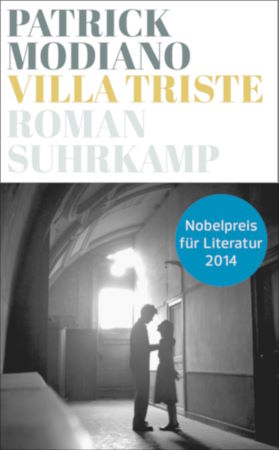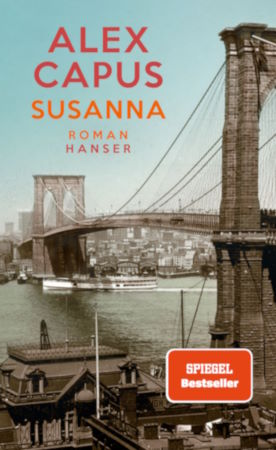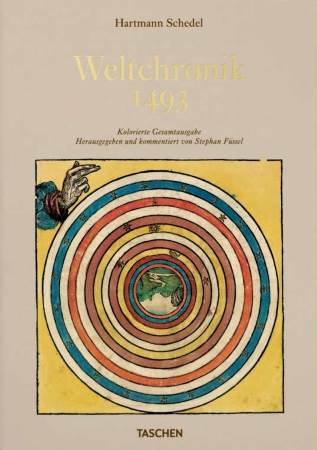Jean Echenoz : Ich gehe jetzt

Inhaltsangabe
Kritik
Félix Ferrer ist etwa fünfzig Jahre alt und betreibt in Paris eine Kunstgalerie. Mit seiner Ehefrau Suzanne bewohnt er ein Einfamilienhaus in Paris-Issy. Weil er sich mit ihr langweilt, beschließt er kurz nach Neujahr, sie zu verlassen.
Ich gehe jetzt, sagte Ferrer, ich verlasse dich. Ich lasse alles hier, aber ich gehe weg. (Seite 5)
Ferrer zieht zu Laurence, einer seiner Geliebten. Anfangs schläft er jede Nacht bei ihr, dann seltener, bis sie ihn hinauswirft und er sich eine Wohnung in der Rue d’Amsterdam mietet. Dort kommt eines Abends sein Assistent Louis-Philippe Delahaye vorbei und erzählt Ferrer, dass am 11. September 1957 an der Küste des Mackenzie-Distrikts im äußersten Norden Kanadas ein kleines Handelsschiff, die „Nechilik“, auf ein Riff lief und vom Packeis eingeschlossen wurde. Die Besatzung floh zu Fuß zur nächsten Handelsniederlassung. Wegen der Unzugänglichkeit des arktischen Gebiets verzichtete die Reederei auf eine Bergung des Schiffes und der aus Fellen und arktischen Antiquitäten bestehenden Ladung. Ferrer hört kaum zu, denn er ist mehr an Delahayes Begleiterin Victoire interessiert – und die zieht eine Woche später bei ihm ein.
Aber Delahaye lässt nicht locker, zählt auf, was er über arktische Kunst weiß und sagt, dass er Nachforschungen über die genaue Position des Schiffes anstellt.
Von Dr. Feldman, seinem Kardiologen, wird Ferrer darauf hingewiesen, dass es mit seinen Herzkranzgefäßen nicht gut aussehe: Es bestehe ein erhöhtes Risiko für ihn, einen atrioventrikulären Block zu erleiden, also einen Vorhof-Herzkammer-Stillstand. Auf keinen Fall dürfe er sich extremen Temperaturen aussetzen.
Eines Morgens, als Ferrer aufwacht, ist Victoire nicht mehr da. Er tröstet sich mit seiner Nachbarin Bérangère Eisenmann, aber das ist nicht ganz unproblematisch, weil sie „Extatics Elixir“ benutzt, ein intensives Parfum, dessen Geruch er nach ihren Besuchen kaum noch aus seiner Wohnung, seiner Bettwäsche und seiner Kleidung herausbekommt.
Mitte des Jahres erhält Ferrer die Nachricht vom plötzlichen Tod seines Assistenten. Bei der Beerdigung lernt er Martine Delahaye kennen, die Witwe des Verstorbenen.
Während des Begräbnisses besichtigt ein Mann namens Baumgartner ein Apartment in einem Haus unweit des Friedhofs. Er tritt ans Fenster und beobachtet eine Weile die Trauernden, dann erklärt er der Vermieterin, dass die Wohnung nicht für ihn in Frage komme und verabschiedet sich.
Als Ferrer von der Trauerfeier nach Hause kommt, findet er einen unter der Tür durchgeschobenen Umschlag und darin die genaue Position der „Nechilik“: 118° östliche Länge, 69° nördliche Breite.
Nach kurzer Vorbereitung macht Ferrer sich auf den Weg. Es trifft sich gut, dass er den Schwerpunkt seiner Galerie seit einiger Zeit von den Objektkünstlern auf traditionellere Kunstformen verlagert hat. Da würden die Kunstobjekte aus der Arktis gut passen. Ferrer fliegt von Paris nach Montreal und weiter nach Quebec, wo er an Bord des Eisbrechers NGCC „Des Groseilliers“ geht. Zur Besatzung gehört die junge Krankenschwester Brigitte, die auch für die Bibliothek und Videothek zuständig ist, und obwohl sie offenbar etwas mit dem Funker hat, liegt sie nach ein paar Tagen mit Ferrer in dessen Kajüte. Der Eisbrecher setzt Ferrer an der Wagner Bay ab. Mit einer Cessna Caravan fliegt er nach Port Radium, und dort trifft er seine beiden Führer Angutretok und Napaseekadlak mit den Schlittenhunden. Die tauschen sie allerdings bei der nächsten Station gegen drei Schneescooter mit leichten Anhängern um.
Und beim Abendessen brachte Angutretok Ferrer einige der hundertfünfzig Wörter bei, mit denen auf Iglulik der Schnee bezeichnet wird, vom verharschten Schnee bis hin zum knirschenden Schnee, über frischen, weichen Schnee, harten, wellenförmigen Schnee, feinen, pulvrigen Schnee, feuchten, kompakten Schnee und vom Winde aufgewehten Schnee. (Seite 50)
Endlich kommt die „Nechilik“ in Sicht, und an Bord findet Ferrer tatsächlich drei wuchtige Metalltruhen voll seltener Werke der frühen Walfang-Kulturen: Masken, Schädel, gravierte Reißzähne von Haien, Spielzeug aus Seehund-Knochen, Figuren aus Mammut-Stoßzähnen, Ringe aus Meteoriten-Nickel und so weiter. Es ist nicht einfach, die schweren Kisten von Bord zu tragen, aber die drei Männer schaffen es und kehren mit der Last nach Port Radium zurück.
Eigentlich wollte Ferrer nach einer kurzen Verschnaufpause weiter, aber als er neugierig in eines der Fenster schaut, wird er von der dort wohnenden Familie Aputiarjuk eingeladen, hereinzukommen, dann zum Essen, zum Übernachten – und schließlich bleibt er einige Wochen lang. Jede Nacht schlüpft die Tochter zu ihm ins Bett.
Inzwischen suchte Baumgartner einen verwahrlosten Junkie in Paris auf, der auf den seltsamen Namen „Heilbutt“ hört. Er ließ ihm 5000 Francs da und ein Handy, mit dem Heilbutt allerdings nur angerufen werden kann, und zwar nur von Baumgartner, weil niemand außer ihm die Nummer kennt. Seit dem Besuch bei Heilbutt treibt Baumgartner sich in Südwestfrankreich herum.
Gleich nach seiner Rückkehr legt Ferrer seinen Schatz dem Experten Jean-Philippe Raymond zur Begutachtung vor. Der untersucht die aus der Arktis mitgebrachten Gegenstände und Ferrer schließt aus seiner missmutigen Miene, dass die Expedition nutzlos war, aber da erklärt Raymond, nach Abzug der Steuern würde es noch immer für ein oder zwei Loire-Schlösser reichen, nicht gerade Chambord oder Chenonceaux, aber immerhin für zwei kleine oder mittlere Schlösser wie Montcontour oder Talcy. Der Experte kann es kaum glauben, dass Ferrer weder einen Tresor noch eine Versicherung für die wertvollen Sachen hat. Der Kunsthändler will sich unverzüglich darum kümmern, aber vorher verabredet er sich erst einmal mit Raymonds Assistentin Sonia.
Beim medizinischen Check-up bestätigt sich Dr. Feldmans Befürchtung. Zum Glück ahnt der Kardiologe nichts von Ferrers Expedition in die Arktis, aber er warnt seinen Patienten noch einmal vor extremen Temperaturen.
Während Ferrer beim Arzt ist, mietet Heilbutt auf Anweisung Baumgartners einen Kühlwagen.
Und während er [Ferrer] sich der Rue d’Amsterdam nähert, auf dem Bürgersteig im Zickzack den Hundehaufen ausweichend, bietet ihm die Bühne der Stadt in folgender Reihenfolge einen Kerl mit Sonnenbrille, der eine große Trommel aus einem weißen Rover lädt, ein kleines Mädchen, das seiner Mutter mitteilt, es habe sich nunmehr, nach reiflicher Überlegung, fürs Trapez entschieden, dann zwei junge Frauen, die einander wegen eines Parkplatzes tot schlagen, schließlich einen kleinen Kühlwagen, der in flottem Tempo davonfährt. (Seite 106)
In der Galerie telefoniert Ferrer mit der Versicherung und dem Tresorhändler und verabredet sich mit beiden für den nächsten Tag. Dann bespricht er mit Elisabeth – die er als Ersatz für Delahaye eingestellt hat – die Beleuchtung für die geplante Ausstellung der Arktisobjekte. Zum Probieren will er zwei oder drei der Gegenstände von hinten holen – aber die Tür des Wandschranks steht offen. Der gesamte von Ferrer aus der „Nechilik“ geborgene Schatz wurde geraubt!
Am nächsten Tag sieht Baumgartner zu, wie Heilbutt die Kisten aus dem Kühlwagen in ein Lagerhaus in Charenton schleppt. Dann behauptet er, eine Kiste fehle, denn es müssten acht statt sieben sein, und als Heilbutt noch einmal in den Kühlwagen steigt, um nachzusehen, wirft Baumgartner hinter ihm die Türen zu und verriegelt sie, bevor er sich ans Steuer setzt.
Übrigens gibt es bei Fahrzeugen dieses Typs zwei Kühlstufen: +5° oder -18°. Diese zweite hat Baumgartner vorgestern am Telefon ausdrücklich bestellt. (Seite 113)
Der Raub droht Ferrer zu ruinieren, denn er hat sein gesamtes Vermögen in die Arktis-Expedition investiert.
Und da die Galerie jetzt, bei mehr als mäßiger Konjunktur und in der Nebensaison, nichts abwarf, war das natürlich auch der Augenblick, den seine Gläubiger wählten, um ihn an ihre Existenz zu erinnern, die Künstler, um sich auszahlen zu lassen, und die Bankiers, um ihm ihre Besorgnis mitzuteilen. (Seite 115)
Verzweifelt versucht Ferrer, sich mit den Kreditabteilungen der Banken zu arrangieren. Beim Warten in einem der Geldinstitute fühlt er sich plötzlich von einem Halbtonnengewicht niedergedrückt und sinkt zu Boden.
Nun, er kam recht bald wieder zu sich, allerdings brachte er jetzt keinen Ton heraus; vorhin war sein Blickfeld wie ein Fernseher, den man abstellt, von den Rändern her schwarz geworden, jetzt war es wie eine Kamera, die nach dem jähen Tod des Kameramanns zu Boden fällt und starr aufnimmt, was ihr vors Objektiv kommt […] (Seite 119)
Kapitel 23 endet mit dem Satz: „Dann wurde ihm erneut schwarz vor den Augen.“ (Seite 120) Kapitel 24 beginnt folgendermaßen: „Als er sie wieder aufschlug, sah er zunächst ringsum nichts als Weiß, wie im guten alten Packeis neulich.“ (Seite 121). Ferrer kommt nämlich auf der Intensivstation eines Krankenhauses wieder zu sich.
In diesem Augenblick ging die Tür auf, eine junge Frau, ebenfalls in weißer Kleidung, doch mit schwarzer Haut, steckte den Kopf herein, wandte sich zu einer anderen um, wohl einer Hilfspflegerin, und bat sie, Docteur Sarradon zu informieren, die 43 sei aufgewacht. (Seite 122)
Unvermittelt erhält Ferrer Besuch von einer Frau, die ihm unmittelbar vor seinem Zusammenbruch in der Halle einer Bank aufgefallen war. Auch in den folgenden Tagen schaut sie bei ihm vorbei. Am dritten Tag fragt er sie nach ihrem Namen. Sie heißt Hélène. Schließlich erzählt sie, sie sei Medizinerin und habe in der Grundlagenforschung gearbeitet, zuletzt in der Immunologie der Salpêtrière, aber eine Erbschaft und regelmäßige Alimentezahlungen ermöglichten es ihr, vor zwei Jahren die Berufstätigkeit aufzugeben. Hélène ist attraktiv und kleidet sich aufregend, aber Ferrer versucht vergeblich, bei ihrem Anblick sexuelle Begierden zu entwickeln und weiß auch nicht, was er mit ihr reden soll. Ferrer fragt sich, was Hélène eigentlich will, aber er wagt nicht, sie danach zu fragen. Schließlich berichtet er ihr von seinem Problem.
Währenddessen reist Baumgartner kreuz und quer durch Südwestfrankreich. Anfangs hatte er sich die Tageszeitungen besorgt, aber von einem Antiquitätendiebstahl stand nichts darin. In einer verregneten Nacht nimmt er eine durchnässte Anhalterin mit, eine junge Frau, die sich gleich nach dem Einsteigen zur Tür dreht und schläft. Er kennt sie, stellt er erschrocken fest. Als er sie in Toulouse am Bahnhof absetzt, lässt er die Innenbeleuchtung des Wagens aus und hofft, dass sie ihn nicht erkannt hat. Zwei Wochen später, Mitte September, merkt er, dass er von einem Motorradfahrer in roter Kluft verfolgt wird. Daraufhin setzt er sich nach Spanien ab. Drei Kilometer hinter der Grenze wird er von spanischen Zöllnern kontrolliert, aber sie finden nichts Ungewöhnliches und lassen ihn weiterfahren. Baumgartner ahnt nicht, dass sie mit Kommissar Paul Supin in Paris in Verbindung stehen, der den Einbruchsdiebstahl in Ferrers Galerie bearbeitet.
Wenn Sie noch nicht erfahren möchten, wie es weitergeht,
überspringen Sie bitte vorerst den Rest der Inhaltsangabe.
Nach seiner Ehescheidung am 10. Oktober erhält Ferrer einen Anruf von Kommissar Supin: Die Spur führt nach San Sebastian. Unverzüglich fährt Ferrer hin. Nach einer Woche erscheint ihm das Vorhaben, einen Unbekannten in einer unbekannten Stadt zu suchen, zwecklos. Wegen eines lärmenden Karzinologen-Kongresses wechselt er das Hotel – und an der Bar des „Hôtel de Londres et d’Angleterre“, in dem er jetzt wohnt, entdeckt er Delahaye! Ferrer spricht ihn an. Delahaye nennt sich jetzt Baumgartner und besitzt gefälschte Papiere auf diesen Namen. Ferrer macht seinem ehemaligen Assistenten klar, dass er ihn ermorden könnte und niemand nach ihm suchen würde, denn man hält Delahaye ja bereits für tot. Aber Ferrer weiß nicht, wie man jemanden umbringt und verhandelt lieber mit Delahaye, der ihm schließlich gegen eine „Entschädigung“ verrät, wo die Sachen versteckt sind.
Ohne Eile kehrt Ferrer nach Paris zurück, holt die Kisten mit den arktischen Kunstgegenständen aus dem Lager in Charenton, versichert sie und deponiert sie in einem Banktresor.
Hélène, der er inzwischen Wohnungsschlüssel überlassen hat, verbringt immer mehr Zeit in der Rue d’Amsterdam, ersetzt Elisabeth in der Galerie und arbeitet sich ein. Im Dezember mietet Ferrer ein Penthouse, und sie bereiten den Umzug vor. Am Silvesterabend sind sie bei Ferrers Geschäftspartner Réparaz eingeladen, aber Hélène zieht es vor, zu Martinovs Silvesterparty zu gehen und schlägt Ferrer vor, dass er allein zu Réparaz gehen soll.
Sie erklärte sanft, dass sie nachgedacht hatte. Dass diese neue Wohnung. All diese Möbel. Die Aussicht, zusammen zu leben mit dem ganzen Himmel über dem Kopf, nein, sie wusste nicht mehr so recht. Sie war nicht ganz sicher, ob sie dazu schon bereit war, sie musste noch nachdenken, sie sollten später noch mal drüber reden. Ich meine nicht, dass wir das alles lassen sollen, verstehst du, ich meine nur, ich will noch mal nachdenken. (Seite 184)
Nachdem Hélène gegangen ist, hat Ferrer auch keine Lust mehr, Réparaz‘ Einladung zu folgen. Stattdessen fährt er nach Issy und geht zu dem Einfamilienhaus, in dem er mit Suzanne wohnte. An der Tür steht weder sein noch Suzannes Name. Die Fenster sind hell erleuchtet. Offenbar findet im Inneren eine Silvesterparty statt. Zufällig kommt eine junge Frau heraus, die ein wenig Luft schnappen möchte. Eine Suzanne kennt hier niemand. Ob er ein Freund von Georges sei, fragt sie. Der sei hier kürzlich eingezogen. Sie lädt Ferrer ein, ihr ins Innere zu folgen.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Gut, sagte Ferrer, aber ich bleibe nur ganz kurz, wirklich. In trinke schnell ein Glas und gehe. (Seite 187)
Die Handlung des Romans „Ich gehe jetzt“ ist bewusst trivial und ergibt auch keinen Sinn. Der Protagonist ist ein Pariser Kunsthändler, der zu keiner Bindung fähig ist. Es geht um Geld, aufregende Frauen, eine Expedition in die Arktis, einen Kunstdiebstahl und einen Mord. Jean Echenoz vermittelt aber keine Botschaft, keinen moralischen Impetus, sondern er spielt mit dem Leser, dessen Erwartungen er immer wieder ins Leere laufen lässt, aber so, dass dieser sich nicht darüber ärgert, sondern großes Vergnügen dabei empfindet.
Das ironisch verspielte Buch ist im Plauderton geschrieben und ganz leicht zu lesen. Wie Nicholson Baker in „Eine Schachtel Streichhölzer“ schwelgt Jean Echenoz auf amüsante Weise in Belanglosigkeiten. Mit detailverliebten Beschreibungen kontrastieren lakonische Darstellungen aufregender Erlebnisse, etwa wenn die Expedition in die Arktis – unverkennbar eine Persiflage auf Peter Høegs Roman „Fräulein Smillas Gespür für Schnee“ – mit ein paar Sätzen abgetan wird, während der Eisbrecher genau beschrieben wird.
Weil Jean Echenoz ohnehin nicht vorhat, eine psychologische Entwicklung nachvollziehbar zu machen, kann er gut auf innere Monologe der Figuren verzichten und sich auf Beobachtbares beschränken:
Er geht schnurstracks zum Telefon, lässt das Gepäck unterwegs fallen, nimmt ab und wählt. Offenbar ist besetzt, denn Baumgartner zieht eine Grimasse, hängt wieder ein, zieht seine Jacke aus und umkreist den Koffer, ohne auszupacken. (Seite 128)
Von besonderem Reiz sind die Passagen, die wie Filmszenen wirken, zum Beispiel Telefongespräche, bei denen wir nur die Person im Bild, aber nicht den Gesprächspartner hören.
Woher soll ich das denn wissen, schreit Baumgartner auf einmal, mach ihn an oder sonst was. Ach was, natürlich weißt du wie, lächelt er und massiert sich die Nasenflügel. Nein, ich glaube, ich mache mich besser ein bisschen aus dem Staub, sonst laufe ich am Ende noch wem über den Weg. Ich behalte das Apartment, aber ich fahre für ein paar Tage aufs Land. Natürlich melde ich mich. Nein, ich fahre heute Abend, ich fahre ganz gern nachts. Natürlich. Natürlich nicht. Ja, ich küsse dich auch. (Seite 77)
Dazu kommen Schnitte wie im Kino, beispielsweise bei der Fortsetzung des Zitats:
Er schaltet ab, schaltet wieder an und wählt die nur ihm bekannte Nummer des Apparats, den er dem Heilbutt gegeben hat. Es läutet ziemlich lange, bis abgenommen wird. [Schnitt] Hallo, ja, sagt der Heilbutt, ich höre, ach ja, guten Tag, Monsieur. (Seite 77)
Hin und wieder meldet sich auch ein anonymer Kommentator zu Wort:
Weniger aus der Puste, als ich gedacht hätte, gelangte er in den sechsten Stock. (Seite 6)
Aber kann er [Ferrer] sie nicht wenigstens […] zum Essen einladen, ich weiß ja nicht, aber ich denke, so gehört sich das. (Seite 133)
Also mir persönlich geht dieser Baumgartner so langsam auf die Nerven. Sein Alltag ist belanglos. Er wohnt im Hotel, telefoniert jeden zweiten Tag und besichtigt alles, was sich nicht wehrt, aber sonst ist nichts los. Da fehlt der Schwung. (Seite 141)
Nun begleiten wir ihn schon seit fast einem Jahr und haben uns trotzdem noch nie die Zeit genommen, Ferrers Äußeres zu beschreiben. (Seite 173)
Der anonyme Erzähler spricht auch die Leser direkt an:
Wenden wir uns, Ihr Einverständnis vorausgesetzt, vorübergehend anderen Horizonten zu. (Seite 63)
Anfangs springt Jean Echenoz kapitelweise zwischen Ferrers Expedition in die Arktis und der Vorgeschichte dazu hin und her, dann zwischen den beiden Handlungssträngen, die sich aus Ferrers und Baumgartners unterschiedlichen Blickwinkeln ergeben. Außerdem wechselt er immer wieder zwischen Präsens und Imperfekt, mitunter sogar im selben Satz. Zu diesen vermeintlichen Grammatikfehlern passt auch, dass Echenoz unversehens Ausdrücke aus einer anderen Sprachschicht einstreut: Da futtert jemand im Stehen (Seite 157) oder gerät aus der Puste (Seite 6). Diese mutwilligen Stilbrüche sind wiederum verwandt mit sprachspielerischen Entgleisungen unbegabter Autoren, die Jean Echenoz und sein Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel spaßeshalber nachahmen:
[…] der […] seinen Abschied nahm und dann, in der Kajüte, seine Koffer. (Seite 37)
In Port Radium war die Sonne ebenso wenig untergegangen wie er [Ferrer] ins Bett. (Seite 69)
[…] eine Terrasse in einer schmalen, hohlen Einfriedung voller Erde, in der ohne rechte Überzeugung ein paar Kräuter sprießen, Un- und andere, darunter ein Löwenzahn. (Seite 76)
In „Das literarische Quartett“ wurde Jean Echenoz‘ Roman „Ich gehe jetzt“ ebenso wie von vielen anderen deutschen Literaturkritikern verrissen, aber in Frankreich mit dem Prix Goncourt, dem wichtigsten Literaturpreis des Landes, ausgezeichnet. Vielleicht verfügen die Franzosen über bessere Antennen für die Ironie und das unbeschwert Spielerische in „Ich gehe jetzt“.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2005
Textauszüge: © Berlin Verlag