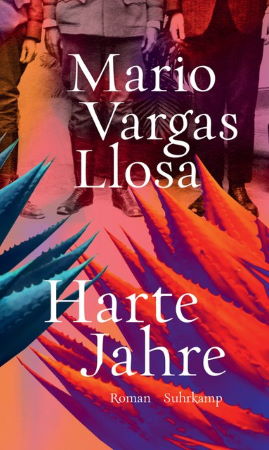Christoph Ransmayr : Morbus Kitahara

Inhaltsangabe
Kritik
Kurz bevor der Weltkrieg wenigstens in Europa durch den Frieden von Oranienburg beendet wird, greift eine Bomberflotte den Kurort Moor an. Die Frau des Schmieds Bering, die mit einem Sack schwarz geschlachteten Pferdefleisches unterwegs ist, rettet sich in einen Keller und gebiert zwischen herumliegenden Fässern mit Hilfe der polnischen Zwangsarbeiterin Celina Kobro um mehrere Wochen zu früh ihren zweiten Sohn.
Das Kind wird in zerschnittene Fahnen gewickelt und in einen Wäschekorb gelegt, der an einem Deckenbalken in dem Kellerraum hängt. Sooft die Mutter den Säugling herausnimmt und er festen Boden unter sich spürt, schreit er, und seltsamerweise ahmt er die Laute der drei aus dem brennenden Stall der Schmiede geretteten Legehennen nach. Er scheint über ein außergewöhnlich feines Gehör zu verfügen.
Nach dem Krieg kommen zuerst sibirische, dann marokkanische, schottische und schließlich amerikanische Besatzungssoldaten in das Gebiet von Moor zwischen dem See und dem Gebirge, das die Bewohner das Steinerne Meer nennen. Major Elliot aus Oklahoma führt die im Friedensplan des Richters und Gelehrten Lyndon Porter Stellamour vorgesehenen Demontagen durch.
„Zurück! Zurück mit euch! Zurück in die Steinzeit!“
Die Menschen sollen als Hirten und Bauern arbeiten und sich in einer Art vorindustrieller Gesellschaft selbst ernähren. Die Besatzer bauen Fabriken und Kraftwerke ab und reißen die Schienen der Bahnlinie heraus. Wer in Moor nicht über einen eigenen Dieselgenerator verfügt, hat keinen elektrischen Strom mehr. In den Steinbruch lässt Elliot mannshohe Granitbuchstaben hauen. „Hier liegen elftausendneunhundertdreiundsiebzig Tote, erschlagen von den Eingeborenen dieses Landes. Willkommen in Moor“, steht da weithin sichtbar. Viermal im Jahr veranstaltet Elliot im Steinbruch „Stellamour’s Party“. Da müssen sich die Bewohner von Moor wie Zwangsarbeiter kleiden und vor einer Kamera Szenen aus der Zeit der Unterdrückung durch die besiegten Machthaber nachspielen. „Niemals vergessen!“, mahnen Transparente, und regelmäßig werden Dokumentarfilme über die Qualen der Zwangsarbeiter und die Leichenstapel vor den Krematorien vorgeführt.
Im zweiten Friedensjahr kehrt der Schmied Bering von der Front in Afrika und aus der Kriegsgefangenschaft zurück.
Als sein zweiter Sohn zwölf Jahre alt ist, ertrinkt dessen jüngerer Bruder im See, und sieben Jahre später wandert sein ältester Sohn nach Amerika aus.
Moor wird von Banden heimgesucht, die Schutzgelder („Feuergroschen“) erpressen und Brände legen, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Als der junge Bering dreiundzwanzig ist, schlägt eine Horde von sechs oder sieben kahlköpfigen Schlägern mit Stahlrohren und Fahrradketten auf ihn ein und verfolgt ihn. Bering flieht in die Schmiede, holt die versteckte Armeepistole seines Vaters hervor und erschießt den nächsten Angreifer. Die anderen rennen weg.
Während der Vater säuft und nur noch in der Erinnerung an den Wüstenkrieg in Libyen lebt, kümmert sich die Mutter nicht mehr um irdische Angelegenheiten, sondern betet unaufhörlich zu Maria, von der sie glaubt, dass sie ihr erschienen sei. Der junge Bering aber schleppt jeden Schrott, den er kriegen kann, auf den Schmiedhügel.
Eines Tages sieht er, wie Ambras, der Verwalter des Steinbruchs, den Studebaker, den ihm der inzwischen in die USA zurückgekehrte Major Elliott hinterlassen hat, kaputtfährt. Er hilft ihm, den demolierten amerikanischen Straßenkreuzer mit einem Ochsengespann in die Schmiede zu ziehen und repariert den Schaden. Da er keine passenden Ersatzteile findet, schmiedet er welche zurecht, die dem Auto am Ende das Aussehen eines Vogels – einer Krähe – verleihen.
Ambras war früher Fotograf. Er verliebte er sich in eine junge Frau, die er im Auftrag einer Textilfabrik in verschiedenen Kleidern fotografierte. Eines Morgens kamen die Schergen des Regimes, fanden das Paar nackt im Bett, schlugen mit Knüppeln zu und schrien: „Du Arschloch fickst mit einer Judensau!“ Das Mädchen durfte eines der herumliegenden Kleider anziehen, aber keine Schuhe: „Judenhuren gehen barfuß“, hieß es. Ambras hörte nie wieder etwas von ihr. Er wurde in ein Lager gesperrt und zur Zwangsarbeit im Steinbruch von Moor geprügelt.
Wenn in dem Lager jemand versucht hatte, einem anderen Gefangenen Brot zu stehlen, wurde er so zusammengeschlagen, dass er beim nächsten Zählappell nicht mehr antreten konnte.
Erst dann kam die Wache. Ich habe gesehen, wie die Wache kam, mein Lieber. Ich habe gesehen, wie die Wache einen Geprügelten an den Füßen auf den Appellplatz schleifte. Wir standen dort im Schnee. Wir standen dort in einer langen Reihe stramm im Schnee, und der Brotdieb musste an unserer Reihe entlang zum Krematorium kriechen. Sie brachten ihn dazu, dass er kroch, dass er zu unseren Füßen durch den Schnee kroch, als ob er sich zum Krematorium retten wollte.
Ambras wurden die Hände auf den Rücken gebunden. An der Fessel hängten ihn die Peiniger auf und schaukelten ihn hin und her:
Dein eigenes Körpergewicht zieht dir die gefesselten Arme hoch und immer höher, bis du mit deiner Kraft am Ende bist und dir dein furchtbares Gewicht die Arme von hinten über den Kopf reißt und die Kugeln aus den Pfannen deiner Schultergelenke springen. Das macht ein Geräusch, das du, wenn überhaupt, nur aus der Metzgerei kennst …
Neun Jahre nach der Befreiung kehrte Ambras nach Moor zurück und wurde von Major Elliott als Verwalter des wieder eröffneten Granitbruchs eingesetzt. Er zog in die Villa Flora, ein Landhaus auf einer Anhöhe, das Goldfarb gehört hatte, dem Besitzer des Hotels Bellevue und des angeschlossenen Kurbads. Goldfarb, seine Frau und seine gehörlose Tochter waren von Beamten der geheimen Staatspolizei abgeholt worden und tauchten nie wieder auf. Den Park der leeren Villa beherrschte ein Rudel wilder Hunde, und niemand wagte sich dorthin – bis auf Ambras, der zwei Hunde, die ihn anfielen, tötete und sich auf diese Weise unter den übrigen Tieren Respekt verschaffte. Deshalb nennen die Leute den von der Besatzungsmacht geschützten – und deshalb verhassten – Steinbruchverwalter „Hundekönig“.
Bering war zufällig in der Nähe, als Ambras die Hunde bezwang. Nach der erfolgreichen Reparatur des Studebakers verlässt er die Schmiede seines Vaters und zieht in die Villa Flora. Der Hundekönig vertraut ihm die Militärpistole an, die er von Elliott bekam, und macht ihn damit zum Leibwächter.
Hin und wieder taucht Lily in der Villa Flora auf. Man nennt sie die „Brasilianerin“. Sie kam in Berings Geburtsjahr als fünfjähriges Mädchen mit ihrer Familie in einem Flüchtlingstreck von Wien nach Moor. Ehemalige Zwangsarbeiter erkannten ihren Vater als einen derjenigen, die in schwarzen Uniformen an den Bahnsteigen und in den Lagern standen. Sie schlugen ihn zusammen und warfen ihn vom Yachtsteg, weil aber der See zugefroren war, zerrten sie ihn danach zum Sprungturm des Kurbads und hängten ihn dort an den Füßen auf. Seine Frau kam ihm letzten Augenblick dazu und musste mit ansehen, wie Soldaten der Besatzungsmacht den Verletzten abschnitten und fortbrachten. 19 Jahre später, als Lily auch ihre Mutter verloren hatte, zog sie allein in den Wetterturm des durch einen Brand zerstörten Strandbads. Jetzt wandert sie als Schmugglerin mit ihrem Maultier regelmäßig über einsame Bergpfade ins Tiefland auf der anderen Seite und wieder zurück. Ab und zu, wenn sie in der Ferne Veteranen entdeckt, die seit Jahrzehnten vor den Militärgerichten der Sieger flüchten oder „die nachgeborene Brut aus den Ruinenstädten“, legt sie wie eine Jägerin das Scharfschützengewehr an, das sie in einem Armeedepot gefunden hat, und erschießt einen von ihnen.
Während eines Rockkonzerts geraten Lily und Bering in einen Begeisterungstaumel und küssen sich. Danach vermissen sie den Hundekönig. Bering findet ihn schließlich. Er wird von Schlägern mit kahlgeschorenen Köpfen bedroht, die sofort von ihm ablassen, als Bering seine Pistole zieht. Auf der Rückfahrt in der „Krähe“ bremst Bering abrupt, um nicht in eine Grube zu fahren. Aber der Schatten bewegt sich mit seinem Blick. Er schweigt, damit der Hundekönig nicht merkt, dass etwas mit seinen Augen nicht in Ordnung ist.
Ein Sprengstoffdepot aus dem Krieg wird gefunden und soll gesprengt werden. Tagelang warnen Lautsprecherdurchsagen die Bewohner von Moor und fordern sie auf. Sie sollen die Fenster offen lassen, damit die Druckwelle nicht die Scheiben zerstört. Zur vorgesehenen Zeit nähert sich eine Büßerprozession aus einem Nachbarort, wo man offenbar nichts von der geplanten Sprengung erfahren hat. Bering läuft der Gruppe nach, die geradewegs durch den Schnee in die gesperrte Sprengzone marschiert. Im letzten Augenblick kann er die Menschen warnen und sich mit ihnen zusammen auf den Boden werfen.
Lily, die Bering gegenüber seit dem Kuss während des Konzerts wieder auf Distanz achtet, findet im Gebirge seinen völlig verstörten Vater. Er glaubt, im Wüstenkrieg zu sein. Mit Hilfe seines Sohnes bringt sie ihn nach Tiefland, in das große Lazarett der Stadt Brand. Als sie unterwegs in einem Dolinenfeld zwei Hühnerdieben begegnen, die sich die gefesselten lebenden Tiere wie eine Stola umgebunden haben, damit das Fleisch frisch bleibt, entreißt Bering Lily das Gewehr und erschießt einen von ihnen.
Aus Lilys Kofferradio erfahren sie, dass die Amerikaner über der japanischen Stadt Nagoya eine Atombombe gezündet haben und der Weltkrieg jetzt auch in Asien zu Ende ist.
Weil Bering Lily verraten hat, dass er befürchtet, blind zu werden, bringt sie ihn im Lazarett zu dem Sanitäter Morrison, der seine Augen untersucht und feststellt, dass er an einer von dem japanischen Arzt Kitahara beschriebenen Krankheit leidet: Morbus Kitahara. Es handelt sich um blinde Flecken in der Form eines Atompilzes. Aber er beruhigt Bering und versichert ihm, dass die Sehstörungen wieder vergehen werden.
Als sich der weitere Abbau des Steinbruchs nicht mehr lohnt, beschließt die Besatzungsmacht, einen Schießplatz daraus zu machen und am See ein Truppenübungsgelände anzulegen. Innerhalb eines Monats muss Moor geräumt werden. Die technischen Anlagen aus dem Steinbruch transportiert man nach Brasilien. An einem brasilianischen Küstenabschnitt liegt der einzige Steinbruch der Welt, an dem es ähnlich grünen Granit gibt wie es in Moor der Fall war.
Ambras, Lily und Bering reisen mit der Bahn nach Hamburg und schiffen sich dort nach Rio de Janeiro ein, wo sie von einer Frau namens Muyra im Auftrag ihres verhinderten Chefs, Senhor Plínio de Nacar, empfangen werden. Der Brasilianer kämpfte an der Seite der Amerikaner gegen die europäischen Barbaren, dann besiegte er die Wildnis in der Bucht von Pantano: Mit einer Armee von Landarbeitern rodete er das Gebiet, pflanzte Maniok, Kaffee, Bananen und erschloss Steinbrüche.
Als sie über der Ilha do Cão (Hundsinsel) Rauch aufsteigen sehen, setzt Muyra mit den drei Europäern zu der ehemaligen Gefangeneninsel über. Dort geht Lily an Bord eines Fischerboots, das sie nach Santos bringen wird. Zum Abschied schenkt sie Muyra ihren Militärmantel. Muyra kauft den Fischern zwei Fische ab. Während sich das Fischerboot entfernt, kniet sie sich an den Strand, um sie auszunehmen und abzuschuppen. Plötzlich trifft sie ein krachender Schlag in den Rücken. Sie bricht tot zusammen.
Bering hat nicht mitbekommen, dass Muyra Lilys Militärmantel angezogen hat.
An die Bordwand des Beiboots gelehnt, sitzt Bering im Sand und wartet auf Muyra. Das Gewehr hier, ist es leichter oder schwerer als jenes, das Lily in die Doline geworfen hat? Er wiegt den Karabiner in seinen Händen, schätzt die Entfernung zu der kauernden Gestalt. Fünfzig Meter? Das sind keine fünfzig Meter. Nicht, dass er auf die getarnte Gestalt zielt. Er schätzt nur die Entfernung im Visier. Sieht die Tarnflecken auf der Pelerine über der Kimme tanzen. Flecken. Wo Lily ist, sind immer Flecken. Tarnflecken, blinde Flecken, immer ist da etwas, das ihn an Moor und an das erinnert, was er überstanden hat. Fünfzig Meter. Er könnte niemals auf einen Menschen schießen, der so wehrlos ist. Doch. Dort oben, im Dolinenfeld, dort war es ganz leicht. Und auch dort war sie und hat ihn an den Haaren hochgezerrt. Nein, er zielt nicht auf Lily. Er betrachtet nur diese verfluchten Flecken im Visier. Und dass der Karabiner in seinen Händen plötzlich hochschlägt, ja, richtig nach ihm schlägt … und dass dieses Krachen, das ihn schon einmal und wieder und wieder taub gemacht hat, aus den Ruinen und von der Felswand zurückhallt … das alles gehört nicht zu ihm. Das hat mit ihm nichts zu tun. Er hat nicht abgedrückt. Das Gewehr hat nach ihm geschlagen und ihn an der Stirn verletzt. Er muss die Waffe nicht einmal fallen lassen. Sie springt ihm aus den Händen. Er hat nichts getan.
Bering kann Muyra nirgendwo finden. Sie muss wohl durch die Felswand geklettert sein. Keuchend steigt er hinauf. Ambras steht im Weg, starrt vor sich hin und scheint nichts zu hören. Bering nimmt das Kletterseil, bindet sich ein Ende um die Hüften und drückt Ambras das andere in die Hand, bevor er weiterklettert. Auf halbem Weg bis zum nächsten sicheren Stand reißt ihn das Seil in die Tiefe.
Die Rauchfahne. Jetzt endlich sieht Ambras das Feuer, das so lange im Verborgenen gebrannt hat. Er hat sich nach einem Verfolger umgewandt, der ihm auf dem steilen Weg zur Wallkrone nachkommt: Ach, es ist nur einer von denen, die im Steinbruch mit Stahlruten zuschlagen. Der macht ihm keine Angst mehr. Aber im Abgrund, der hinter seinem Verfolger klafft, in der Tiefe, schon ganz unbedeutend und grau, sieht er das Lager – und zwischen den Baracken das Feuer. Langsam und unbeirrbar kriecht es auf den Appellplatz zu. So lange hat es im Verborgenen gebrannt, in den Öfen hinter dem Krankenrevier. Jetzt ist es frei. Sein Verfolger kann das Feuer nicht sehen. Der sieht nur ihn. Der schreit ihn an. Der hat einen Strick. Will er ihn zurückholen ins Lager? Will er ihn mit diesem Strick noch einmal fesseln und hochziehen, damit alle ihn noch einmal pendeln sehen?
Und dann hat ihn der Verfolger erreicht. Seltsam, der schlägt nicht zu. Der schießt nicht. Der fesselt ihn nicht. Der drängt sich so nahe an ihn heran, dass er den fremden Atem auf seinem Gesicht spürt, und schenkt ihm den Strick. Dann geht er weiter, geht einfach an ihm vorbei. Lässt ihn zurück. Lässt ihm seinen Willen, das Leben.
Und Ambras steht endlich am Zaun, am Stacheldraht, vor dem weißen Porzellan der Starkstromisolatoren. Und doch spürt er nach dem einen Schritt, den er jetzt tut, keinen Schlag, keinen Schmerz. Auch der Funkenregen bleibt aus. Er tritt einfach ins Leere.
Später werden auf der Insel im Schatten eines Felsüberhangs zwei verkohlte Männerleichen gefunden, und am Strand entdeckt man den von Vögel zerhackten Leichnam einer Frau.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
In dem Roman „Morbus Kitahara“ entwirft Christoph Ransmayr das trostlose Szenario einer nicht vom Marshall- sondern vom Morgenthau-Plan bestimmten Nachkriegszeit. Was wäre gewesen, wenn die westlichen Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa nicht Wiederaufbau und Demokratisierung gefördert, sondern ein repressives Besatzungsregime errichtet hätten?
Der Roman ist voller Symbolik: die fortschreitende Blindheit Berings, die Freiheit der Vögel, die Erdgebundenheit und Dressierbarkeit der Hunde … „Morbus Kitahara“ – insbesondere der in „Brasilien“ spielende Schluss – eignet sich kaum für eine intellektuelle Analyse und entzieht sich einem verstandesmäßigen Begreifen, denn die Wirkung des Romans beruht auf unbewussten Assoziationen.
Das düster-bizarre Szenario erinnert an Ernst Jüngers Roman „Auf den Marmorklippen“ (1939) über die Schreckensherrschaft eines Oberförsters, die wohl nicht zufällig Parallelen mit dem NS-Regime aufweist.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2002
Textauszüge: © S. Fischer Verlag
Christoph Ransmayr: Die Schrecken des Eises und der Finsternis
Christoph Ransmayr: Cox oder Der Lauf der Dinge