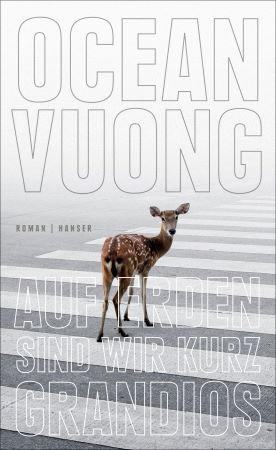Andreas Maier : Wäldchestag
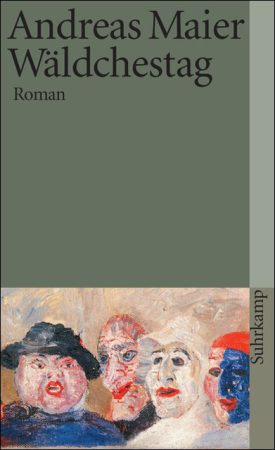
Inhaltsangabe
Kritik
Freitag vor Pfingsten
Am Freitag vor Pfingsten fand Else Strobel, die Haushälterin des 71-jährigen Sebastian Adomeit, ihren Arbeitgeber zwischen Stube und Diele tot am Boden liegend, mit einem zerbrochenen Wasserglas neben sich. Am Montag hatte er Notar Weihnöter ein zugeklebtes DIN-A-5-Kuvert übergeben („Im Falle meines Ablebens“) und ihn beauftragt, den Inhalt am zweiten Tag nach seiner Beerdigung um 7 Uhr morgens in seiner Kanzlei bekannt zu geben. Von Pfarrer Becker hatte er am Donnerstag verlangt, seine Beerdigung am Pfingstsonntag um 11.30 Uhr vorzunehmen – wenn die Trauergäste „eigentlich überaus gern daran gehen würden, ihre wohlverdienten Festtagsspargeln zu essen“. Weder der Notar noch der Pfarrer hatten geglaubt, dass Sebastian Adomeit tatsächlich sterben würde. Und dann geschah es doch: Er verschied in seinem Geburtshaus in (Nieder-)Florstadt, Untere Kirchgasse 14, gerade einmal fünf Meter vom Ort seiner Geburt entfernt.
Pfingstsonntag
Am Pfingstsonntag trifft die Verwandtschaft in der Kleinstadt in der Wetterau ein.
Jeannette Adomeit, die neun Jahre jüngere Schwester des Verstorbenen, reist aus Bensheim an, wo sie seit 20 Jahren mit ihrem Sohn wohnt. Man glaubt zu wissen, dass ihr Bruder sie in den Fünfzigerjahren wegen des unehelichen Kindes aus dem Haus geworfen habe. Sie ging damals nach England und heiratete dort, ist aber seit 20 Jahren geschieden. Ihr Mann soll ein Verhältnis mit seiner Sekretärin gehabt haben. Ihren Bruder durfte sie nie mehr besuchen.
Sie kommt mit dem Ehepaar Mohr. Harald Mohr, der Mann von Sebastian Adomeits Nichte Erika, hat eigens nicht seinen Pkw genommen, sondern sich einen Lieferwagen der Bensheimer Mineralwasserfirma geliehen, um das erwartete Erbe transportieren zu können. Tante Lenchen saß mit ihm Führerhaus.
Und sie, das Tante Lenchen, habe das Tante Lenchen gesagt, werde sowieso nur mitgenommen, um diesem Beutezug den Anstrich einer Trauerfahrt zu geben.
Die in Würzburg studierende Tochter Katja Mohr nahm den Zug.
Karl Munk ärgert sich, weil seine Frau am Samstagabend eine Rehkeule auftaute: „Sollen wir die Rehkeule jetzt also wegwerfen? Das würde dem alten Adomeit so passen.“
Der 30-jährige Heimatforscher Schossau – der hin und wieder in schizophrener Weise mit sich selbst spricht – erzählt, was die Leute so reden über das, was sie von anderen gehört haben wollen. (Aber irgendwann verselbständigen sich die Stimmen.) Sebastian Adomeit war ein Eigenbrötler, über den offenbar kaum jemand etwas Näheres wusste. Er soll Bücher über Vogelkunde geschrieben, Nachhilfestunden in Latein gegeben und zeitweilig in einer Bibliothek in Frankfurt gearbeitet haben. Angeblich war er nicht einmal krankenversichert! Schossau kannte Adomeit vielleicht noch am besten. Er weiß, dass die Schwiegertochter des Alten eigens aus Butzbach kam, um ihm Suppe zu bringen, obwohl er bis zum Schluss am Herd stehen und sich eine Bratwurst oder einen Leberkäse mit Zwiebeln zubereiten konnte und diese Speisen auch noch einigermaßen vertrug. Aber mit ihrer Suppe wollte sie ihn wohl „zu einem ganz normalen Greis mit einer ganz normalen Bedürftigkeit“ machen, ihm die Normalität aufzwingen.
Schossau erzählt, wie ihn der Pfarrer dem Stadtverordneten Rudolf vorstellte:
Herr Schossau sei Heimatforscher. Aha, habe Rudolf gesagt, sehr interessant. Was sei denn das, ein Heimatforscher? Schossau: Er sei eigentlich Historiker. Er arbeite für die Wetterauer Geschichtsblätter. Rudolf: Jaja, in der Tat, die Geschichte. Geschichte müsse täglich gemacht werden. Dann kommen andere und schreiben sie nieder. Was machen Sie denn dann so, wenn Sie für die Geschichtsblätter arbeiten? Sie sitzen in Archiven, vermute ich? Oder graben Sie auch? Nein, habe Schossau gesagt (er habe überlegt, ob er dieses Gespräch tatsächlich führen soll), er grabe nicht. Im Augenblick forsche er für einen Beitrag zur Reihe Napoleonische Truppen in der Wetterau, diese Reihe erscheine in den Wetterauer Geschichtsblättern. Rudolf: Aha, und wer zahlt das? Er meine, das sei doch eine Arbeit, die, er möge ihn recht verstehen, also zumindest nur eine sehr geringe Minderheit interessieren dürfte, obgleich es an sich ja hochinteressant sei, Napoleonische Truppen in der Wetterau, so, seien die also bis in die Wetterau gekommen. … Und da werde diese Schriftenreihe wahrscheinlich aus den Mitteln des Kreises finanziert? Schossau: Zum einen aus diesen, zum anderen auch vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung. Rudolf: Das ist ja sehr interessant. Sie sehen, es ist schlichtweg übertrieben, wenn hier jemand behaupten wolle, wir lebten nicht im totalen Wohlstand.
Über die Wetterauer im Allgemeinen sagt Schossau:
Aber der Wetterauer brauche Beschäftigung und denke daher, er brauche neue Butzenscheiben. … Alle zehn Jahre sei die gelobte neue Küche plötzlich zu einer alten, deren man sich schäme, geworden, also werde der Sperrmüll bestellt, werde ein Küchengeschäft aufgesucht, werde dort eine Beratung eingeholt, anschließend werde die Küche installiert, anschließend wird dasselbe gekocht in ihr wie in der vorherigen. Leberknödel, Schnitzel.
Dieses Bedürfnis nach Veränderungen in der Wohnung soll auch Sebastian Adomeit amüsiert haben:
Pass auf, Schossau, habe er gesagt, in der Kirchgasse zwanzig war es nun schon ein halbes Jahr ruhig, die Kirchgasse zwanzig ist überfällig, sie ist so reif wie ein Apfel im Herbst, ich sehe dem Herrn Geibel schon richtiggehend an, wie sich alles in ihm danach drängt, etwas auszuhecken, ich tippe auf die Sanierung der Nasszellen. Tatsächlich seien zwei Wochen später die Spenglerei Klump aus Friedberg und der Malermeister Olschewski aus Schwalheim gekommen und hätten die Nasszellen saniert. Aber Herr Geibel, habe Adomeit den Mann auf der Straße angesprochen, das ist ja interessant, Sie sanieren Ihre Nasszellen! Ja, habe Geibel gesagt, in der Tat, das sei dringend notwendig gewesen, er habe sich schon die ganze Zeit mit diesem Entschluss getragen, seine Nasszellen zu sanieren, er habe nur die ganze Zeit nicht gewusst, durch wen. Wenn er, Adomeit, wüsste, was das für eine Arbeit sei, Kostenvoranschläge einholen, Angebote durchrechnen, sich auf die richtige Weise beraten lassen. Jetzt kommen endlich die rosa Kacheln aus dem Badezimmer heraus, habe Geibel gesagt, ich kann gar nicht verstehen, wie ich vor fünfzehn Jahren diese Kacheln dort habe hineinmachen lassen können. Rosa, wie unzeitgemäß. Er hätte schon damals weiße hineinmachen sollen. Er wolle ein helles Bad haben, seine Frau übrigens sei die treibende Kraft gewesen. Das Zeug sei ja schließlich auch so lange benutzt, habe Geibel gesagt, währenddessen die Arbeiter der Firma Klump eine Badewanne an den beiden Unterrednern vorbeigetragen hätten. Das dort sei die neue Wanne, habe Adomeit gefragt. Ja, habe Geibel gesagt, das sei die neue Wanne. Das ist aber eine schöne Wanne, eine große Wanne, habe Adomeit gesagt, Geibel habe ihm zugestimmt, seine Frau, die doch etwas füllig sei, habe sich eine große Wanne gewünscht.
Bei einem Spaziergang im Fichtenwald beobachtet Schossau einen jungen Mann – später stellt sich heraus, dass es sich um Katja Mohrs festen Freund Benno Götz handelt –, der unter der Galgeneiche eine in ein Tuch eingeschlagene Pistole vergräbt.
Anton Wiesner geht mit der 19-jährigen Ute Berthold. Die ist nicht davon begeistert, dass er mit seinem Freund Kurt Bucerius in einer Scheune auf einem Bauernhof einen VW-Bus zusammenbastelt, weil Anton und Kurt davon träumen, damit eine Weltreise zu machen – bei der sie nicht mitkommen dürfte. Kurt Bucerius, der mit Elke befreundet ist, hält nichts davon, Frauen mitzunehmen: „Stelle dir mal vor, mit der Ute durch den Iran. Nein, unmöglich.“
Schlimmer noch findet Ute, dass Anton mit der jungen Türkin Günes flirtete und jetzt offenbar nur noch Augen für Katja Mohr hat.
Am Abend des Pfingstsonntags treffen sich die Trauergäste bei einem Büffet vom Italiener. Tante Lenchen, die jedem berichtet, das ihr Mann Heinzgeorg am zweiten Kriegstag, also am 2. September 1939, bei Lubize fiel, erregt sich über das teure Essen aus einem „ausländischen Gasthof“.
Mohr: Ausländischer Gasthof, wie klinge das denn! Sie: Aber es seien doch Ausländer. Dürfe man denn nicht einmal mehr das Wort Ausländer in den Mund nehmen? Das Wort Juden dürfe man ja auch nicht in den Mund nehmen. Die Familie Mohr und Jeannette Adomeit hätten sich bestürzt umgeschaut und sogleich alle Mühe darauf verwendet, das Tante Lenchen zum Schweigen zu bringen. Sie aber habe beharrt: Also dürfe man das Wort Ausländer in den Mund nehmen oder nicht? Das wolle sie jetzt wissen. … Jeannette Adomeit: Nein, sie dürfe das Wort nicht benutzen. Es heiße ausländischer Mitbürger, und nicht Ausländer. … Es sei völlig gleichgültig, wo jemand herkomme. So ein Blödsinn, habe die Tante gesagt. Es sei doch nicht einmal gleichgültig, ob ich von der Weinstraße oder aus der Wetterau komme. Die Adomeit: Ja, aber es änderte doch nichts am Wert der Menschen. Lenchen: Wert, wie komme sie denn auf Wert? Sie habe doch überhaupt nichts von Wert gesagt. Was denn für ein Wert? Sie habe doch nur das Wort Ausländer gesagt. … Sie lasse sich doch nicht für dumm verkaufen. Diese widerwärtige Gleichmacherei!
Wäldchestag
Am Dienstag (am Dienstagnachmittag nach Pfingsten feiert man in Frankfurt und Umgebung den Wäldchestag) um 7 Uhr morgens, finden sich die Verwandten und eine Anzahl Neugieriger aus dem Ort bei Notar Weihnöter ein. (Trotz der frühen Stunde sind einige schon wieder betrunken.) Auch Klaus Adomeit, der Sohn des Verstorbenen, kommt mit seiner Frau. Nur die Haushälterin Else Strobel fehlt. Die Versammelten wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sie in der Nacht einen Schlaganfall erlitten hatte und ins Friedberger Kreiskrankenhaus eingeliefert wurde. Und außerdem: „Was soll sie auch hier?“, fragen die Leute. „Die soll bleiben, wo der Pfeffer wächst.“ Jemand gibt zu bedenken: „Am Ende erbt die was und ist gar nicht hier. Das wär doch kurios.“ Nach vielem Hin und Her greift Notar Weihnöter gegen 8 Uhr endlich nach dem Brieföffner, schlitzt das Kuvert auf und entfaltet den Papierbogen.
Ich vermache im Falle meines Todes das Haus Untere Kirchgasse 15 mitsamt meinem vorhandenen Vermögen meinem Sohn. Ausnahme: Die sich aus dem Vertrag X (hier sei eine bestimmte Notarsrolle genannt worden) ergebenen Zahlungen, die ich noch nicht in Anspruch genommen habe, vermache ich mit allen Zinsen und Zinseszinsen meiner Haushälterin Frau Else Strobel, wohnhaft Fauerbacher Straße zweihundertzwanzig, Niederflorstadt.
Kreidebleich steht Jeannette Adoneit auf. „Das sei infam, habe sie gestammelt, das sei … infam! Das könne er ihr nicht antun.“
Im Zuge einer von der Kriminalpolizei angeordneten Fahndung nach Autoschiebern fährt Wachtmeister Gebhard am Vormittag auch bei der Scheune vorbei, in der Kurt Bucerius und Anton Wiesner ihren VW-Bus zusammenschrauben. Weil er die Liste mit den gesuchten Motorennummern verlegt hat, ohnehin nicht glaubt, dass jemand aus dem Ort in die Gaunereien verwickelt sein könnte und außerdem verärgert darüber ist, ausgerechnet am Wäldchestag herumfahren zu müssen, merkt er nicht, dass es sich bei den beiden in der Werkstatt aufgebockten Automotoren um gestohlene handelt.
Einige der Verwandten schauen bei der Haushälterin Else Strobel im Friedberger Kreiskrankenhaus vorbei. Da steht plötzlich auch Anton Wiesner völlig verschmutzt in der Tür. Er war draußen bei dem kleinen, am Wäldchestag geschlossenen Privatflugplatz und schoss mit der im Fichtenwald ausgegrabenen Pistole das Schloss des Towers auf, um an die Schlüssel zu kommen. Dann drehte er mit einer Cessna eine Runde, und später zerriss er seinen Pilotenschein.
Obwohl sie nichts geerbt haben, packen Jeannette Adomeit, Erika und Harald Mohr den Lieferwagen mit Hausrat aus der Wohnung des Verstorbenen voll, bevor sie mit Tante Lenchen zurück nach Bensheim fahren.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Sätze wie die folgenden würde man in anderen Texten für Stil- bzw. Grammatikfehler halten:
Dass das Dasein sein ideales Abbild in einem Fluss habe …
Schossau habe ihn schon als Kind dort entlanglaufen sehen, damals, als er noch die Vorurteile seiner Umwelt geteilt habe, die ihn in Adomeit haben einen nutzlosen Charakter sehen lassen wollen.
Anschließend habe er die beiseite auf die Couch geworfene Uhr wieder an sich genommen …, um zu sehen, ob die Uhr trotz seinem Wurf noch funktioniere, und habe sie eingesteckt, es habe sich um eine kleine, kaum fastgroße Uhr gehandelt.
280 Seiten mit wenigen Ausnahmen in indirekter Rede. Zwischendurch – und dann auch noch mitten im Satz – wechselt Andreas Maier in die direkte Rede (ohne Anführungszeichen):
Wieser … habe von diesem Augenblick an aber auch eine fast ehrfürchtige Abscheu vor dem Südhessen gehabt und endgültig beschlossen, sich mit dieser Person freundlich zu stellen, da er sich gesagt habe, dieser Südhesse ist dir in jeder Hinsicht überlegen. Und mit einem, der einem überlegen ist, stelle man sich tunlichst nicht schlecht.
Einfache Wörter, machen und haben statt treffsicherer Verben, Grammatikfehler, vermeintliche Stilschwächen – daran muss man sich erst gewöhnen, aber nach ein paar Seiten merkt man, wie geschickt und unterhaltsam Andreas Maier damit dieses unaufhörliche Gebabbel nachahmt. In drei absatzlosen Kapiteln – je eines für Pfingstsonntag, Pfingstmontag und den Wäldchestag – komponiert er eine Suada, in der ein Haufen zum Teil betrunkener Leute übereinander reden und darüber, was sie von anderen über wieder andere gehört haben. Innere Monologe bezieht er mit ein. Gerade die Banalität, die Gewöhnlichkeit der Gespräche ist erschreckend, weil sich dahinter der Wahnsinn des Alltäglichen zeigt.
„Wäldchestag“ ist Milieustudie und Provinzposse zugleich. Anders als Thomas Bernhard in „Holzfällen“ hält Andreas Maier nicht Groß-, sondern Kleinstädtern den Spiegel vor. Wesentliche Züge dieses Bildes treffen aber auch für Frankfurter, Münchner und Hamburger zu. Während bei Thomas Bernhard ein Erzähler in einem endlosen inneren Monolog wiedergibt, was er beobachtet, intoniert Andreas Maier einen vielstimmigen Chor.
Für seinen Debütroman „Wäldchestag“ erhielt der 1967 in Bad Nauheim geborene (in Brixen lebende) Schriftsteller Andreas Maier eine Reihe von deutschen und österreichischen Auszeichnungen.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2002
Textauszüge: © Suhrkamp Verlag
Andreas Maier: Usingen
Andreas Maier: Kirillow
Andreas Maier: Sanssouci
Andreas Maier: Das Zimmer
Andreas Maier: Das Haus