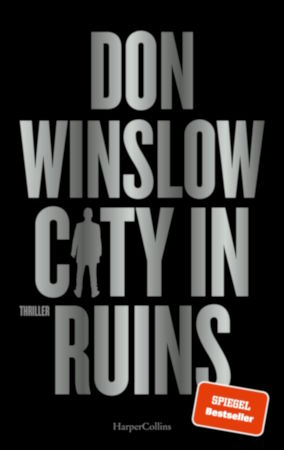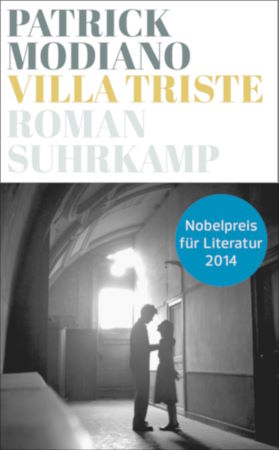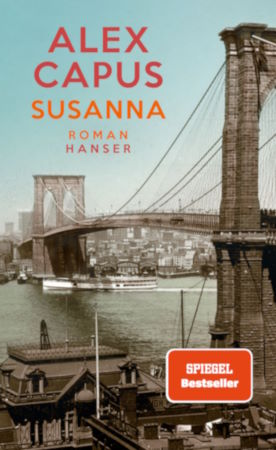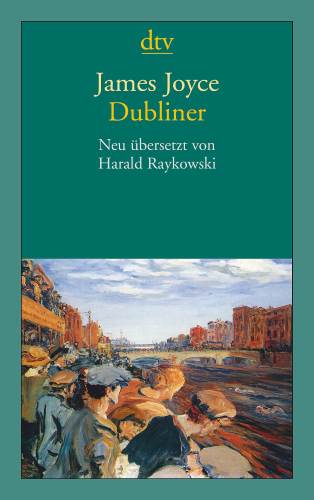Stella Braam : "Ich habe Alzheimer"
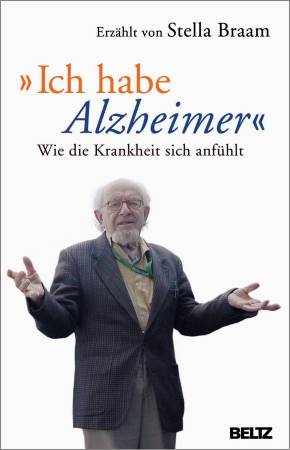
Inhaltsangabe
Kritik
Der siebenundsiebzigjährige Professor René van Neer ist pensioniert und wohnt in einer geräumigen Erdgeschosswohnung in Tilburg. Er studierte nicht nur Psychologie und Pädagogik und war als Kinderpsychologe tätig, sondern verwirklichte nach der Pensionierung seinen Traumberuf als Wissenschaftsjournalist. Seit einiger Zeit kommt er mit den alltäglichen Verrichtungen nicht mehr zurecht. Die Wohnung wird immer unordentlicher und ohne Erinnerungszettel, die er in allen Zimmern verteilt, ist er unfähig, sich zu organisieren. Das entgeht auch seiner Tochter Stella Braam nicht, die sich über den nachlassenden geistigen Zustand ihres Vaters zunehmend sorgt. Stella Braam, die als Journalistin und Schriftstellerin tätig ist, drängt ihn, sich untersuchen zu lassen. Die Diagnose Alzheimer überrascht sie nicht. Als sie ihn fragt, wie er gestern das Untersuchungsergebnis in der Klinik aufgenommen habe, besteht er darauf, nicht im Krankenhaus gewesen zu sein.
„Wie kommt ihr denn auf die Idee? Wer hat euch das eingeredet? … Manchmal denke ich, es werden falsche Gerüchte über mich verbreitet.“
Stella konfrontiert ihren Vater mit der Diagnose: Alzheimer. Aber das wussten wir doch schon, wirft er ein, oder nicht? „Na, zum Glück ist es kein Gehirntumor.“ (Seite 25) Im Übrigen:
Ob jemand Alzheimer hat, ist erst nach seinem Tod festzustellen. Dann sind die für diese Erkrankung charakteristischen ’senilen Plaques‘ und ‚Knäuel‘ zu sehen, Proteinablagerungen und –bündel in den Nervenzellen, die diese absterben lassen. (Seite 25)
René van Neer kann nicht mehr in seiner Wohnung bleiben, und Stella organisiert einen Pflegeplatz in einem Altenheim. Nach einem halben Jahr randaliert er auf der Station, sodass sich sowohl Schwestern als Heimbewohner bedroht fühlen. Das Pflegepersonal ist unterbesetzt und für die Versorgung von Dementen nicht ausreichend ausgebildet.
Das nächste Pflegeheim, in das ihn seine Tochter bringt, hält René für ein Hotel. Er wird immer vergesslicher. Nachts läuft er mit einer Einkaufstasche auf dem Flur herum. Er will sich beim Waschen nicht helfen lassen und beschwert sich bei Stella, dass er nichts zum Essen bekommt. Man erlaubt ihm auch nicht mehr, allein auf die Straße zu gehen. Er hat aber immer noch Freude, wenn er mit seiner Tochter die Bibliothek aufsuchen kann. Zwischen den Büchern lebt er wieder auf.
Es ist immer wieder erstaunlich wie schlagfertig und witzig er sein kann. Zum Beispiel schaut er seinem Tischnachbarn neidisch auf den Teller mit Fleisch. Ob er denn nicht Vegetarier sei, fragt ihn die Betreuerin. Doch schon, bestätigt René, aber erst nach dem Essen. „Ich bin Teilzeit-Vegetarier.“ Und als Stella und er von einer Frau begrüßt werden, an deren Namen sich auch Stella nicht erinnern kann, triumphiert René: „Das ist der Vorteil meiner Krankheit. Ich darf Fehler machen. Aber in zwanzig Jahren bist du an der Reihe.“ (Seite 52)
Wiederholt vermerkt die Heimleitung unangepasstes Verhalten Herrn van Neers. Zum Beispiel will er „bei der Frau aus Zimmer 305 schlafen“. Und von manchen Pflegerinnen lässt er sich nicht versorgen. Wie Stella dann herausfindet, wissen einige der Betreuerinnen nicht, wie mit Demenzkranken umzugehen ist, und ihr Vater wird deshalb bockig. Außerdem wird ihr in verschiedenen Gesprächen dargelegt, dass der Patient „hinsichtlich Gedächtnis und Verhalten unter allen Bewohnern im fortgeschrittensten Stadium“ ist. Er passt also nicht mehr in dieses Haus.
Unter Überwindung unterschiedlichster bürokratischer Hürden, findet Stella einen neuen Pflegeplatz für ihren Vater. Dort ist das Personal ebenfalls überfordert und teilweise nicht genügend auf die Versorgung von Demenzkranken eingestellt. Auch die von Stella zusätzlich engagierte Privatbetreuerin bringt keine Entlastung. René wird als aggressiv eingestuft, und man verordnet Medikamente. Die verabreichten Mittel verursachen bei ihm fortwährende Müdigkeit, Apathie und Bewegungsstörungen. Nach sieben Monaten muss er in eine geschlossene Pflegestation gebracht werden. René ist unruhig und wandert auf den Fluren herum. Man doktert an der Medikation herum, weil der Patient wegen unkontrollierter Bewegungen häufig stolpert.
Als der Heimarzt endlich einverstanden ist, die Tropfen abzusetzen, beginnt René, langsam seine Umgebung wieder wahrzunehmen, aber inzwischen besteht akute Sturzgefahr. Entzugserscheinungen könnten die Ursache dafür sein, womöglich hat der Körper auch nur „vergessen“ wie man stehen muss.
René läuft viel herum und stürzt oft. Hüftschoner sollen helfen, Brüche zu verhindern, aber er trägt sie nicht konsequent. Als der alte Herr wieder einmal stolpert und gegen den Kleiderschrank prallt, bricht er sich die Hüfte. Er trug seine Hüftschoner nicht. Die Implantation einer Oberschenkelkopfprothese ist erforderlich. Die Operation sollte eigentlich innerhalb von vierundzwanzig Stunden erfolgen, damit keine Komplikationen auftreten, aber René muss siebenundzwanzig Stunden darauf warten. Der Patient hat nach der Operation Wasser in der Lunge, sein Herz ist vergrößert, und er muss mit Sauerstoff beatmet werden. Dann kommen noch Herzrhythmusstörungen hinzu.
Aber René übersteht letztlich alles gut.
„Es war ein schwieriger Sommer“, das weiß er noch, aber an Einzelheiten kann er sich nicht erinnern. „Das ist der Vorteil bei Alzheimer: Man ist gesegnet mit der Fähigkeit, auch die schlimmsten Ereignisse sofort hinter sich zu lassen.“ (Seite 167)
Nach dem Krankenhausaufenthalt wird er zurück auf die Pflegestation gebracht, wo er wieder zu Kräften kommen soll. Er ist zwar dankbar für die Aufmerksamkeit des Personals, aber sich bewusst, dass ihm „sein höchstes Gut genommen wurde: seine Selbstbestimmung.“ (Seite 168) So sagt er zu seiner Tochter:
„Ich bin allem und jedem ausgeliefert. Du kannst zumindest noch wählen. Du kannst deine Muskeln noch bewegen. Ich aber kann nur noch abwarten, was sie machen. Aber vielleicht muss ich es positiv sehen“, muntert er sich selbst auf. „Jeder Tag ist neu.“ (Seite 168)
René geht es nun überraschend gut, selbst die Worte bringt er nicht mehr durcheinander. Das ist wohl auch darauf zurückzuführen, dass endlich alle „Demenzpillen“ und das Schlafmittel abgesetzt wurden. Die Tochter sagt, ihr Vater habe ein ganzes Jahr im Rausch gelebt.
Bei einem Gespräch mit Stella vertraut er ihr an, dass er keine Angst vor dem Tod habe, er sehne ihn vielmehr herbei. Nach außen zeigt er sich zwar stark, aber im Inneren ist er oft verzweifelt. Er möchte sie jedoch nicht damit belasten.
Er kämpft mit großen Schuldgefühlen: Er hat mich, seine Tochter, in ein aussichtsloses Abenteuer gezogen. Seine Fähigkeiten haben sich der Reihe nach zersetzt: sein Intellekt, sein Kommunikationsvermögen, seine Fähigkeit zu essen, zu gehen, zu denken, zu lesen, zu schreiben, Apparate zu bedienen, zur Toilette zu gehen, die Fernsehbilder zu interpretieren, die Schuhe zu schnüren, sich an Namen zu erinnern. „Es ist ein Kampf, den ich verliere“, bemerkte er einmal. Und dennoch kämpft er weiter und weigert sich, aufzugeben. Aber was hat er noch von seinem Leben?
Vater und Tochter besprechen eine Patientenverfügung, die René schon vor zwanzig Jahren verfasste. Er möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen. Das Dokument wird aber nicht anerkannt werden, da er „willensunfähig“ und nicht mehr „bei vollem Verstand“ ist.
Stella zeigt ihrem Vater das soeben erschienene Buch „Ich habe Alzheimer“ mit einem Foto von ihm auf dem Cover. Sie hätten es „gemeinsam“ geschrieben, schmeichelt sie ihm. Er käme gerne mit dem Autor des Buches in Kontakt, sagt er, denn er halte das Thema für sehr wichtig. Dass seine Tochter die Autorin ist, begreift er nicht.
In den folgenden fünfzehn Monaten verschlechtert sich Renés Befinden. Verschiedene Infektionen und Schmerzen unterschiedlicher Art behindern ihn, und er „leidet an seinen Leiden“. Seine am häufigsten geäußerte Klage ist der Satz: „Ich weiß nichts mehr, absolut nichts mehr.“ (Seite 183) Das sei nicht einfach, meint er, wenn man die meiste Zeit allein sei. Und er habe ein bisschen Angst vor diesem Leben, vertraut er Stella an.
Stella bekommt einen Telefonanruf von der Pflegerin. Wie schon ein paar Monate zuvor, habe man ihren Vater zuckend im Bett vorgefunden. Damals hatte er einen kleinen Schlaganfall zusammen mit einem epileptischen Insult. Den Vater findet Stella diesmal zitternd und in panischer Angst in seinem Bett vor. Ein Hustenanfall führt dazu, dass er nicht mehr schlucken kann. Es gibt keine Hoffnung mehr, sagt der Arzt; mit Morphium könne man sein Leiden erträglich machen.
Am Krankenbett liest ihm Stella ein von ihr verfasstes Abschiedsgedicht vor. Für dich geschrieben, sagt sie. Ob er sie wohl noch hört? Zweieinhalb Tage später stirbt René van Neer friedlich im Beisein seiner Tochter und seines Schwiegersohnes.
Die niederländische Journalistin Stella Braam schildert in ihrem Buch „‚Ich habe Alzheimer‘. Wie die Krankheit sich anfühlt“ als beobachtende Erzählerin den fortschreitenden geistigen Verfall ihres Vaters, des Psychologen und Wirtschaftsjournalisten René van Neer. Sie beschreibt die verschiedenen Stadien der Demenz aus der Sicht der Tochter mit emotionaler Anteilnahme, aber ohne Larmoyanz. Mit kleinen Anekdoten macht sie deutlich, wie ihr Vater trotz seiner Krankheit oft witzig und schlagfertig reagiert und führt uns vor Augen, dass er teilweise in der Lage ist, seinen Zustand und seine zunehmend geistige Verwirrung zu reflektieren. Stella Braams Klagen über die bürokratischen Vorschriften von Behörden und Institutionen beziehen sich zwar auf niederländische Verordnungen, treffen wohl aber auch teilweise auf deutsche Verhältnisse zu. Außerdem spricht sie das Problem der personell unterbesetzten Pflegeheime an und die damit einhergehende Überforderung der Betreuer. In vielen Fällen sind die Pflegekräfte auch nicht ausreichend geschult, um mit an Alzheimer Erkrankten adäquat umzugehen.
Die von der Autorin beschriebene Krankheitsgeschichte ihres Vaters hilft sowohl das Leiden des Patienten als auch die Kümmernisse und Sorgen der Angehörigen zu verstehen.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Irene Wunderlich 2010
Textauszüge: © Beltz Verlag