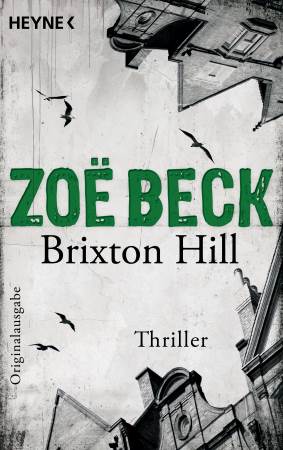Friedensreich Hundertwasser
Der junge Hundertwasser
Hundertwasser hieß eigentlich Friedrich Stowasser. Unter diesem Namen wurde er am 15. Dezember 1928 als einziges Kind eines arbeitslosen Reserveleutnants und dessen Ehefrau in Wien geboren. Ernst Stowasser starb im Jahr darauf im Alter von fünfunddreißig Jahren an einer Blinddarmentzündung. Seine Witwe Else zog ihren Sohn daraufhin allein auf und heiratete nicht noch einmal.
Im Alter von sieben Jahren kam Friedrich Stowasser auf die Montessori-Schule in Wien, wo ihm die Kunsterzieher ausdrücklich einen »außergewöhnlichen Formen- und Farbensinn« attestierten. Obwohl Else Stowasser Jüdin war, ließ sie ihren Sohn 1937 katholisch taufen und schickte ihn nach dem so genannten Anschluss Österreichs im Jahr darauf zur Hitler-Jugend, und weil Privatschüler eher auffielen, ließ sie Friedrich auf eine staatliche Wiener Schule wechseln. Obwohl es heißt, dass neunundsechzig engere und entferntere Verwandte von den Nationalsozialisten ermordet wurden, blieben Elsa und Friedrich Stowasser glücklicherweise verschont.
Noch während des Zweiten Weltkriegs begann Friedrich, Aquarelle von Motiven zu malen, die ihm bei Spaziergängen gefallen hatten. Sorgfältig bewahrte seine Mutter diese Blätter auf und zeigte sie Professor Herbert Boeckl, der nach dem Krieg Rektor der Wiener Akademie der Bildenden Künste geworden war. Boeckl ermutigte sie, Friedrich nach der Matura – also dem Abitur – auf die Akademie zu schicken.
So kam es, dass Friedrich Stowasser im Wintersemester 1948/49 einige Monate lang die Akademie besuchte und in der Klasse von Robin Christian Andersen sich im Aktzeichnen übte. Lieber malte er jedoch Landschaften; und die begann er nun mit dem Künstlernamen »Hundertwasser« zu signieren, denn er hatte festgestellt, dass »sto« im Russischen hundert bedeutet.
Unzufrieden mit dem Kunstunterricht an der Wiener Akademie brach Hundertwasser das Studium ab und reiste im April 1949 erstmals nach Italien. Dort gefiel es dem Zwanzigjährigen so gut, dass er schon im Juli an den Gardasee und in die Toskana fuhr, wo er drei junge Franzosen kennen lernte,
darunter den Maler René Brô, mit dem er sich enger befreundete. Gemeinsam reisten die vier Männer nach Sizilien, und im Oktober begleitete Hundertwasser seinen neuen Freund nach Paris. Fürs Erste kam er bei René Brô unter; im Dezember zog er dann zu dem Fotografen Augustin Dumage, einem anderen Freund René Brôs. Ein ganzes Jahr lang blieb Hundertwasser aus Wien fort; erst im Juli 1950 sah seine Mutter ihn wieder; im August hielt er sich jedoch in der Steiermark auf, und im Januar 1951 brach er zu einer mehrmonatigen Reise nach Marokko auf. Über Tunesien und Sizilien kehrte er zurück, und den Spätsommer verbrachte er wieder in der Steiermark.
Obwohl Hundertwasser immer ein Einzelgänger war und zunächst nicht über sonderlich viel Geld verfügte, reiste er Zeit seines Lebens gern und viel, anfangs auch als Anhalter oder Hilfsmatrose. Im Lauf seines Lebens lernte er Englisch, Französisch und Italienisch; darüber hinaus sprach er ein wenig Japanisch, Russisch, Tschechisch und Arabisch. Wo immer er hinkam, hatte er einen Miniaturmalkasten mit knopfgroßen Wasserfarbennäpfen und eine mit Wasser gefüllte Filmhülse bei sich. Unbekümmert über die Reaktion anderer Menschen setzte er sich an einen Tisch und malte, wenn ihm danach war, und wenn er nichts anderes zur Verfügung hatte, auch schon mal auf einen Briefumschlag.
Der Kunsthistoriker Wieland Schmied, der ein halbes Jahrhundert lang mit Hundertwasser befreundet war, erinnert sich an seine erste Begegnung mit ihm:
»Ich habe Hundertwasser im Herbst 1951 in Wien kennen gelernt […] Er trug Schuhe, die er sich selbst aus weichem Rindsleder zurechtgeschnitten und genäht hatte, die unförmig waren […], aber sehr praktisch und warm, wie er versicherte.«
»Es war nicht leicht, mit ihm zu kommunizieren […] Manchmal musste man ihn dreimal ansprechen, bevor er aufmerksam wurde und antwortete. Er konnte begeistert erzählen und urplötzlich wieder in tiefes Schweigen verfallen.«
Die Anfänge des Künstlers
Seine ersten Ausstellungen hatte Friedrich Hundertwasser 1952 und 1953 in seiner Geburtsstadt Wien, 1955 in Mailand, 1954 und 1956 in Paris.
Hundertwasser, der nie eine Staffelei benutzte, sondern Tische, Bänke und Pulte als Unterlage bevorzugte, malte nicht nur auf Zeichenkarton und Leinen, sondern auch auf Pressspanplatten, Tüchern, Pergament und Packpapier. Die Farben stellte er übrigens gern selbst her.
Mit seiner naiven, bunten und poetischen Kunst knüpfte Hundertwasser an Henri Rousseau, Paul Klee, Gustav Klimt und die vegetabilischen Linien des Jugendstils an. Er behauptete einmal, in der Schule der Erste gewesen zu sein, der perspektivisch hatte malen können, und seine naturalistischen Landschaftsaquarelle aus den Dreißiger- und Vierzigerjahren beweisen, dass er sich darauf verstand; ab 1950 verzichtete er jedoch ganz auf perspektivische Darstellungen. Da sträubten sich einigen Kulturbeflissenen die Haare: Einen Künstler, der auf der Akademie gewesen war und als Erwachsener wie ein Kind zweidimensional malte, konnte man doch nicht ernst nehmen!
Hundertwasser liebte leuchtende und komplementäre Farben, die für ihn Leben bedeuteten. Abstraktes und Gegenständliches arrangierte er zu dekorativen Ensembles. Häufig verwendete er bei seinen Gemälden auch Chiffren aus der Architektur:
Türme, Häuser und Fenster. Sein wichtigstes Motiv war ohne Zweifel die Spirale, die er Ende 1952 während der Vorführung eines Dokumentarfilms über Bilder von Geisteskranken für sich entdeckte und im Juni 1953 erstmals in dem Gemälde »Der Berg und die Sonne« verwendete. Hundertwasser sah in der Spirale ein Symbol des Lebens. Zumeist malte er eine Spirale, die sich vom Zentrum des Bildes zum Rand entwickelt, und in der Komplementärfarbe dazu eine zweite, die sich von außen nach innen windet. Eines der schönsten Spiralbilder – »Hommage au Tachisme« – entstand im Januar 1961 und war auch bereits eines der letzten.
Für Hundertwasser kam es bei einem Kunstwerk nicht darauf an, dass es die Natur spiegelte, sondern dass es beim Betrachter Assoziationen hervorrief. Die Titel, die er seinen Werken gab, sagen zwar in der Regel so wenig darüber aus wie der Name eines Menschen über dessen Charakter, aber mitunter erleichtern sie das Zustandekommen der Assoziationen. Obwohl jedes Gemälde statisch ist, soll im Kopf des Betrachters etwas Dynamisches geschehen und sich in seiner Vorstellung eine Bilderfolge entwickeln. Hundertwasser sprach in diesem Zusammenhang von einem »Individualfilm«.
Sein künstlerisches Schaffen begann Hundertwasser nicht mit Theorien, sondern er tastete sich an seinen persönlichen Stil heran. Statt vom Verstand ließ er sich von Naivität, Fantasie und Imagination leiten. Allerdings dachte Hundertwasser über seine Erfahrungen als Maler nach und formulierte ab Mitte der Fünfzigerjahre seine Grundgedanken über die Kunst, die er beispielsweise 1957 in seiner »Grammatik des Sehens« zusammenfasste, später weiterentwickelte und immer wieder in Manifesten verkündete. Der Maler Ernst Fuchs brachte Hundertwassers Weltanschauung auf die Formel:
»Zurück zu den Wurzeln, zum schöpferischen Wesen, von der Kindheit her.«
Die Einheit von Werk und Leben
1957, mit achtundzwanzig Jahren, konnte Hundertwasser sich bereits einen – allerdings halb verfallenen – Bauernhof am östlichen Rand der Normandie leisten: »La Picaudière«. Er liebte es, sich aufs Land zurückzuziehen und im Einklang mit der Natur zu leben. Sein Nachbar fand bald heraus, was er tun musste, wenn er Geld benötigte: Dann vergewisserte er sich, dass Hundertwasser da war, warf frühmorgens eine Motorsäge an und näherte sich damit beispielsweise dem Stamm einer Pappel. Er konnte sich darauf verlassen, dass Hundertwasser aus dem Haus gestürzt kam, ihm Einhalt gebot und die vermeintlich gefährdeten Bäume rettete, indem er sie seinem Nachbarn abkaufte.
Die 1958 in Gibraltar geschlossene erste Ehe Hundertwassers wurde nach zwei Jahren geschieden.
Im Wintersemester 1959/60, als sich der inzwischen Dreißigjährige als Gastdozent an der Hamburger Kunsthochschule Lerchenfeld betätigte, trat einmal ein Student an ihn heran und bat um Aufnahme in die Klasse. Hundertwasser erkundigte sich erst einmal nach der Motivation des jungen Mannes, und der gab freimütig zu, er habe von vakanten Studienplätzen gehört. Als Hundertwasser, der die Kunst als etwas Heiliges verehrte, dann auch noch erfuhr, dass der Bewerber später Kunsterzieher werden wollte, schauderte ihn und er sagte sarkastisch:
»An Ihrer Stelle würde ich eine Kerze nehmen und sterben gehen.«
1960 beteiligte sich Hundertwasser an einer Veranstaltung des französischen Künstlers Alain Jouffroy in der Galerie »Quatre Saisons« in Paris. Nach seiner kurzen Ansprache verteilte er am Seineufer gesammelte und in einem Waschkessel gekochte Brennnesseln unter den Gästen und aß selbst demonstrativ davon, obwohl ihm übel davon wurde, weil sie nach Waschpulver schmeckten. Mit dieser »Brennnesselaktion« wollte Hundertwasser die anwesenden Künstler aufrütteln, lieber auf Honorare zu verzichten, als sich in irgendeiner Weise zu verbiegen:
»Wisst ihr, wie einfach es ist, ohne Geld zu leben? Man muss nur Brennnesseln essen […] Sie sind ganz umsonst.»
Ein paar Monate später reiste Hundertwasser nach Japan, wo er bei der 6. Internationalen Kunstausstellung in Tokio 1961 den Mainichi-Preis erhielt, mit einer Einzelausstellung in der Tokyo Gallery großen Erfolg hatte und sich im Jahr darauf mit der Japanerin Yuko Ikewada vermählte. (Diese Ehe hielt vier Jahre, immerhin doppelt so lang wie die erste.) Während seines Aufenthalts in Tokio übertrug er seinen Vornamen Friedrich in die japanischen Schriftzeichen für die Wörter »Frieden« und »reich«. Dementsprechend signierte er von da an mit Friedereich, Friedenreich und ab 1968 mit Friedensreich Hundertwasser. Dass nun beide Bestandteile seines Künstlernamens aus jeweils dreizehn Buchstaben bestanden, hielt er für glückbringend.
Hundertwasser predigte das Brennnessel-Essen nicht nur anderen, sondern lebte auch selbst sehr genügsam. Nach dem Bauernhaus in der Normandie kaufte er sich 1964 die aufgelassene »Hahnsäge« im dünn besiedelten niederösterreichischen Waldviertel und richtete sich dort eine weitere Behausung abseits aller Hektik ein.
Person, Leben und Werk bildeten bei Hundertwasser eine Einheit: sein Lebenswerk.
Schon im Alter von fünfundzwanzig Jahren hatte er einem Wiener Kritiker aus Paris geschrieben:
»Ich kann […] momentan zwischen Kunst, Religion, Leben, Wissenschaft, Natur, Politik, Literatur, Mystik und Musik keine Grenzlinie ziehen.«
Immer wieder rief Hundertwasser dazu auf, sich in der Kunst, in der Architektur und überhaupt im Leben auf die Natur zu besinnen. Der einzelkämpferische Querdenker mochte zwar keine Geselligkeiten und wirkte eher schüchtern und introvertiert, aber er wollte auffallen und setzte sich deshalb in Szene. Um auf sich und seine Thesen aufmerksam zu machen, ließ er sich exzentrische Aktionen einfallen, darunter zwei so genannte »Nacktreden«.
Im Dezember 1967 stellte er sich in der Galerie Hartmann in München splitternackt zwischen zwei ebenfalls unbekleidete Kunststudentinnen, geriet mit seiner Ansprache allerdings ein wenig ins Stocken, als die Gäste gleich zu Beginn unerwartet Beifall klatschten. Im folgenden Monat trat Hundertwasser im Internationalen Studentenheim in Wien-Döbling auf. Dieses Mal standen ihm keine nackten Mädchen zur Seite. Er warf erst einmal je ein Ei an Wand und Decke, bevor er sich rasch auszog und zu reden begann – während die Kulturstadträtin Gertrude Sandner entrüstet den Raum verließ. Anders als in München wurde die »Nacktrede« in Wien als Skandal empfunden, und die Polizei musste drei Anzeigen gegen Hundertwasser bearbeiten, die allerdings im Sand verliefen.
Ferry Radax hatte bereits 1966 einen Dokumentarfilm über den Künstler gedreht: »Hundertwasser. Leben in Spiralen«. 1970 bis 1972 arbeitete der Maler mit dem Regisseur Peter Schamoni an dem Film »Hundertwasser Regentag«. Der zweite Teil des Titels bezog sich auf den alten Salzfrachter »Giuseppe T«, den Hundertwasser 1968 in Palermo erworben und in die Werft von Pellestrina südlich von Venedig hatte bringen lassen. Dort wurde das in »Regentag« umgetaufte Schiff instand gesetzt, umgebaut, neu bemalt und mit bunten Segeln ausgestattet. Hundertwasser, der in Venedig im Palazzo »Casa de Maria« wohnte, erwarb ein Kapitänspatent und lebte oft monatelang auf der hochseetüchtigen »Regentag«, auf der er 1976 nach Neuseeland segelte, wo er inzwischen eine zweite Heimat gefunden hatte.
Er war nämlich im Mai 1973 zur Eröffnung einer Ausstellung in der »City of Auckland Art Gallery« gereist und von Australien weiter nach Neuseeland, wo er sich im Jahr darauf in der zur Nordinsel gehörenden Bay of Islands ein Stück Land mit einem aus den Pioniertagen stammenden Farmhaus gekauft hatte, denn er träumte – wie Paul Gauguin achtzig Jahre vor ihm – vom Paradies auf der anderen Seite der Erde.
In dieser abgelegenen Gegend stand Hundertwasser keine Bibliothek zur Verfügung, aber die vermisste er auch nicht. Die große Literatur interessierte ihn nämlich kaum; allenfalls las er mal einen Kriminalroman von Georges Simenon. Wenn er eine Zeitung in die Hand bekam, überblätterte er das Feuilleton ebenso wie den Sport- und den Wirtschaftsteil; nur an Schlagzeilen über politische und ökologische Themen blieben seine Augen hängen. Vor allem aber schaute er sich die Fotos an.
Die Gäste aus Europa, die ihn in seinem neuseeländischen Haus besuchten, bewirtete er mit Salat aus dem eigenen Garten, selbst gebackenem Brot und Pfannkuchen aus gemahlenen Weizenkörnern, die er in der zehn Kilometer entfernten Kleinstadt Kawakawa als Hühnerfutter besorgte. Alkohol und Drogen lehnte er ab.
Auf dem Dach des Hauses legte Hundertwasser eine Wiese an, und im Verlauf der Jahre pflanzte er auf seinem Areal in Neuseeland hunderttausend Bäume, und zwar keine Monokultur, sondern verschiedene Hölzer, damit Schädlinge sich nicht so leicht ausbreiten konnten.
Umweltbewusst handelte Hundertwasser nicht nur in diesem Fall.
Mitte der Siebzigerjahre propagierte er in München die »Humustoilette«. Das war einfach ein großer Kübel mit Luftlöchern im Boden, der in einer Wanne stand. Damit die Fäkalien während der Kompostierung nicht stanken, musste man sie nach dem Vorbild der Katzen bedecken, und zwar mit Humus aus einem zweiten Eimer. Der schon erwähnte Kunsthistoriker Wieland Schmied half Hundertwasser einmal nach einer Fernsehaufnahme beim SFB, so eine Humustoilette über den Kurfürstendamm zum Hotel zu tragen.
Karl Ruhrberg, der damals Direktor des Museums Ludwig in Köln war, schrieb 1980 über Hundertwasser:
»Er trat bereits für den Umweltschutz ein, als es diesen Terminus noch nicht gab. Er war der erste >GrüneBunte
Hundertwasser schloss sich zwar nie einer Partei oder Bewegung an, aber er unterstützte einzelne Aktionen und kampierte beispielsweise im Dezember 1984 eine Woche lang mit Umweltschützern im Auwald bei Hainburg an der Donau, um die geplante Überflutung des Gebiets westlich von Bratislava im Rahmen eines Kraftwerkprojekts zu verhindern. (Die österreichische Regierung gab schließlich den Demonstranten nach und erklärte das Areal zum Nationalpark.)
Außerdem setzte sich Hundertwasser für Personen ein, deren Anliegen er teilte, etwa für einen Mieter in Wien, der auf seinem Balkon im siebten Stock einen Wilden Wein vom Blumentopf aus an der Hauswand hochranken ließ. Das missfiel zwar den Nachbarn, aber der Besitzer der Pflanze wollte sie nicht abschneiden. Hundertwasser schrieb Briefe und machte Journalisten auf den Fall aufmerksam; sein Engagement zur Rettung des Wilden Weins blieb jedoch vergeblich: Am 17. Juni 1980 um 6 Uhr morgens trafen sich ein Vertreter der Genossenschaft, der die Immobilie gehörte, ein Rechtsanwalt, ein Gerichtsvollzieher und ein Bauunternehmer vor dem Haus und beaufsichtigten vier Arbeiter, die den beanstandeten Wildwuchs von der Hauswand entfernten.
Hundertwassers bereits erwähnte Lehrtätigkeit an der Hamburger Kunsthochschule Lerchenfeld war Anfang 1960 mit einem Eklat zu Ende gegangen, weil er und sein Kollege Bazon Brock an Wänden, Türen und Fenstern des Gebäudes die ununterbrochene »Linie von Hamburg« gezogen hatten, bis es ihnen nach eineinhalb Tagen unermüdlicher Arbeit die Weiterführung verboten worden war. Hundertwasser hatte in einem offenen Brief an den Kultursenator dagegen protestiert und seine Dozentur niedergelegt. 1981 wurde er als Leiter einer Meisterschule an die Akademie der Bildenden Künste in Wien berufen, aber auch diese Tätigkeit erfüllte Hundertwasser nicht gerade zur Zufriedenheit der Direktion, denn er ließ sich zumeist von seinem Assistenten Peter Dressler vertreten und statt selbst zu erscheinen, schickte er ihnen einmal zwei von ihm besprochene Tonbänder aus Neuseeland.
Hundertwasser und die Bibel
Im Alter von vierzig Jahren hatte Hundertwasser seine Suche nach neuen Inspirationen in der Malerei weitgehend beendet. Seither kombinierte und variierte er die früher von ihm entwickelten Stilelemente. Andere Interessen und Passionen verdrängten die Malerei aus dem Zentrum seines Blickfeldes. Hundertwasser entwarf Briefmarken, Plakate, Fahnen, Autokennzeichen,
Telefonkarten – und eine in der Auflage streng limitierte Bibelausgabe. Das 1688 Seiten im Großformat umfassende Buch ist mit dreißig von Hundertwasser eigens für diese Edition geschaffenen Collagen und weiteren rund fünfzig Kunstwerken bebildert. Keiner der nach Hundertwassers Vorgaben handgefertigten Einbände ist mit einem anderen identisch: Bei jeder »Hundertwasser-Bibel« handelt es sich um ein Unikat. Als die Ausgabe auf einer Pressekonferenz 1995 vorgestellt wurde und einer der Journalisten fragte, was Hundertwasser vom Inhalt der Bibel hielt, antwortete dieser süffisant: »Die Bibel? Ich habe sie nie gelesen.«
Hundertwasser liebte es, andere mit überraschenden oder überspitzten Äußerungen zu brüskieren. Selbstverständlich waren ihm die wichtigsten Aussagen der Bibel geläufig, aber er bekannte sich in der Tat nicht zu einer bestimmten Religion und lehnte jeden Dogmatismus ab. Nicht in einer Kirche oder einer Moschee erwartete er, Gott zu begegnen, sondern er glaubte, das Göttliche in der Natur und in der Kunst zu spüren.
»Ich glaube, dass Malerei eine religiöse Beschäftigung ist, dass der tatsächliche Impuls von außen kommt, von irgend etwas anderem, was wir nicht kennen, eine undefinierbare Macht, die kommt oder nicht kommt, und die einem die Hand führt. Man hat früher gesagt, es wäre die Muse zum Beispiel; es ist ein blödes Wort natürlich, aber es ist irgendeine Erleuchtung.«
Nicht erst bei der »Bibel« experimentierte Hundertwasser mit Variationen im Farbdruck. Schon früher hatte er sich mit der Frage beschäftigt, wie er größere Auflagen eines Motivs erzielen konnte, ohne sich mit einfachen Reproduktionen von Originalgrafiken zufrieden geben zu müssen. Da war er auf die Idee verfallen, ein bestimmtes Bild so zu variieren, dass die einzelnen Blätter sich zwar wie Geschwister ähnelten, jedoch nicht wie eineiige Zwillinge glichen. Beispielsweise gab er von »10002 Nights Homo Humus come va how do you do« 1982/83 in Mestre zehntausendundzwei Exemplare in einer Kombination aus Lithografie, Siebdruck und Metallprägung in Auftrag und sah dafür ebensoviele Farbvarianten vor. Am Ende nummerierte und signierte er die gesamte Auflage Blatt für Blatt, von 1 bis 10 002.
Hundertwasser und die Baukunst
Am intensivsten befasste sich Hundertwasser in den beiden letzten Jahrzehnten seines Lebens – also in den Achtziger- und Neunzigerjahren – mit der Baukunst.
Für Hundertwasser hingen Ästhetik und Ökologie eng zusammen: Was die Umwelt schädigt, kann niemals schön sein. Davon war er überzeugt. Es ging ihm nicht nur darum, Gebäude in die Landschaft zu integrieren, sondern auch der Natur die geraubten Flächen zurückzugeben, indem er die Dächer möglichst begrünte oder bewaldete, sodass aus der Vogelperspektive idealerweise keine waagrechten Bauteile zu sehen waren. Darüber hinaus pflanzte er Bäume auf Balkonen oder ließ sie – als so genannte »Baummieter« – aus eigens angelegten Fassadenöffnungen wachsen.
Wieland Schmied fasst zusammen:
»Alle Architekturideen Hundertwassers beziehen sich auf den Menschen als ein Wesen, das in innigem Zusammenhang mit der Natur steht, oder, soweit es diesen Zusammenhang verloren hat, alles tun muss, um ihn wieder herzustellen […]
»Unser Verhältnis zur Natur, zu aller Vegetation, insbesondere zu den Bäumen sollte gleichsam religiösen Charakter haben. Die Kräfte, die sich in ihr offenbaren, die Wachstum und Welken bewirken, müssen heilig gehalten werden […]«
Hundertwasser strebte keine kühnen Konstruktionen an.
»Fortschritt ist Rückschritt, und der Rückschritt wird zum Fortschritt.«
Er entwarf weder Wolkenkratzer noch frei tragende Dächer, die sich nur mit Stahlbeton hätten verwirklichen lassen, denn dieses Material hasste er.
»Los von Loos!«, hatte er 1968 in Wien gerufen. Vehement wandte er sich gegen seinen 1933 verstorbenen Landsmann Adolf Loos, einen Repräsentanten der Sachlichkeit in der Architektur, der mit Vorliebe kubistische Formen entworfen und 1908 unter dem Titel »Ornament und Verbrechen« geschrieben hatte:
»Der moderne mensch, der mensch mit den modernen nerven, braucht das ornament nicht, er verabscheut es.«
Im krassen Gegensatz dazu vertrat Hundertwasser biomorphe Ideen und entwarf bunte Märchenschlösser mit verspielten, asymmetrischen Fassaden. Adolf Loos hatte aber auch vorgeschlagen, bei Mehrfamilienhäusern nur die tragenden Gebäudeteile mit den Installationsanschlüssen vorzugeben und die Ausgestaltung der Privaträume den Bewohnern zu überlassen. Klingt das nicht wie eine Idee von Friedensreich Hundertwasser?
Auf die Vielfalt und den Abwechslungsreichtum der Formen und Farben kam es ihm an. »Anything goes«, dieser Spruch des Philosophen Paul K. Feyerabend könnte hier auch passen. Rasterförmig gekachelte Wände im Badezimmer waren Hundertwasser ein Gräuel; er wollte es unregelmäßig haben, »tanzend«, wie er es nannte. Das galt auch für die Fenster, die er nicht nur in Form und Größe variierte, sondern außerdem in verschiedenen Höhen und ungleichmäßigen Abständen anbringen ließ. Die Gerade und den rechten Winkel, die er schon als Maler verteufelt hatte, verabscheute er auch als Baumeister. Er war überzeugt, dass eine […]
»[…] Architektur, die das Lineal zum obersten Prinzip erhebt, das gefährlichste Umweltgift ist, da es die Seele des Menschen zerstört.«
Gewellte Wände und unebene Fußböden fand er schön und setzte sie immer wieder wenigstens für Treppenhäuser und Korridore durch, auch wenn er sich in Privaträumen kompromissbereit zeigte, weil er wusste, dass es sonst schwierig gewesen wäre, Möbel aufzustellen. Wo sich eine Gelegenheit bot, sah Hundertwasser eine Verschachtelung von Wohnungen vor, die er außen durch unregelmäßige, von Keramikbändern eingesäumte Fassadenflächen in verschiedenen Farben abbildete. Darüber hinaus spielte er gern mit bunten Säulen, von denen keine der anderen in Form oder Farbe glich, und weil er sie als Zierde verstand, mussten sie auch keine tragende Funktion haben.
Die meisten Menschen wären wohl damit einverstanden, dass die Bewohner von Mehrfamilienhäusern ihre Privatbereiche nach ihrem persönlichen Geschmack gestalten dürfen. Hundertwasser ging jedoch einen Schritt weiter und verkündete ein so genanntes »Fensterrecht«:
»Ein Mann in einem Mietshaus muss die Möglichkeit haben, sich aus einem Fenster zu beugen und – so weit seine Hände reichen – das Mauerwerk abzukratzen. Und es muss ihm gestattet sein, mit einem langen Pinsel – so weit er reichen kann – alles außen zu bemalen, sodass man von weitem, von der Straße sehen kann: Dort wohnt ein Mensch, der sich von seinen Nachbarn […] unterscheidet.«
Nicht nur der Baumeister sollte also für die Gestaltung der Fenster zuständig sein, sondern Hundertwasser hätte es begrüßt, wenn jeder Mieter von seinem »Fensterrecht« Gebrauch gemacht und auf diese Weise für eine bunte Vielfalt an den Fassaden gesorgt hätte. Über diese Idee schüttelten allerdings selbst Hundertwasser-Anhänger den Kopf.
Schon als Neunundzwanzigjähriger hatte Hundertwasser in seinem »Verschimmelungsmanifest« kritisiert, dass Architekten Häuser bauen, in denen sie niemals selbst wohnen. Dagegen pries er 1981 die im 19. Jahrhundert ins Leben gerufene und von ihm wohl etwas idealisierte Schrebergarten-Kultur, bei der ein und dieselbe Person Bauherr, Baumeister, Handwerker, Gärtner und Bewohner ist.
Als Baumeister ließ Hundertwasser sich von einem Bild leiten, das er selbst geprägt hatte, der Metapher von den drei Häuten, die den Menschen zum Beispiel vor der Kälte schützen sollen, ihn aber auch nicht isolieren dürfen: Über der Haut des Körpers, der Epidermis,
trägt der Mensch zumeist seine Kleidung, die er sich nach seinen persönlichen Vorstellungen und Bedürfnissen ausgesucht hat. Anders ist das bei der dritten Haut, seiner Wohnung beziehungsweise seinem Haus: Wenn er selbst Bauherr ist, kann er versuchen, dem Architekten seine Wünsche nahezubringen, aber die meisten Menschen sind auf vorgegebene Behausungen angewiesen und haben nur eine sehr beschränkte Auswahlmöglichkeit, zumal, wenn sie aufs Geld achten müssen. Das hielt Hundertwasser für schlecht, aber sogar in den von ihm selbst konzipierten Häusern blieb es bei der Unterscheidung von Architekt und Bewohner. (Übrigens ergänzte Hundertwasser das Bild später durch eine vierte und fünfte Haut: Familie, soziales Umfeld, Gesellschaft und ganz außen die globale Umwelt sowie das Universum.)
Anders als an Universitäten ausgebildete Architekten arbeitete Hundertwasser nicht mit Grundrissen und Aufrissen, sondern er gab Modelle in Auftrag, orientierte sich daran, überlegte sich Verbesserungen und ließ sie so lange modifizieren, bis er zufrieden war.
Lange Zeit wurde er nicht ernst genommen, und einige renommierte Architekten hätten sich wohl zeitlebens dagegen verwahrt, als Kollegen Hundertwassers angesprochen zu werden. Doch ab Mitte der Achtzigerjahre erhielt Hundertwasser zahlreiche Anfragen für den Bau oder die Umgestaltung von Gebäuden. Von sich aus bemühte er sich keineswegs um Aufträge, und er beteiligte sich auch nicht an Architekturwettbewerben. Stand er dann einmal unter Vertrag, beharrte er kompromisslos auf seinen Vorstellungen. Damit war er ein Vorbild für seinen Manager und Nachlassverwalter – oder soll man sagen: Gralshüter – Joram Harel, der beispielsweise im September 2005, eine Woche vor der Einweihung der »Grünen Zitadelle« in Magdeburg, des letzten noch von Hundertwasser selbst entworfenen Wohn- und Geschäftshauses, auf Kachelwände in der öffentlichen Toilette eingeschlagen haben soll und jedenfalls verlangte, 9214 Stauden auf dem Dach, die ihm »zu gärtnerisch« vorkamen, durch eine Blumenwiese zu ersetzen.
Als Hundertwasser 1982 eine nüchterne, nur aus Geraden und rechten Winkeln bestehende Fassade der Rosenthal-Fabrik in Selb mit ein paar wolkenförmigen Kachelflächen aufzulockern versuchte und Bäume auf das Flachdach pflanzte, fühlte er sich wie ein »Architekturdoktor«, dessen Aufgabe es ist, »kranke« Häuser zu heilen. Die Krankheit bestand für Hundertwasser in der Gesichtslosigkeit der Bauten, die wiederum eine Ausgeburt der Farblosigkeit und Gleichförmigkeit, Normierung und Regelmäßigkeit war, die er als hässlich empfand und – wenn man ihn ließ – mit den für ihn typischen Stilmerkmalen überwand. Kritisch anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass Hundertwasser auch Wohnhäuser ausschließlich danach beurteilte, ob sie bunt und abwechslungsreich aussahen, aber nicht nach Wärmedämmung, Schallisolierung, Sicherheit, sanitären Anlagen und Spielflächen für Kinder fragte.
Am 15. Dezember 1977 hatte sich der damalige Wiener Bürgermeister Leopold Gratz in einem Brief an Friedensreich Hundertwasser gewandt:
»[…] Namens der Stadt Wien biete ich Ihnen ein Grundstück zur Errichtung eines Hauses nach Ihren Ideen und Wünschen an (mit Baum- und Grasdach) […]«
Nach dem Erhalt des Briefes eilte Hundertwasser unverzüglich ins Rathaus und sprach mit dem Bürgermeister über das Vorhaben. Im Verlauf der nächsten Monate besichtigte er verschiedene Grundstücke, die ihm die Stadt Wien zur Verfügung stellen wollte, bis er im Juni 1978 ein gut tausend Quadratmeter großes Areal an der Ecke Kegel-/Löwengasse im dritten Bezirk für geeignet hielt.
Obwohl der Bürgermeister das Projekt initiiert hatte, gab es erst einmal ein bürokratisches Hin und Her, bis Hundertwasser sich darüber am 26. April 1979 bei Leopold Gratz beklagte und daraufhin ein studierter Architekt beauftragt wurde, den Entwurf für eine Wohnhausanlage auszuarbeiten. Als Hundertwasser den Plan im September erstmals sah, traute er seinen Augen nicht, denn das konventionelle Baukonzept entsprach in keiner Weise seinen Vorstellungen. Aufgebracht kritzelte er in den Aufrissen herum; dann besorgte er sich fünfzig Streichholzschachteln und klebte sie zu einem Modell mit treppenförmig gestaffelten Terrassen und einem Turm zusammen. Der Architekt versprach, die Anregung aufzunehmen, aber ein Jahr später kam es zum endgültigen Bruch. Und nun hatte Hundertwasser Glück, denn der damals fest bei der Stadt Wien angestellte Architekt Peter Pelikan, der für seinen ausgeschiedenen Kollegen einsprang, wurde zu einem kongenialen Mitarbeiter des autodidaktischen Künstlers auch bei weiteren Bauprojekten.
Am 16. August 1983 konnte der Grundstein für das Haus mit fünf Geschäften, fünfzig Wohnungen, sechzehn privaten und drei gemeinschaftlichen Dachterrassen gelegt werden. Zwei Jahre später, am 5. September 1985, stellten der für Verkehr, Straßen und Energie zuständige Stadtrat Fritz Hofmann und Helmut Zilk – der Leopold Gratz im Jahr davor als Bürgermeister abgelöst hatte – das Hundertwasser-Haus der Öffentlichkeit vor, obwohl es noch nicht ganz fertig war und ein weiteres Jahr daran gebaut wurde. Das Echo fiel geteilt aus: Während einige das bunte, verschachtelte, begrünte und abwechslungsreich verzierte Gebäude für kitschig hielten und über das »Wiener Luftschloss« spotteten, gab es zahlreiche Menschen, die darin wohnen wollten, und die Nachfrage überstieg das Angebot um ein Vielfaches. – Übrigens stehen den Bewohnern keine Humustoiletten, sondern normale WCs zur Verfügung.
Nach der Fertigstellung des Hundertwasser-Hauses in Wien lud der Bürgermeister und Landeshauptmann Helmut Zilk den Künstler 1987 ein, sich als »Architekturdoktor« Gedanken über eine Umgestaltung des bei einem Brand weitgehend zerstörten Fernwärmewerks Wien-Spittelau zu machen. Hundertwasser zögerte und beriet sich mit dem bekannten Umweltschützer Bernd Lötsch: Sollte er seinen Ruf als ökologischer Künstler gefährden, indem er eine Müllverbrennungsanlage verkleidete? Monatelang beschäftigte sich Hundertwasser mit der Problematik. Erst im Herbst 1988 nahm er den Auftrag an. Wie befürchtet, musste er sich nach dem Umbau den Vorwurf gefallen lassen, eine Müllverbrennungsanlage hinter farbigen Blechvorhängen versteckt und mit Dach- beziehungsweise Balkonbepflanzungen in die Kulisse eines Märchenschlosses aus Tausendundeiner Nacht verwandelt zu haben. Hundertwassers Gegner sahen darin eine Todsünde gegen die von Louis Henry Sullivan geprägte Maxime: »Form Follows Function«.
Im Juni 1981 besuchte Friedrich Zeck, der Pfarrer der Gemeinde Bärnbach im Westen der Steiermark, eine Hundertwasser-Ausstellung im Kulturhaus der Stadt Graz. Beim Anblick der Gemälde wünschte er sich, seine nach dem Zweiten Weltkrieg errichtete und der heiligen Barbara geweihte Kirche im Rahmen der ohnehin erforderlichen Renovierung von Hundertwasser umgestalten zu lassen. Wie aber sollte er an den berühmten Künstler herankommen? Zufällig lebte in Bärnbach der Briefmarkenstecher Wolfgang Seidel, der mit Hundertwasser an Briefmarken-Entwürfen gearbeitet hatte. Als Hundertwasser im August 1984 zu Besuch kam, machte Seidel den Pfarrer und den Künstler miteinander bekannt, und sie besichtigten zusammen die Kirche. Unter der Bedingung, dass man ihm freie Hand ließ, erklärte sich Hundertwasser einverstanden, das Äußere der Kirche neu zu gestalten und verzichtete sogar aufs Honorar.
Nach Abschluss der Grundsanierung stellte Hundertwasser sein Modell der neugestalteten Sankt-Barbara-Kirche im April 1987 in Wien einer Delegation aus Bärnbach vor, und zwei Monate später stimmte der Pfarrgemeinderat zu. Spenden sowie die finanzielle Unterstützung der Diözese und der Stadt Bärnbach erlaubten es der kleinen Pfarrei, den Umbau in Auftrag zu geben. Hundertwasser selbst stiftete die Radierung »Bärnbacher Andacht« und übernahm die Kosten für die Vergoldung des neuen Zwiebelturms. Vom 12. Oktober 1987 bis 2. Juli 1988 dauerten die Bauarbeiten, und am 4. September 1988 kam der Grazer Bischof zur Kirchweihe.
Hundertwasser hatte den pyramidenförmigen Turmhelm durch eine goldene Zwiebel ersetzt, das Dach mit verschiedenfarbigen Ziegeln gedeckt und die Fassaden mit blauen Pilastern und Querverbindungen gegliedert. Den bunten Keramikschmuck entdeckt der Besucher erst, wenn er sich dem Eingang der im Inneren nüchtern-asketisch geblieben Kirche nähert. Großen Wert legte Hundertwasser auf den Rundweg außerhalb der Kirche, der unter zwölf Torbogen hindurchführt, die auf den Vorder- und Rückseiten mit Symbolen verschiedener Religionen aus aller Welt verziert sind. Damit wollte er ein Zeichen setzen für weltanschauliche Toleranz und Respekt vor anderen Glaubensrichtungen.
Auch außerhalb von Österreich hatte es sich inzwischen herumgesprochen, dass Friedensreich Hundertwasser nicht nur ein origineller Maler, sondern auch ein Baukünstler mit ausgefallenen Ideen war.
Walter Wallmann, Hilmar Hoffmann und Hans-Erhard Haverkampf, die damals als Oberbürgermeister, Kultur- und Baudezernent von Frankfurt am Main amtierten, luden Hundertwasser 1986 ein, auf einem Grundstück im Stadtteil Heddernheim eine Kindertagesstätte zu konzipieren. Am anderen Ufer des renaturierten Urselbachs sollten außerdem eine Schule, ein Gemeindezentrum sowie ein Wohn- und Verwaltungsgebäude für das Bistum Limburg und den Evangelischen Regionalverband errichtet werden. Im Juni 1987 stellte Hundertwasser sein Modell der Gesamtanlage vor. Originell war daran, dass er die schräg ansteigenden Gebäude zum Teil innerhalb künstlich aufgeschütteter und natürlich bepflanzter Hügel verschwinden ließ, was einige wenige Räume fensterlos machte. Das lehnte jedoch der Baudirektor des Bistums Limburg vehement ab:
»In diesen eingegrabenen Räumen vermögen wir keinen Beitrag zu einer menschlicheren Architektur zu sehen.«
In zwei Schreiben an Bischof Franz Kamphaus erläuterte und verteidigte Hundertwasser zwar seine Vorstellungen, aber das von ihm erbetene persönliche Gespräch kam nicht zustande. Stattdessen antwortete Kamphaus in einem offenen Brief:
»Zwar begrüße ich es sehr, wenn Sie dazu beitragen möchten, dass der moderne Mensch wieder mit der Natur in Einklang kommt […] So sehr ich Ihr Bemühen verstehe und begrüße, […] den Menschen als Geschöpf in der Schöpfung zu sehen, so sehr darf nicht vergessen werden, dass er nach biblischem Verständnis Ebenbild Gottes und Krone der Schöpfung ist. Er darf sich nicht >unter die Natur
Während der zweite Teil des Bauvorhabens in Frankfurt-Heddernheim wegen der unvereinbaren Anschauungen unausgeführt blieb, erfolgte kurz vor Weihnachten 1988 der erste Spatenstich für den Bau der Kindertagesstätte, die am 22. Juni 1995 eröffnet wurde und hundert Kinder aufnahm.
In den letzten Jahren seines Lebens beschäftigte sich Hundertwasser nicht nur in Österreich, Deutschland und der Schweiz, sondern auch in Kalifornien, auf Kuba, in Japan und auf Neuseeland mit zahlreichen Bau- und Umbauprojekten.
Bei Hundertwassers letztem noch zu seinen Lebzeiten fertiggestellten Architekturprojekt handelte es sich ausgerechnet um eine Bedürfnisanstalt in Neuseeland: eine öffentliche Toilette in Kawakawa, die nach seinen Vorgaben in der zweiten Jahreshälfte 1999 saniert, neugestaltet und eröffnet wurde. Die Kacheln mit den Zeichen für »Damen« und »Herren« gab Hundertwasser übrigens bei einem Baukeramikbetrieb in Bad Ems in Auftrag, der auch immer wieder die bunten Verblendungen für die Säulen geliefert hatte.
Nach einem fast zwei Jahre langen Aufenthalt in Neuseeland wollte der inzwischen Einundsiebzigjährige Anfang 2000 nach Europa zurückkehren. So wie er sich in seiner künstlerischen Arbeit an der Langsamkeit des pflanzlichen Wachstums orientierte, setzte er sich auch beim Reisen nicht gern der Hektik des Flugverkehrs aus, sondern zog die Seefahrt vor. Eigentlich wollte er auf einem Frachtschiff reisen, aber schließlich buchte er eine Kabine auf dem Kreuzfahrtschiff »Queen Elizabeth II«. Während der Dampfer am 19. Februar vor Brisbane im Osten Australiens ankerte, starb Friedensreich Hundertwasser an Herzversagen. Seinem letzten Wunsch entsprechend wurde er am 3. März auf seinem Grundstück in Neuseeland unter einem Magnolien-Baum beerdigt, ohne Sarg, nackt in eine von ihm entworfene Fahne mit dem Koru-Symbol gehüllt.
© Dieter Wunderlich 2006
Friedensreich Hundertwasser (Kurzbiografie)