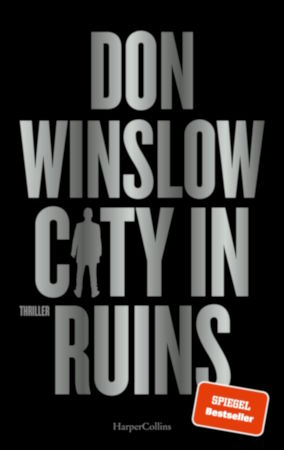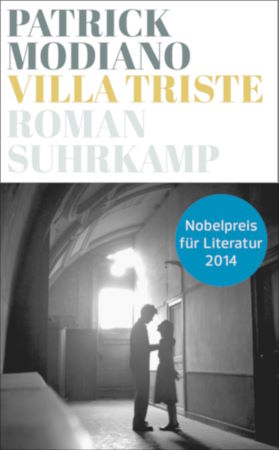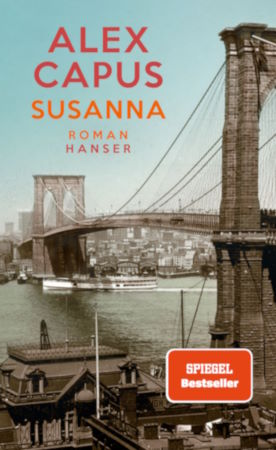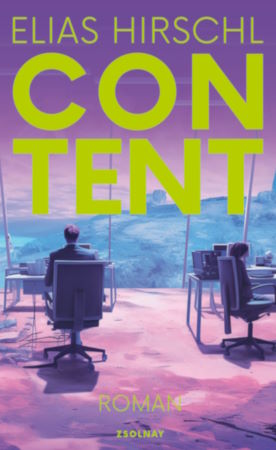Claude Simon : Die Straße in Flandern

Inhaltsangabe
Kritik
Im Mai 1940 irrt der französische Rittmeister de Reixach mit drei weiteren Überlebenden seiner von den Deutschen aufgeriebenen Kavallerieschwadron orientierungslos herum und gerät auf eine Straße in Flandern. Bei dem jungen Dragoner Georges, der uns davon erzählt, handelt es sich um einen Cousin des Rittmeisters: Seine Mutter Sabine war eine geborene de Reixach. Aber Georges macht sich keine Illusionen über den Abstand zwischen ihm und dem Rittmeister:
[…] er hatte die lohfarbene Gesichtshaut von Leuten die immer an frischer Luft sind, eine matte Haut, etwas Arabisches, sicherlich ein Rest von jemandem den Karl Martell zu töten vergessen hatte, sodass er vielleicht behauptete nicht nur von Seiner Kusine der Heiligen Jungfrau abzustammen wie seine Landbarone von Nachbarn am Tarn sondern obendrein wahrscheinlich noch von Mohammed, er sagte Ich glaube dass wir irgendwie Vettern sind, aber für ihn musste dieses auf mich angewandte Wort wohl eher soviel wie Fliege Insekt Mücke bedeuten […] (Seite 71)
Plötzlich läuft ein Kerl auf die abgekämpfte Reitergruppe zu und fleht darum, auf dem ungesattelten fünften Pferd mitreiten zu dürfen (Seite 266f). Georges erlaubt es ihm schließlich, aber da dreht Rittmeister de Reixach sich auf seinem Wallach um und jagt den Mann davon. Im nächsten Augenblick knattert aus dem Gebüsch am Wegrand eine deutsche Maschinenpistole. Rittmeister de Reixach wird mehrfach getroffen und ist – so vermutet Georges (Seite 143) – bereits tot, als er in einem Bewegungsreflex, wie er auch bei einer geköpften Ente beobachtet werden kann, den Säbel zieht.
[…] sein Reflex den Säbel zu ziehen als jene Feuergarbe ihm von hinter der Hecke ins Gesicht spritzte: einen Augenblick habe ich ihn so mit erhobenem Arm jene zwecklose lächerliche Waffe schwingen sehen in der ererbten Geste einer Reiterstatue, einer Haltung die ihm wahrscheinlich Generationen von Haudegen überliefert hatten, eine dunkle Silhouette im Gegenlicht das ihm jede Farbe nahm als ob sein Pferd und er aus einem Guss wären und aus ein und demselben Material, einem grauen Metall, wobei sich die Sonne blitzend an der blanken Klinge spiegelte, dann stürzte das Ganze – Mann Pferd und Säbel – als eine einzige Masse zur Seite wie die Bleifigur eines Reiters zu Ross die von den Hufen her zu schmelzen begonnen hätte, anfangs langsam dann immer schneller auf die Flanke gesunken wäre, und verschwand mit noch immer gezücktem Säbel hinter dem Wrack jenes ausgebrannten Lastwagens der dort zusammengesackt war […] (Seite 73f)
Während der Rittmeister fällt, galoppieren Georges, Wack und Iglésia „flach über den Pferdehals gebeugt“ (Seite 132) davon. Iglésia kriegt einen Streifschuss am rechten Schenkel ab.
[…] ich sah Wack der mich gerade überholt hatte über den Pferdehals gebeugt das Gesicht mir zugewandt auch er mit offenem Mund wahrscheinlich weil er versuchte mir etwas zuzurufen ohne dass er genug Luft hatte um es verständlich zu machen und plötzlich aus seinem Sattel gehoben als ob ein Haken eine unsichtbare Hand ihn an seinem Mantelkragen gepackt und langsam hochgehoben hätte das heißt beinahe unbeweglich im Vergleich mit seinem Pferd (das heißt ungefähr mit der gleichen Geschwindigkeit vorbeifliegend) das weitergaloppierte und ich rannte immer noch wenn auch etwas weniger schnell sodass Wack sein Pferd und ich eine Gruppe von Dingen bildeten zwischen denen die Abstände sich nur allmählich veränderten wobei er sich jetzt genau über dem Pferd befand von dem er gerade hochgehoben emporgerissen worden war sich langsam in die Lüfte hob mit immer noch bogenförmig gekrümmten Beinen als ritte er noch irgendeinen unsichtbaren Pegasus der ihn hinten ausschlagend nach vorn gekippt hätte sodass er ganz langsam und sozusagen auf der Stelle eine Art halsbrecherischen doppelten Salto ausführte der ihn mir bald mit dem Kopf nach unten und immer noch für denselben stummen Schrei (oder Rat den er mir hatte geben wollen) geöffneten Mund zeigte dann in der Luft auf dem Rücken liegend wie jemand in einer Hängematte der seine Beine rechts und links herunterbaumeln lässt dann den Kopf wieder oben den Körper senkrecht während die Beine ihre wie beim Ritt gekrümmte Haltung aufzugeben begannen um sich einander zu nähern und parallel herabzuhängen dann auf dem Bauch mit vorgestreckten Armen und geöffneten Händen als wollte er etwas schnappen ergreifen irgendetwas das noch weit weg war wie ein Zirkusakrobat in dem Moment da er mit nichts mehr verbunden von jeder Schwerkraft befreit zwischen zwei Trapezen schwebt dann schließlich wieder mit dem Kopf nach unten gespreizten Beinen und gekreuzten Armen als wollte er mir den Weg verwehren aber nun unbeweglich an den Böschungshang geklatscht und sich nicht mehr rührend mich mit einem Gesicht anschauend das von Überraschung und Dummheit strotzte ich dachte Armer Wack er hat immer wie ein Idiot ausgesehen aber nun mehr denn je, dann dachte ich nicht mehr, etwas wie ein Berg oder ein Pferd stürzte auf mich warf mich zu Boden trampelte auf mir herum während ich die Zügel aus meinen Händen gleiten fühlte dann war alles finster während Millionen von galoppierenden Pferden weiter über meinen Körper stampften dann spürte ich nicht einmal mehr die Pferde nur noch so etwas wie den Geruch von Äther und die Finsternis und ein Dröhnen in den Ohren und als ich die Augen wieder öffnete lag ich auf dem Weg und kein Pferd mehr und nur noch Wack immer noch auf der Böschung mit dem Kopf nach unten mich anstarrend mit weit geöffneten Augen und seiner entgeisterten Miene aber ich hütete mich wohlweislich mich zu rühren und wartete auf den Moment da ich anfangen würde zu leiden denn ich hatte sagen hören dass die schweren Verwundungen zunächst eine Art Betäubung verursachen, aber als ich immer noch nichts spürte und nach einer Weile versuchte mich zu bewegen ohne dass etwas geschah, und es mir gelang mich auf alle Viere zu erheben den Kopf in der Verlängerung des Körpers das Gesicht zur Erde gewandt, konnte ich den Boden des beschotterten Wegs sehen […] (Seite 203ff)
Das Bild des Rittmeisters, der im Tod sein Schwert zieht, hat Georges von da an immer wieder vor Augen. Er nimmt an, dass de Reixach absichtlich in den Tod ritt, weil er den Krieg für verloren hielt, vor allem aber wegen seiner persönlichen Schmach. Vier Jahre vor seinem Tod hatte der damals Achtunddreißigjährige „in einem entrüsteten Geraune und Geflüster rund um Teetassen“ (Seite 115f) ein zwanzig Jahre jüngeres Mädchen namens Corinne geheiratet. Vermutlich hatte er bereits bei der Eheschließung geahnt, was auf ihn zukommen würde, aber die Passion auf sich genommen, deren Altar die „sanfte weiche schwindelerregende buschige verborgene Höhle des Fleisches“ war (Seite 74).
Das erinnert Georges an eine von seiner Mutter erzählte Familienlegende, derzufolge einer ihrer Vorfahren, dem Hörner aufgesetzt worden waren, sich eine Kugel in den Kopf geschossen hatte. Splitternackt sei die Leiche gewesen sein, heißt es. Aber vielleicht handelt es sich dabei auch nur um eine von den Domestiken verbreitete üble Nachrede. Jedenfalls malte Georges sich schon als Junge die Szene aus: De Reixach saß ab, warf seinem Jockei die Zügel zu und eilte die Freitreppe hinauf. Seine Frau Agnès hörte ihn kommen, fuhr „wie von der Tarantel gestochen“ (Seite 239) im Bett hoch …
[…] schob den Liebhaber – den Kutscher, den Stallknecht, den entgeisterten Grobian – an den Schultern auf das unausbleibliche und providentielle Geheimgemach oder Käfterchen der Schwänke und Dramen zu, das immer zur rechten Zeit da ist […] (Seite 239)
Da rüttelte auch schon ihr Mann an der verschlossenen Schlafzimmertür, und weil sie nicht gleich öffnete – sie musste noch einen herumliegenden Schuh ihres Liebhabers verstecken –, brach er sie auf. Agnès stand im Nachthemd da …
[…] kindlich, unschuldig, entwaffnend, sich die Augen reibend, lächelnd, ihm die Arme entgegenstreckend, ihm erklärend dass sie sich aus Angst vor Dieben einschließt während sie sich an ihn drängt, ihn umschlingt, ihn umhüllt, wobei das Hemd zufällig über ihre Schultern gleitet und ihre Brüste entblößt deren zarte wunde Spitzen sie an ihn drückt, an dem staubigen Waffenrock reibt den sie schon mit ihren fiebrigen Händen aufzuhaken beginnt, wobei sie Mund an Mund mit ihm spricht um zu verhindern dass er ihre unter den Küssen eines anderen angeschwollenen Lippen sieht […] (Seite 240)
De Reixach war bereits entkleidet, da bemerkte er das wollüstige Durcheinander des Betts oder hörte ein Geräusch – vielleicht war es auch nur sein Instinkt –, jedenfalls ging er mit festen Schritten auf das Käfterchen zu …
[…] öffnete die Tür und bekam dann mitten in die Birne den aus nächster Nähe abgefeuerten Pistolenschuss […] (Seite 241)
Bevor die anderen Domestiken herbeieilten, drückten Agnès und ihr Liebhaber dem Toten die rauchende Pistole in die Hand, damit es wie Selbstmord aussah. Georges sieht das Bild vor sich, das sich den Hausangestellten bot:
[…] vielleicht einen umgeworfenen Sessel, einen umgeworfenen Tisch, und die Kleider, wie die eines ungeduldigen Liebhabers, hastig, in fieberhafter Eile vom Leibe gerissen und hier und dort hingeworfen, und diese Mannesleiche von zarter, fast femininer Konstitution, die ungeheuer und ungehörig dort ausgestreckt lag, die sich bewegenden Schatten des Kerzenlichts die auf der weißen durchscheinenden elfenbeinfarbenen oder eher bläulichen Haut spielten und in der Mitte das struppige Büschel, der dunkle, wirre, graubraune Fleck und das fragile Glied einer liegenden Statue, das dicht über dem Schenkel die Leiste verdeckte […] (Seite 141f)
Georges und Iglésias geraten nach dem Überfall auf der Straße in Flandern in deutsche Kriegsgefangenschaft und werden nach Sachsen in ein Lager gebracht. Stück für Stück erzählt Iglésias seinem Kameraden, was er vor dem Krieg mit Rittmeister de Reixach und dessen junger Frau Corinne erlebte.
Aus einer Laune heraus hatte Corinne ihren Mann dazu gebracht, einen Rennstall neu zu gründen und einen Jockei einzustellen. So kam Iglésias auf ihr Gut. Als er Corinne zum erstenmal sah, hielt er sie für ein Mädchen, das de Reixach sonntags aus dem Pensionat geholt hatte und aus väterlicher Schwäche wie eine Frau angezogen hatte.
Eines Tages, als Iglésias im Stall die Beine eines Rennpferdes einseifte und massierte, tauchte Corinne unvermittelt hinter ihm auf.
[…] und plötzlich, auf den nassen Pflastersteinen nahebei der Schatten von ihr, sie in einem jener hellen einfachen Morgenkleider, oder aber vielleicht im Reitdress, ebenfalls gestiefelt, mit der Reitpeitsche eines ihrer Beine klopfend, und er in der Hocke verharrend, ohne sich umzudrehen, weiter die kranke Sehne massierend bis sie ihn anspricht, und sich dann erhebend, wieder vor ihr stehend, mit leicht nach vorn gebeugtem Oberkörper und bis zu den Ellbogen seifigen Armen […] und also kaum die Rede von Liebe, es sei denn, dass gerade die Liebe – oder besser die Leidenschaft – eben dies ist: dieses Stummsein, diese plötzliche Begeisterung, dieser Widerwille, dieser Hass, alles unformuliert – und sogar ungeformt –, und also diese bloße Folge von Gesten, Worten, belanglosen Szenen, und, mitten darin, ohne Umschweife, der dringende, hastige Ansturm, das unbändige Leib an Leib, ganz gleich wo, vielleicht sogar im Stall, auf einem Strohballen, sie mit hochgerafften Röcken, ihren Strümpen, ihren Strumpfhaltern, das kurze Blitzen der blendend weißen Haut der Schenkel, beide keuchend, außer sich, wahrscheinlich voller Angst überrascht zu werden […] (Seite 109f)
Zwar hatten Corinne und Iglésia den Ehebruch nur einmal vollzogen, aber vielleicht ahnte de Reixach etwas. Als er in den Krieg zog, richtete er es durch seine Beziehungen so ein, dass er Iglésia als Burschen zugeteilt bekam.
Georges ist von Iglésias Schilderungen so fasziniert, dass er nach dem Krieg die inzwischen wieder verheiratete Corinne aufsucht.
[…] und sie sagte: was soll denn … Was wollen Sie …, und wie es schien ebenso unfähig ihren Satz zu beenden wie sich zu rühren, nur immer schneller atmend, beinahe keuchend, wobei sie ihn weiter mit einem Ausdruck des Entsetzens, der Ohnmacht anstarrte […] und sie sagte: Ich bitte sie Mein Mann kann heimkommen Ich bitte Sie lassen Sie mich Hören Sie auf, aber sie rührte sich immer noch nicht, atmete hörbar und wiederholte mit monotoner, automatischer, erschreckter Stimme: Ich bitte Sie Seien sie vernünftig Ich bitte Sie Ich bitte Sie […] (Seite 274)
„Die Straße in Flandern“ trägt zweifellos autobiografische Züge: Claude Simon verarbeitete in dem Roman offenbar auch ein eigenes traumatisches Kriegserlebnis. Ohne moralischen Appell, aber mit besonderer Eindringlichkeit inszenierte er die Abscheulichkeit des Krieges und reduzierte die Erotik auf Betrug und Dominanz.
„Eine tragische Weltsicht tritt hier zutage: Hinter seinem Streben nach Gemeinschaft und Intimität verbirgt der Mensch ein Meer von egoistischen Trieben und zerstörerischen Leidenschaften.“
(Lars Gyllensten in seiner Rede am 10. Dezember 1985 anlässlich der Verleihung des Nobelpreises an Claude Simon)
In seiner Nobelrede am 10. Dezember 1985 setzte Claude Simon sich mit dem Vorwurf auseinander, seine Werke seien „schwierig, langweilig, unlesbar oder wirr“ und „hätten weder Anfang noch Ende“. Tatsächlich setzt die Lektüre seines grandiosen Romans „Die Straße nach Flandern“ beim Leser Geduld, Aufmerksamkeit und Intelligenz voraus, denn Claude Simon sprengt die gewohnte Erzählweise des Realismus: Da wird nicht der Reihe nach von Ereignissen erzählt, die sich in der Wirklichkeit zugetragen haben sollen. Statt linear und chronologisch zu erzählen, zerlegt Claude Simon die Handlung in Fragmente und montiert diese kunstvoll zusammen, wobei es auch vorkommt, dass eine Szene mitten im Satz durch eine Analogie oder Assoziation nahtlos in eine ganz andere übergeht, beispielsweise die Liebesszene zwischen Georges und Corinne in ein Kriegserlebnis (Seite 275f). Einige Motive wie der Tod des Rittmeisters werden mehrmals wiederholt. Obwohl Claude Simon die Raum- und Zeitdimensionen ignoriert, wirkt der Roman „Die Straße nach Flandern“ keineswegs beliebig, sondern streng komponiert.
„Um Ihre Romane zu charakterisieren, müsste man gleichzeitig Maler und Dichter sein.“
(Lars Gyllensten a. a. O.)
Von Anfang an versuchte Claude Simon nicht, die Wirklichkeit abzubilden, sondern er wollte immer schon etwas machen (im Sinne von erschaffen). Trotzdem bestechen einzelne Szenen in „Die Straße in Flandern“, bei denen es sich um flüchtige Wahrnehmungen zu handeln scheint, gerade durch die atemberaubende Schärfe, in der Claude Simon sie sozusagen wie in einem Kinofilm hyperrealistisch in Zeitlupe ablaufen lässt.
Zu dieser zirkulären Komposition passen die labyrinthartigen Sätze, die sich ohne Kapiteleinteilung absatzlos und fast ohne Interpunktion nicht selten über mehrere Seiten auftürmen und die Szenen nach und nach wie das Bild in einem Fernglas „scharfstellen“.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2004
Textauszüge in der Übersetzung von Elmar Tophoven: © Piper
Die Seitenangaben beziehen sich auf Band 80 der Buchreihe
„Nobelpreis für Literatur“ des Coron-Verlags, Zürich.
Claude Simon (Kurzbiografie)