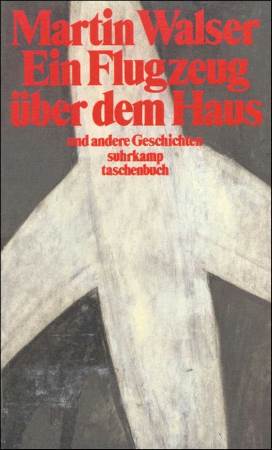Andrzej Stasiuk : Die Welt hinter Dukla

Inhaltsangabe
Kritik
Dukla ist ein Dorf im Süden Polens, am Rand der Karpaten.
Im Wörterbuch bedeutet „Dukla“ – „kleiner Schacht zur Erkundung und zur Suche nach einer Lagerstätte, als Belüftungsöffnung oder zur primitiven Erzgewinnung.“ (Seite 51)
Also das Vergrößerungsglas Dukla, das Loch in der Erde, in Körper und Zeit. (Seite 70)
Hier wuchs der Ich-Erzähler in den Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts auf. Sein Großvater war Feuerwehrmann und Dorfschulze in Dukla. Als Erwachsener kehrt er immer wieder zurück, allein oder mit einem Freund, selten mit dem Auto, meistens mit Bahn und Bus.
Ich komme immer wieder in dieses Dukla zurück, um es bei unterschiedlichem Licht, zu unterschiedlichen Tageszeiten anzusehen. (Seite 14)
Wenn ich also auf Dukla zurückkomme, scheren mich nicht die Postkutschen und die Juden und alles übrige. Mich interessiert nur, ob die Zeit ein Einweg-Artikel ist wie, sagen wir, das Hygienetaschentuch Povela Corner aus Tarnów. Nur das. (Seite 55)
Aber eigentlich wollte ich über Dukla …
Seit ein paar Jahren versuche ich herauszufinden, worauf seine seltsame Kraft beruht. Meine Gedanken eilen früher oder später hierhin, als sollten sie in dieser Handvoll Straßen Befriedigung finden, aber im Grunde hängen sie in der Luft […]
Also Dukla als Memento, als mentales Loch in der Seele, als fälschungssicherer Schlüssel, mit den flimmrigen Federn der Realität sich schmückender Geist. Dukla, Gegenstand einer Litanei, Dukla mit dem vermoderten Leib der Amalia anstelle des Herzens, Dukla voll von Raum, in dem Bilder ausgebrütet werden und die Vergangenheit dich überfällt und die Zukunft dich nichts mehr angeht, und ich könnte bis zum Dösigwerden auf der Westseite des Marktes sitzen, bis zur endgültigen Demenz, wie ein Dorftrottel, ein Weichsel-Buddhist, ein abgeworfener, aus allen Wolken gefallener Herzbube, ein Säufer vor dem Kneipenfenster, in dem sich die Weltwunder und die dümmsten Gedanken zeigen, von deren Existenz man noch vor einer Stunde nichts ahnte […] (Seite 81)
In Dukla sucht der Erzähler nach Spuren der Vergangenheit und erinnert sich bruchstückhaft an frühere Erlebnisse.
Jetzt versuche ich, das alles in eine Reihenfolge zu bringen, obwohl ich mich nur an Bruchstücke erinnere, an Abdrücke von Dingen in jenem Raum schließlich nicht an die Dinge selbst mit ihrer unwiederholbaren Struktur aus Kratzern, Rissen und Falten. Was mich jetzt erreicht, sind nur ihre Spuren, Phantome des Bezeichneten, aufgehalten auf halbem Wege zwischen Existenz und Benennung. Sie ähneln nach dem Tode retuschierten Fotos. (Seite 78)
Mit dreizehn verliebte er sich in ein Mädchen, das in Dukla die Ferien verbrachte. Samstags, wenn Tanz in Dukla war, tanzte sie ohne Partner selbstvergessen im kurzen weißen Kleid, und der Autor schaute ihr hingerissen zu, hörte eine alte Frau „Flittchen“ sagen. Immer wieder schlich er an dem Ferienhäuschen vorbei, in dem sie wohnte. Er dachte schon, sie sei abgereist, aber dann hingen ihr weißes Kleid und ein weißer Slip auf der Wäscheleine. In dem vom Wind geblähten Slip stellte er sich ihren Körper vor.
Ich war dreizehn und begriff kaum etwas. Ich spürte nur, dass meine Liebe von einem Augenblick auf den anderen kein unschuldiges und verschämtes Spiel mehr war und etwas Verbotenes wurde. Ich war dreizehn und spürte, dass die Schönheit immer eine Drohung enthält, dass sie im Grunde eine Abart des Bösen ist, eine Abart, die wir ebenso sehr begehren können, wie wir das Gute begehren. (Seite 43f)
Eines Tages hatte er Durst und betrat einen Betonbunker, in dem es Waschbecken und Duschen gab, um Wasser zu trinken. In einer der Duschen rauschte Wasser. Dann vernahm er ihre Stimme. Sie rief: „Kryska! Gib mit das Handtuch!“ Kryska war wohl die dürre Begleiterin, mit der er sie mehrmals gesehen hatte. Er nahm ein zerknüllt in einem Waschbecken liegendes Handtuch, ging zu der Dusche und zog den Plastikvorhang auf. „Du läufst mir nach“, sagte sie und nahm das Handtuch. Sie schob eine Hand in seinen Nacken, aber in diesem Augenblick hörten sie das Klappern von Holzschuhen. Da zog sie ihre Hand zurück, und der Erzähler rannte davon.
Kurze Zeit später reiste sie ab.
Bei einem anderen Besuch in Dukla erinnert sich der Autor an seine Großmutter.
Da fällt mir meine Großmutter ein, die an Geister glaubte. Sie sah oft welche. Das Haus stand in einem alten Obstgarten am Ende des Dorfes. Sie erzählte von ihren Erscheinungen völlig ruhig und selbstverständlich. Sie kamen am Tage oder in der Nacht, öffneten ganz normal die Tür und gingen in die Küche. Sie überraschten sie bei ihren täglichen Geschäften im Hof oder in der Küche. Sie waren ziemlich menschlich, wenn auch aus einer etwas leichteren Substanz. Meistens ähnelten sie jemandem aus der Familie. Alle glaubten diese Erzählungen. Ich auch […] In Großmutters Erzählungen berührte sich die Welt der übernatürlichen Wesen niemals mit der Welt der Heiligen, der Kirche oder dem Ritus. Die erste gehörte zum Alltag, die zweite diente als Zeitmaß, als Gegenstand der Fürbitte und sonntäglichen Muße […] Ich mochte meine Großmutter sehr. Sie war eine heitere, pragmatische Frau ohne eine Spur von Frömmelei und religiösem Wahn, ohne mystische Neigungen. (Seite 107f)
Als die Großmutter starb, war er gar nicht traurig, denn er nahm an, dass sie zwar ihre Gestalt auf dem Bett zurückgelassen hatte, aber als Geist weiter existierte und in der Nähe blieb. Entsetzt reagierte er nicht auf die Leiche, sondern erst auf die schwarze im Wind flatternde Trauerfahne.
Die Geschichte von Wasyl Padwa fällt ihm ein: Der hütete die Kühe der LPG und sparte sich jeden Groschen vom Mund ab, weil er davon träumte, ein reicher Mann zu werden. Bei einem Gewitter gingen seine im Heuschober versteckten Ersparnisse jedoch in Flammen auf, und er fing wieder von vorn an. Diesmal nahm er keine Scheine, sondern Münzen. Die verschloss er in Einmachgläsern und versteckte sie im Bach, aber bei einer Überschwemmung riss das Wasser alles fort. Danach vergrub Wasyl Padwa seinen Schatz im Wald, doch jemand fand das Geld und raubte es. Da gab Wasyl Padwa das Sparen auf.
Die Bewohner von Dukla leben noch weitgehend wie in alten Zeiten. Mitte der Neunzigerjahre beobachtet der Autor jedoch besorgt, dass immer mehr Touristen aus dem Westen nach Dukla kommen.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Die Frauen tragen Plastiktüten. Sie kommen in Kniestrümpfen, Latschen und Sandalen. Sie steigen aus Bussen, bilden dichtgedrängte Herden, ziehen in Richtung Marktplatz […] Die Händler breiten ihre Ware aus. An der Maria Magdalena bekommt man fluoreszierende Rosenkränze, phosphoreszierende Gottesmütter, ein ägyptisch-chaldäisches Traumbuch, und an der Parkowa-Straße wird Fleisch am Rost gebraten […] Der Tag glitscht über die Oberfläche der Zeit. (Seite 97)
„Es wird keine Handlung geben, keine Geschichte“, versichert Andrzej Stasiuk auf der zweiten Seite seines Romans „Die Welt hinter Dukla“ und bekräftigt es zwei Seiten später: „Es wird keine Handlung geben mit ihrem Versprechen eines Anfangs und der Hoffnung auf ein Ende.“ Tatsächlich handelt es sich bei „Die Welt hinter Dukla“ um eine Sammlung von Episoden, Beobachtungen und Beschreibungen. Die Erinnerungen lassen sich nur in Einzelfällen chronologisch einordnen, und das ist auch nicht nötig, denn Gegenwart und Vergangenheit sind in „Die Welt hinter Dukla“ nicht klar geschieden, und die Miniaturen fügen sich auch so zu einem poetischen Ganzen.
Eigentlich tue ich nichts, als die eigene Physiologie zu beschreiben. Die Veränderungen des elektrischen Feldes auf der Netzhaut, Temperaturschwankungen, die unterschiedliche Konzentration von Geruchspartikeln in der Luft, das Oszillieren der Schallwellenfrequenz. Daraus setzt sich die Welt zusammen. Alles übrige ist formalisierter Wahnsinn oder die Geschichte der Menschheit. Und wenn ich so gegenüber der Post von Dukla stehe, eine Zigarette rauche und den breitschultrigen Typen mit Spiegelreflexkamera zusehe, kommt mir der Gedanke, dass das Sein Fiktion sein muss, wenn wir überhaupt eine Chance haben sollen. (Seite 101)
Der Text ist in drei mit römischen Zahlen überschriebene Kapitel gegliedert. Von Seite 115 an fließen die Bilder und Beschreibungen nicht mehr, sondern Andrzej Stasiuk reiht unvermittelt einzelne mit Überschriften versehene Aufsätze aneinander: Wasyl Padwa, Sonntag, Frühlingsfest usw. Dieser Bruch zerstört die Form des Romans.
Einige Metaphern sind besonders schwülstig. Der erste Satz lautet beispielsweise:
Um vier Uhr früh hebt die Nacht langsam ihren schwarzen Hintern, steht vollgefressen vom Tisch auf und geht schlafen. (Seite 5)
Zu der teilweise pathetischen Sprache passen Vulgärausdrücke wie „pinkeln“ und „Polypen“ (für Polizisten) überhaupt nicht. (In direkter Rede wäre nichts dagegen einzuwenden; da steht hier übrigens „Bullen“ für Polizisten.) Ärgerlich sind auch Sprachschnitzer in der deutschen Übersetzung wie dieser:
Dann starb meine Großmutter. Ich wachte im Nebenzimmer auf, und die Tanten, die bei ihr wachten, sagten zu mir: „Du hast keine Oma mehr.“ (Seite 109)
Andrzej Stasiuk wurde am 25. September 1960 in Warschau geboren. 1980 musste er zur polnischen Armee, aber er desertierte nach einem dreiviertel Jahr und wurde deshalb zu einer Haftstrafe verurteilt. 1992 veröffentlichte er unter dem Titel „Mury Hebronu“ („Die Mauern von Hebron“) einen ersten Band mit Erzählungen. Zwei Jahre später folgte „Wiersze milosne i nie“ („Nicht nur Liebesgedichte“); 1995 erschienen „Opowiesci Galicyjskie“ („Galizische Erzählungen“) und der Roman „Bialy Kruk“ („Der weiße Rabe“), 1996 der Erzählband „Przez rzeke“ („Über den Fluss“).
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2007
Textauszüge: © Suhrkamp Verlag. – Seitenangaben
beziehen sich auf die Ausgabe der Süddeutschen Zeitung.