V. S. Naipaul : An der Biegung des großen Flusses
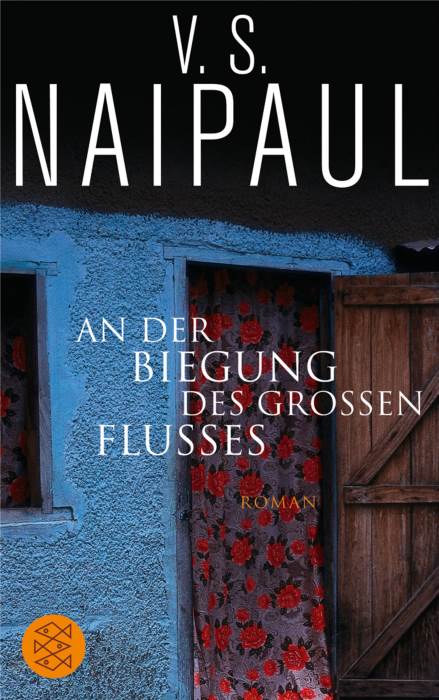
Inhaltsangabe
Kritik
Der Muslim Salim wurde 1940 geboren. Seine aus Indien stammende Familie wohnt seit vielen Generationen an der afrikanischen Ostküste, wo Afrika „nicht wirklich afrikanisch, sondern arabisch, indisch, persisch, portugiesisch“ ist. Die Menschen dort sind „ein Volk des Indischen Ozeans“, aber sie fühlen sich auch als „ein Volk Afrikas“. In dieser Gesellschaftsordnung bilden sich die Sklaven auf ihre Verbindung mit einer angesehenen Familie viel ein: „Zu Leuten, die sie als unbedeutender als die Familie einschätzten, konnten sie sehr unfreundlich sein.“
Salims Freund heißt Indar. Dessen Großvater kam als Eisenbahnarbeiter aus dem Pandschab, und als der Arbeitsvertrag abgelaufen war, begann er an Händler auf dem Markt Geld zu verleihen: „Für zehn Schilling, die in der einen Woche verliehen wurde, musste man in der nächsten zwölf oder fünfzehn zurückzahlen“. Das war kein vornehmes, aber ein sehr einträgliches Geschäft, und die Familie wurde reich. Als Indar zum Studium nach Europa reist, beneidet ihn Salim.
Auch Salim will weg. Briefmarken der britischen Verwaltung haben ihm die Augen dafür geöffnet, dass die Ordnung, in die er hineingeboren wurde, „zurückgeblieben“ ist. Das hat ihn verunsichert. In einer ehemaligen zentralafrikanischen Kolonie brach unmittelbar nach der Erringung der Unabhängigkeit ein Bürgerkrieg aus. Der Inder Nazruddin, der dort gewohnt hatte, floh mit seiner Familie nach Uganda. Als die Gewalttätigkeiten in der neuen afrikanischen Republik nachlassen, kauft Salim um wenig Geld den Laden in der Stadt „an der Biegung des großen Flusses“, den Nazruddin zurückgelassen hatte. Zwei Jahre nach seinem Freund verlässt auch Salim seine Heimat. Eine Woche dauert die Fahrt im Peugeot von der Ostküste an den Ort, wo Salim voller Zuversicht ein neues Leben anfangen will.
Nazruddin gibt ihm einen guten Rat mit:
„Ein Geschäftsmann ist kein Mathematiker. Denk daran. Lass dich nie von der Schönheit der Zahlen hypnotisieren. Ein Geschäftsmann ist jemand, der bei zehn kauft und froh ist, bei zwölf herauszukommen. Einer von der anderen Sorte kauft bei zehn, sieht den Wert auf achtzehn steigen und tut nichts. Er wartet, dass er auf zwanzig klettert. Die Schönheit der Zahlen. Wenn er wieder auf zehn fällt, wartet er darauf, dass er wieder auf achtzehn steigt. Wenn der Wert auf zwei fällt, wartet er, dass er wieder auf zehn steigt. Das passiert auch. Aber er hat ein Viertel seines Lebens verschwendet. Und alles, was er aus seinem Geld herausgeholt hat, ist ein bisschen mathematische Erregung.“
Der Laden ist einer der ortsüblichen Betonkästen. Schreibhefte, Bleistifte, Rasierklingen, Seife, Zahnpasta, Stoff, Eisentöpfe, emaillierte Teller und andere Waren sind am Boden ausgebreitet. Salim hat auch den Lagerbestand übernommen, aber davon ist nichts mehr vorhanden. Weil viele Afrikaner die Stadt verließen und in den Busch zu ihrer traditionellen Lebensweise zurückkehrten, kann Salim für wenig Geld eine Wohnung kaufen.
Bald darauf erheben sich die Afrikaner an der Ostküste gegen die Zugewanderten („Männer fast so afrikanisch wie ihre Diener“ ). Nach den blutigen Unruhen ist für Familien wie die von Salim oder Indar kein Platz mehr. Die Überlebenden zerstreuen sich, nur die Alten bleiben. Die Sklaven, die wie Kletten auf ihrem Status beharren, werden auf Familienangehörige verteilt. Salim hat sich um einen Sklaven zu kümmern, der nur drei oder vier Jahre jünger ist als er selbst. An der Ostküste riefen sie ihn Ali, aber hier in Zentralafrika nennt Salim ihn Metty.
Eine der ersten regelmäßigen Kunden Salims ist Zabeth, eine Händlerin aus einem 60 Meilen entfernten Fischerdorf, die regelmäßig in die Stadt kommt, um für sich und die anderen Dorfbewohner einzukaufen. Sie kann weder lesen noch schreiben; die Einkaufsliste hat sie im Kopf. Sie zahlt mit Bargeld, das sie in einem Kosmetikkoffer bei sich trägt. Eines Tages bringt Zabeth ihren 15 oder 16 Jahre alten Sohn Ferdinand mit. Er soll das aus der Kolonialzeit stammende Lyzeum in der Stadt besuchen, und sie bittet ihren Geschäftspartner Salim, auf den Jungen aufzupassen.
Metty und Ferdinand freunden sich an und stellen den Mädchen nach. Salim muss dagegen darauf achten, nicht mit einer afrikanischen Frau ertappt zu werden, denn damit würde er das Ansehen seiner Familie beeinträchtigen und Metty verärgern. „Ich war es — als Herr des einen und Beschützer des anderen –, der sich verstecken musste.“
Die Menschen in diesem Land wurden oft missbraucht, nicht nur von Europäern und Arabern, sondern auch von anderen Afrikanern. Sie trauen niemandem, auch nicht der neuen Regierung. Wieder führen Rebellen einen Krieg gegen die Armee. Salim packt die zwei, drei Kilogramm Gold, seine Dokumente, seinen britischen Pass in eine Kiste und vergräbt sie vor dem Haus.
Einer der Lehrer am Lyzeum ist der etwa 40 Jahre alte absonderliche Pater Huismans, der als Kenner kultischer Schnitzereien gilt. Dieser Europäer sammelt Holzmasken, um sie in einer Art Museum aufzubewahren. Für die aktuelle Lage der Afrikaner interessiert er sich kaum. Nach dem neuen Bürgerkrieg wird er während einer Reise ermordet.
Solange er lebte und die Kunstwerke Afrikas sammelte, war Pater Huismans als Freund Afrikas betrachtet worden. Aber das änderte sich jetzt. Man empfand die Sammlung als Beleidigung für die afrikanische Religion …
Salim befreundet sich mit dem Inder Mahesh und dessen Frau Shoba, die ihn regelmäßig zum Essen einladen. Das Paar kam vor fast zehn Jahren ebenfalls von der Ostküste. Mahesh hatte dort ein Motorradgeschäft betrieben. Als man ihn mit Shoba ertappte, wurde er von ihren Brüdern verprügelt. Shoba drohten sie, das Gesicht mit Säure zu zerstören. Deshalb flohen Mahesh und Shoba ins Landesinnere. Noch immer befürchtet Shoba, ihre Brüder könnten kommen oder jemand schicken.
Mahesh warnt Salim: „Es ist nicht so, als gäbe es hier kein Recht oder Unrecht. Es gibt kein Recht.“ Sein Wahlspruch lautet: „Wir machen weiter!“ Er schafft es, die Konzession für ein Hamburger-Restaurant zu bekommen. Die Einrichtung wird aus den USA geliefert. Er steckt seinen einheimischen Diener Ildephonse in eine „Bigburger“-Uniform und stellt ihn als Verkäufer hinter die Theke. Ildephonse ist stolz auf seine neue Aufgabe, bemüht, schnell, freundlich.
Aber sobald man ihn allein ließ, wurde er ein anderer Mensch. Er wurde geistesabwesend. Nicht frech, einfach geistesabwesend. Diese Veränderung beobachtete ich auch bei afrikanischen Angestellten anderswo. Man bekam das Gefühl, dass sie nur für ihre Arbeitgeber auftraten, während sie ihre Arbeiten in den verschiedenen schillernden Umgebungen verrichteten; dass die Arbeit selbst ihnen egal war; und dass sie Talent dafür hatten, sich geistig von ihrer Umgebung, ihrer Arbeit, ihrer Uniform zu lösen, wenn sie allein waren und für niemanden schauspielern konnten.
Außerhalb der Stadt lässt der neue Präsident — den die Menschen hier nur den Großen Mann nennen — für viel Geld eine Staatsdomäne errichten. Er sorgt dafür, dass europäische Zeitschriften darüber berichten und will auf diese Weise demonstrieren, dass aus den Afrikanern in seinem Land moderne Menschen geworden sind. Zunächst ist die Domäne als landwirtschaftlicher Vorzeigebetrieb geplant, aber daraus wird nichts, und die sechs von einer ausländischen Regierung gestifteten Traktoren bleiben in einer ordentlichen Reihe stehen und verrosten. In den rasch hochgezogenen Gebäuden beginnt es bald zu bröckeln. Neu gepflanzte Bäume sterben ab. Dann wird aus der Domäne ein Universitätskampus, Polytechnikum und Forschungszentrum mit Dozenten und Professoren aus der Hauptstadt und aus anderen Ländern.
Ferdinand erhält nach dem Abschluss des Lyzeums ein Regierungsstipendium für den Besuch des Polytechnikums.
Man nahm einen Jungen aus dem Busch und brachte ihm Lesen und Schreiben bei; man walzte den Busch nieder und baute ein Polytechnikum und schickte ihn dorthin. Alles war so leicht, wenn man spät auf die Welt kam und alles schon gebrauchsfertig vorfand, was andere erst nach langer Zeit erreicht hatten — Schreiben, Drucken, Universitäten, Bücher, Wissen. Wir anderen mussten alles schrittweise nehmen.
Eines Tages erfährt Salim, dass Metty ein Kind hat. Er ist schockiert darüber, dass sein Diener ohne sein Wissen ein Eigenleben führt und stellt ihn zur Rede. „Sie ist nur eine afrikanische Frau. Ich verlasse sie“, beteuert Metty, aber Salim mahnt ihn, er habe Verantwortung für die Frau und das Kind.
Sechs Jahre lebt Salim schon in der Stadt „an der Biegung des großen Flusses“, da taucht plötzlich sein früherer Freund Indar auf. Indar wohnt als Gast der Regierung in der Staatsdomäne. Er macht Salim auch mit Raymond, dem Leiter der Domäne, und dessen Frau Yvette bekannt.
Der knapp 60-jährige Europäer Raymond war Lehrer in der Hauptstadt des zentralafrikanischen Staates, als ihn ein Zimmermädchen des Hotels um Rat fragte. Was sollte aus ihrem Sohn werden? Raymond riet ihm, in die Armee einzutreten, um etwas über Menschen zu lernen: „Wenn du einmal verstanden hast, was die Armee zusammenhält, verstehst du auch, was das Land zusammenhält.“ Der junge Mann befolgte den Rat, wurde schließlich Staatspräsident und stellte Raymond als Berater ein. Mit einer offiziellen Delegation reiste Raymond nach Brüssel und hielt einen Vortrag in der Universität. Yvette — sie ist dreißig Jahre jünger als ihr Mann — war damals noch Studentin und schrieb an einer Arbeit über die Sklaverei in der französisch-sprachigen afrikanischen Literatur. Sie stellte dem Redner eine Frage. Dann trafen sie sich, lernten sich näher kennen und heirateten.
Salim, der keine Erotik, sondern nur die sexuelle Befriedigung mit Prostituierten kennt, ist hingerissen von der etwa gleichaltrigen Europäerin.
Als Ferdinand in einer First-Class-Kabine des Dampfers in die Hauptstadt reist, wo er als Beamter ausgebildet werden soll („er hatte Jahrhunderte übersprungen“), verabschieden sich Salim und Yvette am Kai von ihm und gehen dann gemeinsam in die Stadt zurück. Sie essen zusammen. Als Yvette mit in Salims Wohnung kommt, erlebt er erstmals eine leidenschaftliche Frau. Von da an treffen sich die beiden fast jeden Nachmittag und Abend.
Der Grieche Noimon reist plötzlich nach Australien. Vorher hat er alles heimlich verkauft. Das verunsichert die anderen Fremden in der Stadt. Salim weiß: Er hat für zehn gekauft, es auf zwanzig gebracht, aber durch Noimons Weggang ist der Wert seines Geschäftes auf fünfzehn gefallen.
Als Shoba die Nachricht vom Tod ihres Vaters erhält, reist sie trotz ihrer Angst zu ihrer Familie an die Ostküste. Statt nach zwei Monaten kommt sie nach drei Wochen zurück. Sie versteckt sich, und Salim wird nicht mehr zum Essen eingeladen. Erst später erfährt er den Grund: Man hat ihr das Gesicht mit Wasserstoffsuperoxyd verunstaltet.
Als der Präsident die Junge Garde auflöst, kommt es zu neuen Unruhen. Die Beamten wedeln Salim plötzlich mit alten unkorrekten Zollerklärungen wie mit nicht eingelösten Schuldscheinen vor der Nase herum. Die Erpressungen hören wieder auf, als die Rebellen nicht mehr vor Angriffen auf Polizisten und andere Regierungsbeamte zurückschrecken. Jetzt begreift Salim, dass die Beamten diese Entwicklung voraussahen und deshalb zusammenrafften, was möglich war.
Salim, der erlebt hat, wie er der Willkür der Beamten ausgeliefert ist, schämt sich wegen seiner Schwäche vor Yvette. „Ich konnte ihr nicht als Mann, der von anderen Männern gequält und geschwächt wurde, entgegentreten.“ Sie sehen sich seltener. Dann schlägt er sie zusammen. Als sie mit Blutergüssen auf dem Bett liegt, spreizt er ihr die Beine und spuckt ihr solange dazwischen, bis er keinen Speichel mehr hat. Mit diesem Gewaltausbruch meint er eigentlich sich selbst, das Scheitern seiner Illusion, inmitten der von anderen vorgegebenen Bedingungen ein selbstbestimmtes Leben führen zu können.
Nazruddin war vor Unruhen in Uganda nach Kanada geflohen und nach erneuten schlechten Erfahrungen weiter nach England gereist. Salim besucht ihn in London. Erstmals in seinem Leben besteigt er ein Flugzeug. Es fliegt zuerst in östlicher Richtung, bevor es nach Norden abdreht. Schon vor Salims Weggang aus Ostafrika war Nazruddin klar, dass dieser seine Tochter Kareisha heiraten würde. Er ahnt nicht, dass Salim in der Zwischenzeit nichts davon wissen wollte. Wie selbstverständlich wird in London seine Verlobung mit der 30-jährigen Apothekerin gefeiert. Nazruddin erzählt ihm, wie er in Kanada in eine Ölbohrung investierte und dabei um sehr viel Geld betrogen wurde. In London kaufte er ein Kino, und als er es eröffnen wollte, war die Einrichtung gegen eine minderwertige vertauscht, die Heizung komplett abmontiert. Er stellte den Verkäufer zur Rede und hielt ihm die Gepflogenheiten indischer Händler vor Augen. „Wir verhandeln hart, aber wir halten uns an unsere Abmachungen. Wir machen nur mündliche Verträge, aber wir liefern, was wir versprechen. Nicht, weil wir Heilige sind, sondern weil sonst alles zusammenbricht.“ Der Brite zog nur die Schultern hoch. Dann kaufte Nazruddin sechs Wohnungen in London, aber seither sind die Immobilienpreise kräftig gefallen, und mit den Mietern hat er auch viel Ärger.
Indar hält sich ebenfalls in London auf, aber Salim trifft sich nicht mit ihm. Als die Organisation, für die Indar gearbeitet hatte, vor zwei Jahren zusammenbrach, ging er nach New York. Wie gewohnt, stieg er in einem teuren Hotel ab. Dann aber sank er immer weiter herunter und musste in billige Quartiere umziehen. Er soll verbittert sein, erfährt Salim von Kareisha.
Nach einem sechswöchigen Aufenthalt in London fliegt Salim zurück in das zentralafrikanische Land, um sein Geschäft zu verkaufen und mit dem Geld anderswo einen neuen Anfang zu versuchen. Von Metty erfährt er, dass der Präsident vor zwei Wochen eine Radikalisierung befohlen hat. Ausländer wurden enteignet. Salims verstaatlichtes Geschäft wird jetzt von dem „Citoyen“ Théotime verwaltet, einem arbeitsscheuen und alkoholabhängigen Afrikaner, der es sich leisten kann, mehrere Familien in verschiedenen Stadtvierteln zu haben.
Salim wundert sich, wieso Mahesh nach wie vor sein Hamburger-Restaurant führt. Erst jetzt verrät ihm der frühere Freund, dass er nach Noimons Abreise dafür sorgte, dass Ildephonse und ein paar andere Einheimische eine afrikanische Gesellschaft gründeten, die das Restaurant von ihm pachtete und ihn als Geschäftsführer einstellte.
Um Zeit zu gewinnen und seinen verbliebenen Besitz zu Geld machen zu können, lässt sich Salim von Théotime als Geschäftsführer anstellen. Aber es ist nicht einfach, Geld gegen die gesetzlichen Bestimmungen ins Ausland zu schaffen. In seiner Verzweiflung spricht Salim ausländische Besucher an und leiht ihnen einheimisches Geld. Nur ein Drittel der Männer hält sich an die Abmachung, den Betrag später auf sein ausländisches Konto zu überweisen. Er lässt sich auch auf andere riskante Geschäfte ein, beispielsweise den Schwarzhandel mit Elfenbein.
In Mettys Augen wird Salim immer unbedeutender, denn dieser kann ihn nicht einmal vor Théodimes Schikanen schützen: „So kam der alte Vertrag zwischen Metty und mir, der ein Vertrag zwischen seiner und meiner Familie war, zu einem Ende.“
Aus Wut und Enttäuschung verrät Metty der Polizei Salims Versteck. Der Polizeioffizier Prosper findet dort vier Elefantenstoßzähne und verlangt von Salim unverschämt viel Geld. Andernfalls würde er den Vorfall melden. Um Salim zu zermürben, sperrt er ihn ins Gefängnis.
Ferdinand, der es inzwischen zum Regierungsbeauftragten gebracht hat, ordnet seine Freilassung an und rät ihm, den Dampfer zu nehmen. Zum Abschied versichert er Salim, der so gut wie alles verloren hat:
„Sie dürfen nicht denken, es sei nur für Sie schlimm. Es ist für jeden schlimm. Das ist das Schreckliche daran. … Niemand gelangt irgendwohin. Wir fahren alle zur Hölle … Nichts hat einen Sinn. Deshalb ist jeder so außer sich. Jeder will schnell Geld verdienen und weglaufen. Aber wohin? Das treibt die Leute in den Wahnsinn.“
Ferdinand gesteht, dass er selbst zum Narren gemacht wurde.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Vidiadhar Surajprasad Naipaul (1932 – 2018) stammt aus einer indischen Brahmanen-Familie, die Ende des 19. Jahrhunderts nach Trinidad auswanderte. Als 17-Jähriger ging er mit einem Stipendium der Regierung von Trinidad nach Oxford und studierte englische Literatur. Für seine Werke wurde er 2001 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.
Er habe beim Schmökern in der Schulbücherei „den Sinn dieser artifiziellen Erregtheiten“ nicht verstanden, behauptet Naipaul. Detektivgeschichten waren für ihn eine „Lektüre mit einem gewissen Ausmaß an Irreführung, alles nur um eines kleinen Rätsels willen“. Später habe er sich renommierten Autoren zugewandt, aber mit der „Wirklichkeit dieser Menschen“, der „Künstlichkeit der Erzähltechnik“ nichts anfangen können und sich über „den Zweck des ganzen hinkonstruierten Geweses“ gewundert. („Reading & Writing. A Personal Account“; hier: Süddeutsche Zeitung, 11. Dezember 2001) Wen wundert es da, dass Naipaul konventionell, langsam und unspektakulär erzählt?
Westliche Leser können sich die Menschen, ihr Umfeld und das Geschehen aus Mangel an entsprechenden Erfahrungen nicht ohne weiteres vorstellen und sich kaum mit einem der Protagonisten identifizieren. Auf sie wirken Naipauls Romane deshalb ein wenig abstrakt. Die Lektüre spricht mehr den Intellekt als die Gefühle an. Aber gerade weil Naipaul eine uns gewöhnlich nicht zugängliche Welt schildert, sind seine Bücher lesenswert. Hier spricht weder ein Autor, der in einem westlichen Industriestaat aufwuchs, noch ein empörter Betroffener aus der Dritten Welt, sondern ein Mann, der kulturelle Gegensätze in seiner eigenen Biografie durchlebt. Seine Herkunft erlaubt es ihm auch, Kritik beispielsweise an den Afrikanern zu üben, für die man einen Briten sofort beschimpften würde („political correctness“).
In dem komplexen, pessimistischen Roman „An der Biegung des großen Flusses“ geht es um den Zusammenbruch traditioneller Ordnungen, die ihren Mitgliedern Sicherheit und Orientierung boten, in denen es allerdings auch keinen sozialen Aufstieg gab. Ali ist in der alten Ordnung an der afrikanischen Ostküste ein Haussklave, in der Stadt „an der Biegung des großen Flusses“ unter dem Namen Metty eher ein Diener und ein Angestellter, vielleicht sogar ein Freund Salims — doch am Ende kann dieser nicht mehr für ihn sorgen und muss ihn zurücklassen.
Salim, dessen indische Familie seit Generationen in Ostafrika beheimatet ist, scheitert mit seinem Versuch, in Zentralafrika ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen. Er bleibt stets ein einsamer Fremder in dieser Stadt, aus der er schließlich mittellos fliehen muss. Selbst Ferdinand, der Junge aus dem Busch, der in diesem neuen afrikanischen Staat eine Traumkarriere macht und „Jahrhunderte überspringt“, ist am Ende überzeugt: „Wir fahren alle zur Hölle.“
Salims Jugendfreund Indar studiert in England und versucht nach mehreren Rückschlägen immer wieder voll Zuversicht einen Neuanfang, aber er wird mehrmals Opfer der skrupellosen Geschäftemacherei in den westlichen Ländern.
V. S. Naipaul nennt keine Namen, aber es ist leicht durchschaubar, auf wen und was er anspielt. Bei der Stadt „an der Biegung des großen Flusses“ handelt es sich um Kisangani (früher: Stanleyville), die Hauptstadt der Provinz Oberzaire am Kongo. Mit dem zentralafrikanischen Staat meint Naipaul also die am 30. Juni 1960 unabhängig gewordene belgische Kongo-Kolonie Zaire bzw. Demokratische Republik Kongo mit der Hauptstadt Kinshasa (bis 1966: Léopoldville). Die Figur des Präsidenten trägt Züge von Mobutu Sese Seko (1930 – 1997). Mobutu diente 1948 bis 1956 in der belgischen Kolonialarmee und schloss sich 1958 der Kongolesischen Nationalbewegung an, die von Patrice E. Lumumba geführt wurde, der die erste Regierung des unabhängigen Staates bildete und Mobutu zum Stabschef ernannte. Das Amt des Staatspräsidenten übernahm Lumumbas politischer Gegner Joseph Kasawubu. Unmittelbar nach den Unabhängigkeitsfeiern brachen Unruhen aus, in deren Verlauf es auch zu schweren Ausschreitungen gegen Europäer kam. Kasawubu setzte Lumumba am 5. September 1960 mit Mobutus Hilfe ab und riss die Regierungsgewalt an sich, wurde aber selbst fünf Jahre später, am 25. November 1965, von Mobutu entmachtet. Mobutu errichtete ein diktatorisches Regime, das mehrere Rebellenbewegungen niederrang. Laurent-Desiré Kabila, ein Anhänger Lumumbas, hatte 1964 in Kisangani einen eigenen Staat ausgerufen, war aber von der Armee unter Mobutu besiegt worden. Am 8. Oktober 1996 erhob sich Kabila erneut gegen die Zentralregierung, und diesmal setzte er sich gegen Mobutu durch: am 14. März 1997 eroberte seine Rebellenarmee Kisangani, am 17. Mai Kinshasa, und am 29. Mai leistete er seinen Amtseid als Staatschef. Mobutu erlag am 7. September 1997 in Rabat einer Krebserkrankung.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2002
Textauszüge: © Kiepenheuer & Witsch
V. S. Naipaul: In einem freien Land



















