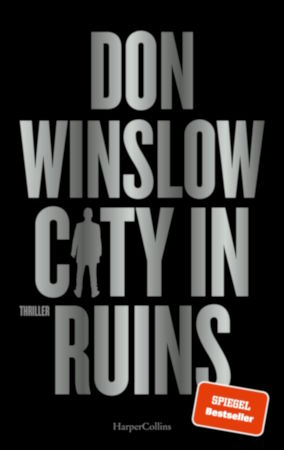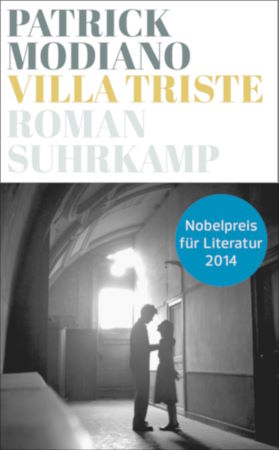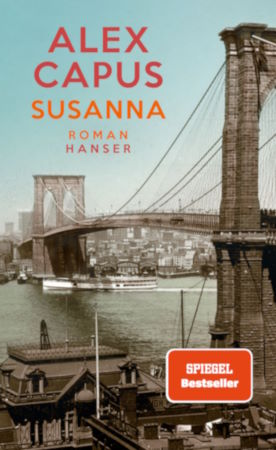Eva Menasse : Vienna
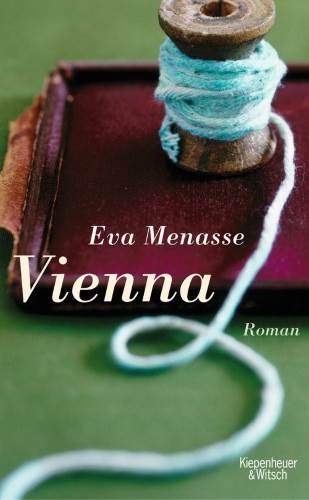
Inhaltsangabe
Kritik
Als die Großmutter der Ich-Erzählerin mit deren Vater schwanger war und die Wehen einsetzten, saß sie noch mit ihren Freundinnen in einem Wiener Kaffeehaus und spielte Bridge. Eigentlich hätte sie das dritte Kind nicht mehr gewollt, aber ihre Versuche, es mit Stricknadeln und Sprüngen vom Tisch abzutreiben, waren fehlgeschlagen.
Mein Onkel, der damals sieben Jahre alt war, erwachte, als das Licht anging. Er schlief auf einem schmalen Sofa, das quer zum Ehebett seiner Eltern an dessen Fußende stand. Er erwachte, weil es plötzlich hell war und weil seine Mutter schrie. Sie lag in ihrem Pelzmantel, einem schwarzen Persianer, quer über dem Ehebett. Mein Großvater schrie auch, aber von der Tür her. Außerdem schrie mein Vater, der, wie es später immer wieder erzählt wurde, einfach herausgerutscht war und den Pelzmantel verdorben hatte.
Mein Vater schrie, weil das für ein Neugeborenes normal ist […]
Meine Großmutter schrie, weil die Hebamme noch nicht da war. Weil das Kind noch an der Nabelschnur hing und alles voll Blut war. (Seite 11f)
Der Persianer war ein Geschenk ihres Mannes. Solche Aufmerksamkeiten halfen ihr, über die zahlreichen Seitensprünge des Wein- und Spirituosenhändlers hinwegzusehen.
Mein Großvater spielte Karten und um Geld, aber vor allem spielte er mit Gelegenheiten, mit Kunden, mit Geschäftsabschlüssen, Lieferterminen und Provisionen, mit Frauen, mit Anspielungen und mit Träumen. Dass man beim Spielen nicht immer gewinnen kann, war ihm ganz klar. (Seite 77)
Wegen Unregelmäßigkeiten in der Geschäftsführung verbüßte er mehrere Gefängnisstrafen, und seine Frau erzählte dann den drei Kindern, er sei auf einer Geschäftsreise.
Bei Tante Gustl handelte es sich um eine der Schwestern des Großvaters. Eines Tages kündigte sie ihrem Vater an, sie werde Adolf („Dolly“) Königsberger („Königsbee“) heiraten.
„Is er a Jud?“, fragte ihr Vater, und er muss der Tante Gustl in diesem Moment herrlich schwach und hilflos erschienen sein. Sie trug den neuen Fuchs mit den blinkenden Äuglein um die Schultern, den der rasend verliebte Verlobte ihr erst kürzlich verehrt hatte, und sie triumphierte, innen wie außen. „Er ist ka Jud, er is a Bankdirektor“, antwortete sie. (Seite 14)
Dolly Königsbee starb früh, aber seine eigenwilligen Redewendungen wurden in der Familie noch lange zitiert:
„Drei Wochen lang hab ich mich kastriert und trotzdem kein Deka abgenommen“, kicherte mein Vater. „In diese Suppe musst dir selbst hineinspucken“, erwiderte prompt meine Mutter. „Das ist doch seine Dämone“, setzte mein Onkel fort. „Ja, ja, aber immer in der Maske des Biedermeiers“, fügte seine Frau, die Tante Ka, hinzu […]
„Der Königsbee war ein Genie“, schloss mein Bruder die hundertmal geübte Familienvorstellung befriedigt, „das hab ich verbal schon immer gesagt und alles andere ist letztlich primär.“ (Seite 34)
Tante Gustls Sohn Ferdinand („Nandl“) galt als missraten. Mit über sechzig heiratete er im Gefängnis. Bald darauf starb er.
Tante Gustls Schwestern emigrierten nach New York, London bzw. Buenos Aires. Ihre Mutter hatte nicht mehr die Kraft dazu. Als die Einundachtzigjährige im Zug saß, der sie ins Konzentrationslager Theresienstadt bringen sollte, kletterte ihr Sohn – der Großvater der Erzählerin – zu ihr in den Waggon. Eine jüdische Fürsorgerin holte ihn noch vor der Abfahrt heraus, aber dabei stürzte er so unglücklich, dass er sich Hüfte, Schlüsselbein, Nase und Jochbein brach. Seine Mutter starb drei Wochen nach der Ankunft im Lager.
Die andere Großmutter der Erzählerin, eine polnischsprachige Katholikin, floh im Januar 1945 mit ihren sechs Kindern von Pommern nach Wien. Ihr Mann war bereits da und hatte eine Unterkunft besorgt.
Er schwelgte in großen Ideen und Geschäften, bloß die dadurch bedingten großen Zahlen bereiteten ihm Probleme. Er war ein Baumeister und Architekt, doch leider kein Geschäftsmann. (Seite 237)
Als er Anfang der Fünfzigerjahre starb, musste die Witwe mit den jüngeren Kindern von der herrschaftlichen Villa in eine Mietwohnung in Wien umziehen. Eine ihrer Töchter – die Mutter der Erzählerin – fing in einer Handelsfirma in der Mariehilferstraße zu arbeiten an. Mit dem Prokuristen Lubomierz Kat, einem gebürtigen Polen, begann sie ein Verhältnis. Aber nach drei Jahren hielt sie seine Eifersucht nicht mehr aus. Sie trennte sich von ihm und ging mit verschiedenen Männern, darunter dem Vater der Erzählerin. Als dieser ihr gestand, er sei mosaisch, fragte sie, ob das eine Krankheit sei. Die beiden heirateten, und nach drei Jahren Ehe bekamen sie das erste Kind.
Der Vater der Erzählerin war acht Jahre alt gewesen, als man die jüdische Familie 1938 gezwungen hatte, aus der schönen Wohnung in Wien auszuziehen. Kurz darauf wurde der Achtjährige in einen Zug nach England gesetzt. Dort nahmen ihn die Pflegeeltern Tom und Annie in Stopsley nordöstlich von Luton auf.
Sein älterer Bruder kam nach London.
Ihre erwachsene Schwester Katzi hielt sich zufällig bei mährischen Verwandten in Freudenthal auf, als die Deutschen das Gebiet Anfang Oktober 1938 aufgrund des Münchner Abkommens besetzten. Katzi verließ das Land und verbrachte mehrere Monate in Italien, um eine Tuberkulose auszukurieren. Auf dem Weg zu ihrem nach Kanada vorausgereisten Ehemann hielt sie sich vor dem Ablegen ihres Schiffes – der S. S. Penelope – in Liverpool ein paar Tage in London auf. Dort traf sie sich mit dem älteren ihrer beiden Brüder. Der jüngere wollte mit dem Bus nach London fahren, kam aber nicht bis in die Stadt, weil die Straßen aufgrund der Bombentreffer unpassierbar waren.
Am 6. Dezember 1941 starb Katzi in Kanada an Tuberkulose.
Ihr jüngerer Bruder fand schließlich Arbeit bei einem jüdischen Schneider im Londoner Stadtteil Soho. 1947 kam er nach Wien zurück.
Sein Bruder war neun Monaten auf der Isle of Man interniert gewesen. Zwei Jahre nach seiner Freilassung hatte er sich zur British Army gemeldet und war nach Burma abkommandiert worden. Nun half der britische Unteroffizier den Alliierten als Übersetzer bei der Entnazifizierung. Mit seiner englischen Frau hatte er zwei Söhne.
Nachdem er aus der Armee ausgeschieden war, übernahm er als Import-Export-Fachmann den Geschäftsbereich Ost in der Handelsabteilung einer großen Bank in Wien. Als dieser wegen des Marshall-Plans aufgelöst wurde, gründete er zusammen mit seinem zehn Jahre älteren, aus Ungarn stammenden Kollegen Fredi Hals ein eigenes Unternehmen. Und weil er mehr Zeit mit seiner Sekretärin als mit seiner Frau verbrachte, ließ diese sich von ihm scheiden.
[…] mein Onkel freute sich nie. Er wusste, es würde nicht dabei bleiben. „Ich hab g’wusst, die Sache hat an Haken“ – das wurde später seine Lieblingswendung. Er war ein Pessimist, der sich nur dann bitterlich freuen konnte, wenn er mit seinen Unglücksprognosen wieder einmal Recht behalten hatte. (Seite 81)
Innerhalb von weniger als zwei Jahren verspielte er sein Vermögen. Einige in der Familie glaubten, es habe damit angefangen, dass er es nicht hinnehmen konnte, dass seine geschiedene Frau durch heimliche Geschäfte zwischen Israel und Ostblockstaaten reich wurde.
Damals soll […] mein Onkel aus gekränkter Eitelkeit […] der kleinen Engländerin eine Papier- und Verpackungsfabrik vor der Nase weggeschnappt haben, deren späterer Bankrott den Anfang vom wirtschaftlichen Untergang meines Onkels bedeutete. Denn mein Onkel, der mit dieser Firma zwar einen Haufen Geld, aber nicht seine Existenzgrundlage verlor, soll dadurch so in Panik geraten sein, dass er in der Folge, bei seinen Versuchen, den Verlust auszugleichen, einen schwerwiegenden Fehler nach dem anderen machte. (Seite 310f)
Nach dem Tod seiner zweiten Frau, Tante Ka, besorgte die Schwester der Erzählerin dem Onkel eine Haushaltshilfe, die zufällig aus Burma stammte: Mi Mi Kiang („Mimi“). Diese fragte ihn eines Tages, ob er bereit sei, sie zu adoptieren, damit sie im Land bleiben könne. Er versuchte es, scheiterte jedoch an einem Richter des Bezirksgerichts.
Der Vater der Erzählerin hatte es 1947 schwer, in Wien Arbeit zu finden. Der Siebzehnjährige wollte Automechaniker werden, aber seine Mutter ließ nicht zu, dass er sich schmutzig machte. Einige Zeit verdiente der junge Mann sein Geld als Bürodiener einer Filmgesellschaft. Dann wurde er Fußballspieler.
Wie sein Bruder heiratete er zweimal. Aus der ersten Ehe hatte er einen Sohn. Mit seiner zweiten Frau bekam er zwei Töchter.
Der Halbbruder der Erzählerin entlarvte Felix Popelnik, den Präsident des österreichischen Skiverbands, der zwei Tage nach seinem Sturz vom Hometrainer an einem Herzinfarkt gestorben war, als Kriegsverbrecher.
Als der Vater bei der Wahl zum Bundespräsidenten 1986 für Kurt Waldheim stimmte, der seine Mitgliedschaft im NS-Studentenbund im SA-Reiterkorps verheimlicht hatte, verließ die Erzählerin aus Protest ihr Elternhaus.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Der Roman „Vienna“ von Eva Menasse dreht sich um eine Familie in Wien mit jüdisch-österreichischen und katholisch-slawischen Wurzeln. Den Mitgliedern fällt es nicht leicht, sich über ihre Identität klar zu werden. Was ihnen dabei hilft, sind die Erinnerungen, die in der Familie weitergegeben werden.
Eva Menasse greift diese Erinnerungen in der Ich-Form auf, und statt sie in eine lineare Handlung zu zwängen, reiht sie in „Vienna“ teils heitere, teils traurige Anekdoten über skurrile Personen aneinander. Dabei kommt sie vom Hölzchen aufs Stöckchen; sie erwähnt ein groteskes Ereignis, aber bevor sie näher darauf eingeht, plaudert sie erst noch über damit verbundene Assoziationen, schweift ab und springt zwischen Figuren und Zeiten, mitunter auch zwischen Imperfekt und Präsens hin und her. Auf diese Weise gelingen ihr einige brillante Miniaturen mit funkelndem Sprachwitz, aber dem Familienroman „Vienna“ fehlt es an einer packenden Handlung bzw. überzeugenden Struktur. Dass die Familienmitglieder mit einer Ausnahme namenlos bleiben und die Ich-Erzählerin von sich selbst so gut wie nichts preisgibt, erleichtert die Lektüre auch nicht gerade. Im übrigen wurden bei der Lektorierung einige Sprachschludrigkeiten übersehen.
Unverkennbar weist „Vienna“ Parallelitäten mit der Familiengeschichte der Autorin Eva Menasse (* 1970) auf. Bei ihrem Halbbruder handelt es sich um den Schriftsteller Robert Menasse (* 1954). Ihr Vater Hans Menasse (* 1930) und ihr Onkel Kurt (* 1923) waren 1938 als Kinder zu Pflegeeltern nach England geschickt worden. Dort hatte Hans Menasse seine Neigung zum Fußballspiel entdeckt. Nach dem Krieg kehrte er nach Wien zurück und wurde 1947 Mitglied der „Vienna“ (First Vienna Football Club), des ältesten Fußballvereins Österreichs, der in der Saison 1954/55 zum sechsten Mal den österreichischen Meistertitel eroberte.
Vienna ist kein Schlüsselroman über meine Familie. Er ist von einigen Geschichten inspiriert, die in meiner Familie wirklich vorgekommen sind. Der Vater ist Fußballer, der Onkel hat im Burma-Krieg gekämpft. Aber es ist sicher noch viel mehr erfunden. Vielleicht wollte ich meine Familie gerne auch so haben, wie sie jetzt in dem Roman ist. Da ist genauso viel Gewünschtes in dem Roman, wie Fakten. (Eva Menasse)
Mit ihrem Ehemann, dem Schriftsteller Michael Kumpfmüller (* 1961) lebt Eva Menasse in Berlin. „Vienna“ ist ihr Romandebüt.
Den Roman „Vienna“ gibt es auch als Hörbuch, gelesen von Eva Manesse (Regie: Wolf-Dietrich Fruck, Köln / Hamburg 2005, 6 CDs, ISBN: 3-86604-035-0).
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2009
Textauszüge: © Kiepenheuer & Witsch
Eva Menasse (kurze Biografie / Bibliografie)
Eva Menasse: Lässliche Todsünden
Eva Menasse: Quasikristalle
Eva Menasse: Dunkelblum