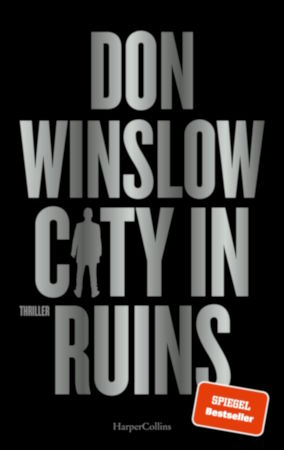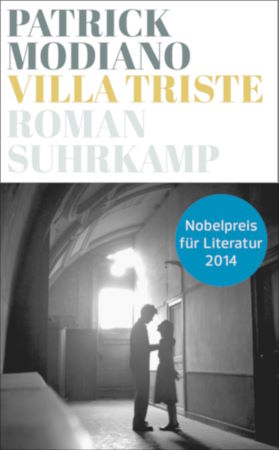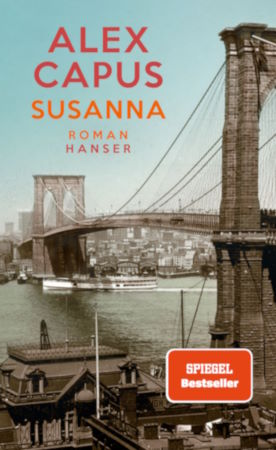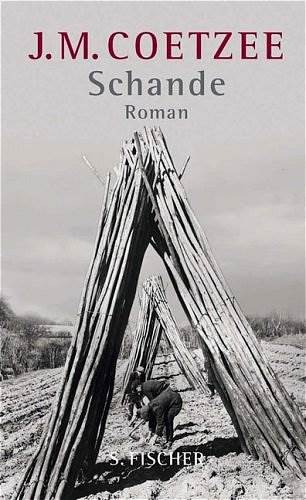Friedrich Christian Delius : Die Frau, für die ich den Computer erfand
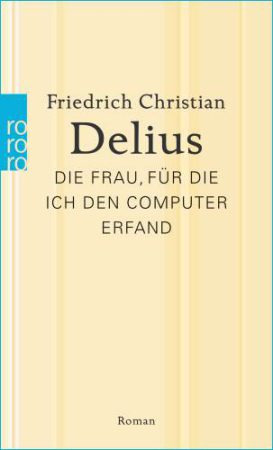
Inhaltsangabe
Kritik
An einem Abend im Juli 1994 trifft sich ein vierundachtzigjähriger Herr im Landgasthof „Burg Hauneck“ in Stoppelsberg zwischen Bad Hersfeld und Hünfeld mit einem jungen Journalisten zu einem Interview, das sie drei Wochen zuvor vereinbarten. Eigentlich sollte der Greis in Braunschweig sein, wo man ihm an diesem Abend den vierzehnten Ehrendoktorhut verleihen wird, aber er hat genug von Festreden, sagte deshalb vor zwei Tagen aus „gesundheitlichen Gründen“ ab und bat seine Tochter, ihn zu vertreten. Das sei wie Schuleschwänzen, meint er vergnügt. Statt die immergleichen Lobeshymnen anzuhören und selbst zum zigsten Mal das gleiche zu sagen, will er dem Journalisten in dieser Vollmondnacht in der Rhön sein Leben erzählen.
Laut denken, ohne Rücksicht, ohne allzu viel Rücksicht. Das bin ich mir und meinem Alter noch schuldig. Und vor allen Dingen einer Frau bin ich das schuldig. Der Frau, die keiner kennt. Der Frau, für die ich den Computer erfunden habe … (Seite 13f)
Die beiden Herren hatten sich vor neun Jahren bei einer Tagung an der Nordsee kennen gelernt. Der Greis erinnert sich noch, dass der Journalist behauptete, Faust sei humorlos. Das auf Band aufgezeichnete Interview soll von 18 Uhr bis 6 Uhr früh dauern, und darf erst nach dem Tod des alten Mannes in Buchform veröffentlicht werden. In den Vollmondnächten im August und September will er sich mit zwei anderen Journalisten zu ähnlichen Gesprächen treffen.
Der Greis reklamiert für sich, den Computer erfunden zu haben.
Man kennt mich nicht, obwohl ich weltberühmt bin. Ein weltberühmter Unbekannter. (Seite 24)
[…] ich beschloss, das beste Rechengerät aller Zeiten zu erfinden … Genau so war es, ein Beschluss. Ich hatte einen Haufen Ideen im Kopf, erste Skizzen, das hab ich vorhin schon angetippt, Rechenwerk, Speicherwerk und so weiter. Ich wusste, ich konnte das nicht am Feierabend erledigen, abends und sonntags. So nebenbei hatte ich schon einiges getüftelt oder entworfen, ein elliptisches Kino mit optimaler Sicht für alle, einen Warenautomaten mit Geldrückgabe, ein automatisches Fotolabor. Dazu einigermaßen kluge, das heißt praktikable Gedanken, wie ich nachträglich sagen darf, über die sogenannte Grüne Welle im Autoverkehr. In all diese Richtungen hätte ich mich bewegen können, sogar zur Raumfahrt, wenn Herr von Braun angeklopft hätte. Aber es wurde die Rechenmaschine … Was ich nicht mochte, war das Rechnen, die endlosen stumpfsinnigen Rechnereien, mit denen man mich gequält hat und alle Ingenieure und Statiker, ganze Heerscharen von Rechenknechten. Den Stumpfsinn der Rechenschieberei abschaffen, das war’s. Wenn ich Leute zu Lachen bringen will, sag ich: Zum Rechnen war ich zu faul. Mein Geist, meine Lebenskraft waren mir dafür zu schade. (Seite 68f)
Bevor er beginnt, von den Anfängen seiner Arbeit 1936 im Wohnzimmer seiner Eltern in Berlin-Kreuzberg zu schwadronieren, lädt er den Jüngeren zum Essen ein und empfiehlt ihm ein Jägerschnitzel mit Kroketten, das esse er hier immer.
Das Jägerschnitzel wird systematisch verkannt und verleumdet. (Seite 14)
Als die Bedienung nach ihren Wünschen fragt, bestellt der Journalist also ein Jägerschnitzel, während der Alte überraschenderweise Wildgulasch mit Salzkartoffeln wählt und seinen Gesprächsparner dann höhnisch darauf hinweist, wie er sich manipulieren ließ. Mit diesem Test sei bewiesen, so der Greis, dass sein Gegenüber nicht zum Erfinder tauge.
Wer sich anpasst, wer sich von irgendwelchen Erwartungen seiner Chefs lenken lässt, wer den Mittelweg geht, den völlig stumpfsinnigen goldenen Mittelweg, der kann, vielleicht, vielleicht ein guter Beamter werden, ein Schnarchsack im Patentamt, oder ein tüchtiger Handwerker meinetwegen, aber kein Erfinder. (Seite 19)
Um herauszufinden, ob man sich zum Dichter eigne oder nicht, müsse man sich prüfen, meint er. Das habe er von Rainer Maria Rilke gelernt. Und das gelte auch für Erfinder.
Und wer nicht sagen kann: Ich muss!, der soll es bleiben lassen. Und wer zum Entschluss kommt: Ich muss!, der soll, das ist ganz wichtig, sein Leben nach dieser Notwendigkeit ausrichten, bis in jede Einzelheit. (Seite 70)
Nach dem Essen gehen die beiden hinauf zur Burg. Dann setzen sie das Interview auf der Terrasse des Gasthofs fort, und als es zu kalt wird, setzen sie sich wieder in die Gaststube. Sie trinken zusammen eine Flasche Riesling und dann die ganze Nacht lang Wasser.
Nach zwei Jahren Arbeit war der Erfinder 1938 vor dem fertigen Versuchsmodell einer elektrisch angetriebenen mechanischen Universal-Rechenmaschine gestanden, die aus vielen kleinen, mit der Laubsäge bearbeiteten Metallplättchen bestand, insgesamt aus dreißigtausend Bauteilen. Klar, dass die Bleche der „A1“ im Betrieb immer wieder klemmten. Es war eine „Rüttel-, Rassel- und Rechenanlage“ (Seite 79). Weil nichts darüber veröffentlicht wurde, erfuhr auch John von Neumann nichts davon und erfand in der Theorie noch einmal das, was der Deutsche praktisch vorzeigen hätte können.
Ein Bekannter, der über eine Leserkarte der Staatsbibliothek Unter den Linden verfügte, brachte ihm eines Tages ein Buch über alte Rechenmaschinen mit. So erfuhr er von Charles Babbage und Ada Lovelace. In die fast hundert Jahre ältere englische Mathematikerin verliebte er sich; sie wurde die Muse, die ihn bei seiner Arbeit beflügelte, sein „Anti-Mephisto“ (Seite 210).
Erfinden hat ja durchaus etwas Erotisches, etwas Spielerisches bei aller Besessenheit. (Seite 76f)
Glauben Sie mir, das Erfinden, auch das geht ja nicht ohne Eros. Ohne Eros entwickelt sich nichts im Leben, nicht einmal der Bau von Rechenmaschinen … (Seite 89)
Der Eros der Arbeit, die Erfindungslust, die Fantasiearbeit, das war Ada für mich, eine erotische Antriebskraft gewissermaßen. (Seite 237)
Bei den Festreden heißt es, er habe für den Nutzen der Menschheit gearbeitet, aber das stimmt nicht; er tat es für Ada, „die Frau, für die ich den Computer erfand“ (Seite 90). Bis heute verriet er niemandem, dass er seine Rechenmaschinen nach Ada benannte: „A1“, „A2“ usw.
Ada war meine Helena, wenn ich mal übertreiben darf, nicht mein Gretchen. Eine Fantasiegestalt, die Schönheit schlechthin, die Sehnsucht in Person, präsent nach Wunsch, ideal, produktiv, rund um die Uhr. (Seite 201)
Sein Freund Hartmut habe vorgeschlagen, statt der klemmenden Bleche Röhren zu verwenden, erzählt der Greis.
Eine Rechenmaschine ist doch kein Radio, hab ich zuerst gedacht. (Seite 96)
1939 musste er zur Wehrmacht. Um freigestellt zu werden, bot er der Luftwaffe an, innerhalb von zwei Jahren eine automatische Maschine zur Verteidigung gegen Luftangriffe zu konstruieren, aber da lachte man ihn aus: Bis dahin sei der Krieg längst gewonnen, hieß es. Aufgrund eines neuen Arbeitsvertrags mit den Henschel Flugzeugwerken – wo er vor dem Krieg als Statiker gearbeitet hatte – konnte er die Infanterie-Uniform nach einem halben Jahr wieder ausziehen.
Die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt beteiligte sich 1940 an der Finanzierung der „A3“. Diesen Prototyp, der mit zweitausend Telefonrelais arbeitete, stellte der Erfinder im Mai 1941 fertig. Die „A3“ konnte zwar keine bedingten Sprünge, Verzweigungen und Schleifen durchführen, aber es handelte sich um die erste frei programmierbare Rechenmaschine der Welt, den ersten funktionsfähigen „Computer“. Das war zwei Jahre, bevor in Harvard „Mark 1“ vorgestellt wurde. Da jedoch wegen des Krieges niemand etwas von dem deutschen Erfinder gehört hatte, galt der Harvard-Mathematiker Howard H. Aiken lange Zeit als Erfinder des Computers. Dabei hatten die Amerikaner sogar noch das Dezimalsystem statt des für Rechner vorteilhafteren binären Zahlensystems verwendet.
Die waren noch nicht mal bei Leibniz angekommen. (Seite 118)
Im September 1941 wurde die Uk-Stellung des Tüftlers aufgehoben, und er musste sich innerhalb von zwei Tagen in einer Kaserne in Berlin-Tempelhof melden. Nach einer Woche kam er wieder zurück, diesmal, weil er bei Henschel für die Entwicklung der Gleitbombe 293 benötigt wurde. Dabei handelte es sich um eine ferngesteuerte, mit Tragflächen und Leitwerk ausgestattete Bombe, die gegen Schiffe eingesetzt wurde, eine der ersten Fernlenkwaffen überhaupt.
Ob er Nationalsozialist gewesen sei?
Ich hatte überhaupt keine Zeit, ein Nazi zu sein … Ich war besessen von meiner Arbeit, achtzig bis hundert Stunden die Woche, wie gesagt. Wer in der Partei war und Zeit für die Partei hatte, würde ich jetzt mal logisch folgern, war ein Faulpelz, schon das hat mir nicht gepasst […] Scherz beiseite […] Nein, die Armleuchter waren nicht mein Fall. (Seite 109)
Er gibt zu, dass er sich wahrscheinlich nicht geweigert hätte, einem Ruf beispielsweise in die von Wernher von Braun geleitete Heeresversuchsanstalt Peenemünde auf der Insel Usedom zu folgen und bei der Entwicklung der „Vergeltungswaffen“ mitzuhelfen. Die Verlockung, endlich über ausreichende Mittel zur Realisierung seiner Erfindungen zu verfügen, wäre einfach zu groß gewesen.
Von Juni 1942 bis Anfang 1945 baute er die „A4“. Zum Glück bezeichnete er die Prototypen, solange sie noch nicht fertig waren, als „Versuchsmodelle“ und kürzte sie mit einem V ab. Nur deshalb assoziierten eifrige Beamte im Ministerium für Rüstung und Kriegsproduktion die „V4“ mit den „Vergeltungswaffen“ V1 und V2. Als die Rote Armee die Oder überschritt, wiesen sie die Reichsbahn an, die „V4“ samt ihrem Erfinder und dessen Familie nach Göttingen zu bringen. Wegen dauernder Tieffliegerangriffe und zerbombter Bahnhöfe dauerte die Fahrt zwei Wochen lang. Kaum hatte man die Universal-Rechenmaschine auf Lastwagen verladen, die zur Aerodynamischen Versuchsanstalt fuhren, wurde der Bahnhof durch einen britischen Luftangriff zerstört.
Dann sollte die „V4“ in das unterirdische Lager „Dora“ im Harz geschafft werden, wo Zwangsarbeiter und Häftlinge des Konzentrationslagers Dora-Mittelbau mit der Serienherstellung der von Wernher von Braun in Peenemünde entwickelten V2 beschäftigt waren. Als der Computer-Erfinder die Hölle sah, weigerte er sich, die „V4“ dorthin bringen zu lassen und erreichte, dass die Rechenmaschine zunächst nach Oberammergau und später nach Hindelang transportiert wurde. Danach gelobte er, in jeder zukünftigen Vollmondnacht an Ada zu denken.
Kurz vor der Kapitulation traf er mit Wernher von Braun zusammen und versuchte ihm zu erklären, dass die Universal-Rechenmaschine für die Raumfahrt unverzichtbar sei. Der berühmte Raketenbauer hörte jedoch nicht auf ihn und begriff erst später in den USA die Bedeutung der Computer.
Ich war damals ein noch schlechterer PR-Agent meiner selbst als später. Heute erst wäre ich so frech zu behaupten: Raketen bauen ist simpel, aber sie auf Kurs halten und steuern, das geht nur mit Computern. (Seite 182)
Unmittelbar nach dem Krieg entwickelte er als Erster eine algorithmische universelle Programmiersprache und hielt seine Überlegungen auf 300 Seiten fest. Statt sich jedoch um eine Veröffentlichung zu bemühen, vergaß er das Manuskript, bis er zehn, zwölf Jahre später von den Programmiersprachen Fortran, Cobol, Algol hörte und ihm das alles recht bekannt vorkam.
Er klagt über „die Ungade der zu frühen Geburt der Ideen“ (Seite 205).
Ein mit einer Amerikanerin verheirateter Nachbar, der 1947 in die USA auswanderte, berichtete IBM und Remington von dem deutschen Erfinder, der eine Rechenmaschine im Heu versteckt hielt. So wurde dieser 1948 nach England und in die USA eingeladen, doch es gelang ihm nicht, die Interessenten von den Vorteilen seiner Erfindungen zu überzeugen.
Wir konnten kein Englisch, der Mann von der British Tabulating Machine Company kein Deutsch, der Dolmetscher verstand nichts von Rechnern. (Seite 213)
1949 zog der Erfinder mit seiner Familie nach Neukirchen zwischen Bad Hersfeld und Hünfeld. Dort stellte er die „A4“ fertig. 1950 lieferte er diesen damals einzigen funktionsfähigen Computer in Europa der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich, die sie für fünf Jahre mietete.
Ich sehe die A4 rechnen und rechnen, ich höre sie rechnen, sie rechnet nicht nur für die Mathematiker, sie erledigt die Rechenarbeit für Physiker, Ingenieure, Flugzeugbauer, Turbinenbauer, Biologen und Optiker gleich mit. Sie rechnet hundert Stunden am Stück, sechzehn Multiplikationen pro Sekunde und tippt die Ergebnisse wie mit einer Schreibmaschine. (Seite 226)
Im Lesesaal einer Bibliothek in Zürich schlug der Erfinder ein Buch über Charles Babbage auf, das unter anderem mit einem Ölgemälde von Ada Lovelace illustriert war. Sie sah genau so aus wie er sich seine Muse vorgestellt hatte!
Das Patent für die „A1“, das er 1936 beantragt hatte, wurde 1955 gewährt – zu einem Zeitpunkt, als die Erfindung keine Bedeutung mehr hatte. Noch länger dauerte es bis zur endgültigen Entscheidung über seinen 1941 für die „A3“ – den ersten funktionsfähigen Computer der Welt – eingereichten Antrag: 1967 erklärte das Bundespatentgericht, dafür könne man „mangels Erfindungshöhe“ kein Patent gewähren.
Ich erinnere mich gut, in den Sechzigern ging es mir ja eher mies, mein absoluter Tiefpunkt. Wer war ich denn, ein gescheiterter Unternehmer, ein Angeber, der behauptete, den Computer erfunden zu haben und dem nicht mal das Patentamt glaubte. Ein Scharlatan und ein Trottel, der seine stolze Firma für eine Kiste Äpfel und ein Schock Eier verschenkt hat, verschenken musste. (Seite 180)
Gegen Morgen schläft der Journalist ein, aber das Bandgerät bleibt eingeschaltet, und der Greis redet weiter, bis der junge Mann wieder aufwacht. Kurz darauf beendet der Erfinder seinen Lebensbericht, nicht ohne seinen Zuhörer darauf hinzuweisen, dass er ihm mit der platonischen Liebesgeschichte möglicherweise einen Bären aufgebunden habe.
Sie wissen nicht, und Sie sollen es niemals wissen, ob Sie auf mich reingefallen sind mit der Ada-Geschichte. (Seite 284)
In der Rhön – wo Konrad Zuse nach dem Zweiten Weltkrieg lebte und Friedrich Christian Delius zur Schule ging – treffen sich 1994 der Erfinder des Computers und ein deutlich jüngerer Buchautor. Die Namen der beiden werden nicht genannt, aber es ist offensichtlich, dass Konrad Zuse und Friedrich Christian Delius gemeint sind. Immer wieder ab- und ausschweifend, schwadroniert der Greis über sein Lebenswerk, Faust, seine platonische Liebe zu der englischen Mathematikerin Ada Lovelace und andere Themen. Er ist ein großer Selbstdarsteller, der im Gegensatz zu seinem Gegenüber bis zum nächsten Morgen wach bleibt und sieben Bänder bespricht, mal eitel und triumphierend, dann spöttisch, provozierend und hochmütig oder larmoyant, hin und wieder auch nachdenklich.
„Die Frau, für die ich den Computer erfand“ ist ein origineller Roman von Friedrich Christian Delius. Mit Ausnahme einer Vorbemerkung (Seite 7) und einem Nachsatz (Seite 285) besteht das Buch aus einem einzigen Monolog. Selbst die Fragen des Journalisten erschließen sich nur aus den Entgegnungen des Erfinders. Den Text hat Friedrich Christian Delius zwar in kurze Kapitel eingeteilt, deren Überschriften in Klammern stehen, aber innerhalb dieser Blöcke verzichtet er auf Absätze.
Bei „Die Frau, für die ich den Computer erfand“ handelt es sich um das Porträt eines leistungsstarken Preußen, der – ohne dass dies im Roman explizit zur Sprache käme – von der protestantischen Ethik überzeugt ist. Aber es geht auch um die Tragik eines genialen und besessenen Tüftlers, der vergaß, seine Ideen zu veröffentlichen und zusehen musste, wie andere statt ihm für ähnliche Erfindungen gefeiert wurden.
Ich hab kein Sachbuch über Zuse geschrieben, das kann jeder. Aber mich hat was anderes interessiert. Was war das Denken, was war die Sprache von diesem Mann? Wo ist der Witz auch von diesem Mann, als einer, der viel in Charlie-Chaplin-Filme gegangen ist als junger Mann. Was wird aus dem? Was macht der heute mit seinem Witz? […]
Mich hat nämlich fasziniert, dass neben seiner Erfolgsgeschichte als Erfinder des Computers er die Idee hatte, etwas Faustisches in sich zu haben. Und aus diesem faustischen Gedanken dachte ich: wo ein Faust ist, muss auch ein Gretchen sein oder eine Helena, und so ist dann die Ada entstanden. (Friedrich Christian Delius, Quelle: RBB)
„Die Frau, für die ich den Computer erfand“ ist witzig, geistreich und unterhaltsam.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2009
Textauszüge: © Rowohlt
Konrad Zuse (Kurzbiografie)
Ada Lovelace (Kurzbiografie)
Friedrich Christian Delius: Die Birnen von Ribbeck