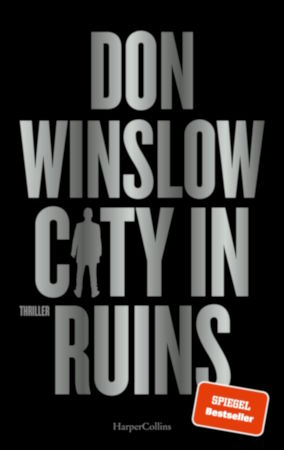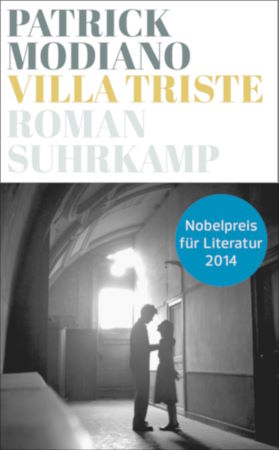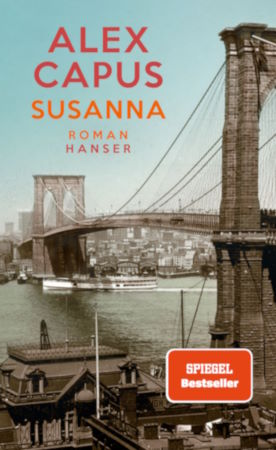Inger-Maria Mahlke : Silberfischchen

Inhaltsangabe
Kritik
Hermann Mildt
In der Jugend wollte Hermann Mildt Fotograf werden, aber nach dem Tod seines Vaters musste er die gerade erst begonnene Ausbildung abbrechen und seiner Mutter beistehen. Statt Künstler wurde er Polizist. Inzwischen ist er verwitwet und frühpensioniert.
Seine Frau war schön gewesen, schwanger, als sie einwilligte, ihn zu heiraten, er hätte nie gewagt, sie zu schwängern. Wochen später sagte sie, sie habe es verloren, das ändere nichts, dafür sei es zu spät. Er hatte genickt. Hatte zugesehen, wie sie das Haus mit Möbeln füllte, jeden Morgen ihre Lippen nachzog und beim Frühstück mit einem geübten Messerhieb ihr Ei köpfte. Wie sie ihren Finger anfeuchtete, ehe sie die Seite einer Illustrierten umblätterte. […] Hatte gewartet, doch sie musste mehr verloren haben, denn, gleich wie oft und fest und entschlossen sie es versuchten, in ihr wuchs nichts.
Sie habe nicht geheiratet, um arbeiten zu gehen, sagte sie. Sie war zu Hause geblieben, hatte Kurse besucht, einen Lesezirkel. Bridge gespielt. Wenn er Nacht- oder Frühschicht hatte, hatte er ihr den Frühstückstisch gedeckt, ehe er zum Dienst ging. Mit Eierbecher und Stoffserviette, Letztere zu einem Segel gefaltet. Hatte Marmelade in Schälchen gefüllt, je zwei Käse- und zwei Wurstscheiben aufgerollt und auf einen Teller getan, Butter in kleine Vierecke geschnitten und dazwischengelegt, hatte alles mit Klarsichtfolie überzogen und in den Kühlschrank gestellt. Am Anfang, um ihr eine Freude zu machen, später, damit sie nicht fragte, warum er es unterließ.
Das kinderlose Ehepaar lebte in Delmenhorst. Zu Geburtstagen und an Weihnachten schenkten sich die beiden gegenseitig Löffel, Gabeln, Messer oder auch einen Kuchenheber des WMF-Bestecks „Fächermuster“ in der Echtsilberausführung.
Eines Tages, als Hermann Mildt vom Dienst nach Hause kam, fand er seine Frau im Garten. Sie lag tot auf dem Rasen, war augenscheinlich beim Wäsche-Aufhängen zusammengebrochen. Da ging er ins Haus zurück, hängte die Dienstmütze an die Garderobe, die Jacke auf einen Bügel und holte seinen Fotoapparat.
Den ersten Film hatte er noch am selben Abend zum Entwickeln gebracht, am nächsten Tag konnte er die Bilder abholen. Vor und nach dem Dienst ging er in den Garten, nach ihr sehen.
Er markierte eine Stelle, um auch in den folgenden Tagen immer aus demselben Blickwinkel Aufnahmen machen zu können.
Ihre Haut wurde zuerst immer weißer, dann grau, über Nacht fraß ein Nager ihre Nase an, ein weißes Knochenhorn kam zum Vorschein.
Dann kehrten die Nachbarn aus dem Urlaub zurück, und deren Spaniel kläffte an der Hecke zwischen den Grundstücken. Hermann Mildt war noch beim Zähneputzen, als die Kollegen kamen. Weil die Obduktion ergab, dass die Frau an einem perforierten Aneurysma gestorben war, erhärtete sich zwar der Mordverdacht nicht, aber der Schichtleiter sah erleichtert aus, als Hermann Mildt selbst seine Frühpensionierung vorschlug.
Er zog von Delmenhorst nach Berlin. In seiner Wohnung hat er sich eine Dunkelkammer eingerichtet, denn er fotografiert jeden Tag etwas.
Mir ist egal, was ich fotografiere.
Er brauchte sechs Schuber pro Jahr, je einen für zwei Monate. Er bestellte sie immer zur Weihnachtszeit, als Sonderangebot, fünf musste er bezahlen, den sechsten bekam man umsonst.
Schwarzfahrer
Als er mit der Bahn nach Frankfurt/Oder fahren möchte, um dort ein paar Bilder zu knipsen, kauft er absichtlich keine Fahrkarte, denn er ist über die Zugverspätung verärgert. Das Argument hilft ihm jedoch bei der Kontrolle nicht: Er muss am nächsten Bahnhof aussteigen, sich ausweisen und wird ins Schwarzfahrer-Register eingetragen.
Außer ihm schnappen die Kontrolleure noch eine schätzungsweise knapp über 50 Jahre alte Polin. Jana Potulski behauptet, für eine türkische Familie in Rheinsberg geputzt zu haben, die jetzt in Urlaub gefahren sei. Deshalb wollte sie zu ihrer Schwester in Frankfurt/Oder. Weil ihr ein paar Männer das Portemonnaie und die Ohrringe abnahmen, kann sie sich nicht ausweisen.
Hermann Mildt fragt die Betreiberin eines Zeitschriftenladens im Bahnhof, wo die Bushaltestelle sei. Die sei vor dem Postamt, antwortet sie, aber der Bus nach Berlin fahre selten, brauche doppelt so lang wie die Bahn und koste fast das Gleiche. Die Frau rät ihm deshalb, den nächsten Zug zu nehmen. Der Pensionär zieht es jedoch vor, mit einem Taxi zum Postamt zu fahren und dort auf den Bus zu warten.
An der Haltestelle trifft er Jana Potulski wieder, der es gelungen ist, den Kontrolleuren zu entfliehen.
„Haben Sie jemand? Sorgt jemand für Sie? Macht sauber, essen, einkaufen, Pflanzen gießen, redet mit Ihnen?“
„Nein“, antwortete er und „ich habe keine Pflanzen.“
Obwohl er ihr erklärt, er könne sie in seiner Zwei-Zimmer-Wohnung nicht unterbringen, besteht sie darauf, ihn zu begleiten. Über die Grenze könne sie erst mit einem neuen Pass, erklärt sie. Den werde ihre Schwester Irina in Frankfurt/Oder besorgen. Sonst habe sie niemanden. Sie könne auf dem Sofa schlafen.
Wohnung mit Silberfischchen
Als sie sich darüber wundert, dass in seiner verwahrlosten Wohnung kein Fernsehgerät steht, betont er: „Ich habe nichts, was sich zu stehlen lohnt.“
„Schön“, sagte sie, deutete auf den Kalender an der Wand über dem Küchentisch, Almhütte mit rosa Kirschblüten, die Baumstämme nicht im Bild, nur die Blüten rechts und links. Er hatte ihn geschenkt bekommen, hatte keine Lust gehabt, dem Apotheker zu erklären, dass er ihn nicht wollte. Hatte genickt, als der Apotheker ihn lächelnd zu der Ischiassalbe in die Tüte schob. Schweigend hatte er die Tüte genommen und war gegangen, „Frohes Neues Jahr“, hatte der Apotheker hinter ihm hergerufen.
Den Kalender wegzuwerfen, wäre Verschwendung gewesen.
Jana Potulski erkundigt sich nach seiner verstorbenen Frau, und er antwortet:
„Hausfrau. Nichts Besonderes.“
„Hat keine Kinder gekriegt“, setzte er hinzu […]
Er soll sie Jana nennen, bleibt aber lieber bei „Frau Potulski“.
Am nächsten Morgen weist sie ihn auf die Silberfischchen im Bad hin und fordert ihn auf, Köder mit Gift zu kaufen. Sie begleitet ihn zum nahen Edeka-Markt. Obwohl er meint, das sei reines Zuckerwasser, legt sie zwei Kartons Apfelsaft in den Einkaufswagen.
Den Saft ließ er im Wagen, die Kassiererin deutete auf ein Schild über der Kasse. Bitte legen Sie alle Waren auf das Band, stand dort. Er wandte sich um. „Sie wollten den Saft“, sagte er. Frau Potulski verdrehte die Augen, griff an ihm vorbei, nahm die Saftpakete aus dem Wagen, reichte sie der Kassiererin.“Die tragen Sie nach Hause“, sagte er.“Gut“, antwortete sie, die Kassiererin lächelte ihr zu. Er zahlte in bar, die Karten benutzte er nie, schirmte sein Portemonnaie mit einer Hand vor den Blicken ab, als er es öffnete. Er sah sich suchend um, ob er etwas vergessen hatte. „Den Apfelsaft hat Ihre Pflegerin schon mitgenommen“, die Kassiererin machte eine Kopfbewegung in Richtung Frau Potulski, die an den Einpacktisch gelehnt stand.
„Das ist nicht meine Pflegerin“, antwortete er, „das ist meine Frau.“
Zu Hause schiebt er ihre großen Hängebrüste nach oben, bis sie sagt: „Ich glaube, das reicht für heute.“ Einmal zwickt er sie dann mit den Daumennägeln in die zum Boden zeigenden Brustwarzen und registriert, wie sich ihre Lider schlagartig weiten.
Seine Frau hatte auch nicht gemocht, wenn er kniff oder biss oder sie an den Haaren zog.
Intermezzo
In einem der Schuber findet Jana Potulski einen Stapel Fotos von einer Leiche. „Was ist das?“, fragt sie. „Meine Frau“, antwortet er, und auf ihre Bemerkung, die Person auf den Bildern sei tot, entgegnet Hermann Mildt: „Ich sagte doch, ich bin Witwer.“ Später findet er auf dem Sofa ein Küchenmesser: Jana Potulski hat sich bewaffnet.
Weil er der Polin misstraut und sie nicht allein in der Wohnung lassen möchte, nimmt er sie mit, als er zum Alexanderplatz fährt, um die Marienkirche im Schnee zu fotografieren. Hermann Mildt passiert die Sperre bei der U-Bahn mit seiner Monatskarte und kümmert sich nicht um seine Begleiterin, die dann vor der Kirche den Regenschirm über die Kamera halten muss, während er auf einen Moment wartet, in dem keine Touristen vor dem Portal herumstehen. Schließlich muss Jana Potulski zur Toilette. Aber sie kommt zurück, nachdem sie auf einem Schild gelesen hat, dass es Geld kostet. Hermann Mildt kramt in seinem Portemonnaie und hält ihr eine Münze hin.
„Das ist zu wenig“, sagte sie, „50 Cent stand auf dem Schild.“
„50 Cent? Das ist eine Mark. Ich bezahle doch nicht eine Mark, damit Sie …“, er brach ab.
Kurz entschlossen bettelt Jana Potulski Passanten an – und später wartet Hermann Mildt vergeblich auf ihre Rückkehr. Offenbar ist sie weggelaufen. Zu Hause setzt er sich im Dunkeln ans Küchenfenster, von dem aus er die Straße überblicken kann. Am nächsten Tag fährt er noch einmal zum Alexanderplatz.
Er würde nicht suchen, er würde nur ein Stück die Liebknechtstraße entlanggehen.
Nachdem er sie auf der anderen Straßenseite entdeckt hat, bedeutet er ihr mit Gesten, dass er nicht vorhabe, zu ihr hinüberzugehen. Sie kommt zu ihm, und im U-Bahnhof fordert er sie auf, ihn um einen Fahrschein zu bitten.
„Sagen Sie einfach bitte. Bitte, Herr Mildt, könnte ich Geld für eine Fahrkarte haben.“
Zu Hause schiebt er sie ins Schlafzimmer, aufs Bett und fordert sie auf, sich auszuziehen. Sie presst die Lippen zusammen, als er sie küsst. Er öffnet seine Hose, aber sein Glied bleibt schlaff, und Jana Potulski zieht ihre Unterhose wieder an.
Vergiftung?
Sie habe eine Tochter, gesteht sie, und er fragt, wo diese sei. Die putze bei der Familie in Rheinsberg, und Jana Potulskis schwerstbehinderter Enkel Matthias wuchs bei ihr in Poznań auf. Als er im Krankenhaus lag, rief Jana Potulski in Rheinsberg an, aber ihre Tochter kam nicht und ging auch nicht mehr ans Telefon. Nachdem der Junge im Krankenhaus gestorben war, fuhr Jana Potulski nach Rheinsberg, ohne sich von ihrer Arbeitsstelle abzumelden und vergaß auch den Pass. Weil sie nicht wusste, ob die Identitätskarte für den Grenzübertritt genügen würde, schloss sie sich auf der Zugtoilette ein. In Rheinsberg war niemand zu Hause, und eine Nachbarin teilte ihr mit, dass die Familie in Urlaub sei.
Der pensionierte Polizist argwöhnt sogleich, dass Jana Potulski das Kind ermordet habe, weil ihr die Pflege zu viel geworden sei.
„Wo haben Sie Deutsch gelernt, wenn Sie nicht hier arbeiten?“
„Von meinem Mann.“
„Ihrem Mann?“
„Er war Volksdeutscher. Seine Tochter sollte Deutsch sprechen, abends, am Küchentisch hat er es mir beigebracht. Wir sind geschieden. Er wollte ausreisen, ich nicht.“
An einem der nächsten Abende brät sie Schnitzel. Beim Essen verspürt Hermann Mildt ein Kribbeln.
Er konnte ihn sehen, sein Unterarm, seine Hand lagen vor ihm auf dem Tisch, er konnte ihn sehen, bewegen konnte er ihn nicht.
Hat Frau Potulski ihn vergiftet – so wie sie das Kind vergiftete?
Sie hatte etwas reingetan. Ins Fleisch gemacht.
Jana Potulski meint, er müsse zum Arzt.
„Der Mann meiner Chefin hatte einen Schlaganfall“, sagte sie langsam, „er hat vorher auch immer gesagt, es würde kribbeln.“
Um ihn zu beruhigen und ihm zu demonstrieren, dass im Fleisch kein Gift sei, zieht sie seinen Teller zu sich und isst von seinem Schnitzel.
„Dann war es eben nur auf der einen Hälfte des Fleisches“, sagte er.
Es klirrte laut, als sie das Besteck auf den Teller warf.
„Sie sind krank“, sagte sie.“
Auf der Suche nach dem Gift klettert Hermann Mildt in der Küche auf die Arbeitsplatte und räumt die Hängeschränke aus. Als er nichts findet, tastet er Jana Potulski ab, wie er es bei der Polizei gelernt hat. Unvermittelt boxt er mit der Faust gegen ihre Brust, und sie stolpert in die Dunkelkammer, in der er sie wie ein wildes Tier einsperrt. Dann fällt sein Blick auf die kleinen Giftboxen gegen die Silberfischchen. Sie muss das Mittel herausgeschüttelt und ins Essen gemischt haben, vermutlich ins Kartoffelpüree.
Die Gefrierbeutel fand er unter einem der Stühle, das Glas mit den Clips auf der Arbeitsplatte. Er holte seinen Teller, schabte mit dem Messer Erbsen und ein Häufchen eingetrocknetes Püree in den Beutel und verschloss ihn mit dem Draht. Im Sideboard fand er weiße Etiketten, Teller 1 HM, schrieb er auf das erste, klebte es auf den Beutel. Auf das nächste schrieb er Teller 2 JP, der Beutel war um einiges voller, ein halbes Schnitzel, Sauce, Püree, Erbsen, durcheinander, es sah aus wie Erbrochenes.
Die Beutel mit dem Beweismaterial nimmt er mit ins Schlafzimmer und legt sie in die dünne Schneeschicht auf dem Fensterbrett.
Sie müsse zur Toilette, ruft Jana Potulski und droht damit, in der Dunkelkammer auf den Boden zu urinieren. Er öffnet die Tür. Es klingelt. Der Postbote bringt ein Einschreiben für Jana Potulska. Hermann Mildt kann nicht verhindern, dass das Kuvert der aus der Dunkelkammer Befreiten ausgehändigt wird. Es enthält einen roten Pass, einen 50-Euro-Schein und zwei 10-Euro-Scheine. „Für die Fahrkarte nach Poznań“, erklärt sie.
„Woher weiß Ihre Schwester, wo ich wohne?“
„Von mir“, sie klang erstaunt.
„Ich habe Ihnen die Adresse nicht gesagt.“
Den Namen, die Stadt und die Straße habe sie gewusst, und ihr Neffe sei dann ins Internet gegangen, erklärt Jana Potulski.
Von einem Internet hatte er in der Zeitung gelesen.
Er deutete auf das Geld, „das gehört mir“, sagte er. „Sie haben mein Wasser, meinen Strom, mein Gas verbraucht, Nahrungsmittel, das U-Bahn-Ticket“, zählte er auf. „Ich mache eine Liste“, sagte er, wollte nach den Scheinen greifen, „den Rest kriegen Sie wieder.“
Aber sie steckt das Geld ein. Das Kind müsse in Poznań beerdigt werden, sagt sie und will sich von Hermann Mildt verabschieden. Der protestiert:
„Sie können nicht hier wohnen, sich anfassen lassen, mich töten, ohne eine Erklärung versuchen, mich zu töten, und dann einfach gehen.“
Etwas bohrt sich in seinen Kopf, aber Jana Potulski schaut ihn an und scheint es nicht zu bemerken.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Plötzlich verstand er, er fiel nach vorn, hatte gar nicht gesehen, dass sie zugeschlagen hatte, den Fleischklopfer, die Weltuhr, ein Messer in der Hand gehalten hatte, zugeschlagen hatte, sie musste schnell gewesen sein. Jetzt waren ihre Hände leer […]
Sie sah erschrocken aus, ihr Mund geöffnet, als würde sie schreien […]
„Silberfischchen“ ist ein ungewöhnlicher Roman. Inger-Maria Mahlke erzählt von zwei einsamen Menschen, deren Wege sich zufällig kreuzen. Hermann Mildt, ein verwitweter, frühpensionierter Polizist, ist ein verbitterter und verwahrloster Spießer, egozentrisch und Frauen verachtend. Sein Leben ist trist, aber er will es nicht wahrhaben.
Er verschickte jedes Jahr eine Fünferpackung Weihnachtsgrüße und erhielt ungefähr die gleiche Anzahl an Karten zurück. Korrespondierte regelmäßig mit der tschechischen Firma, von der er sein Fotopapier bezog. Grüßte sich mit fast allen Nachbarn. Wenn er wollte, konnte er seine ehemaligen Kollegen anrufen, er wollte nur nicht.
„Menschen sind manchmal seltsam“, konstatiert Jana Potulski in „Silberfischchen“, eine gut 50-jährige Polin, die sich vorübergehend bei Hermann Mildt einnistet, weil ihr das Portemonnaie geraubt wurde und sie ohne Geld und Ausweis nicht über die Grenze zurück nach Poznań kann. Sie drängt sich ihm gegen seinen Willen auf, aber dann wird ihm ihre Gesellschaft unentbehrlich. Statt es sich einzugestehen, führt er einen zänkischen Kleinkrieg mit ihr, misstraut ihr und verdächtigt sie, ihn vergiften zu wollen.
„Silberfischchen“ ist ein gelungenes, tragikomisches Kammerspiel über zwei skurrile Romanfiguren. Inger-Maria Mahlke wechselt jedoch nicht die Perspektive, sondern versetzt sich ausnahmslos in die Rolle des Mannes. Sie verzichtet auch auf eine übergeordnete Erzählerinnen-Instanz, auf Erläuterungen und Wertungen. Statt zu beschreiben, inszeniert sie – und beweist dabei einen Blick für das Prägnante, auf das sie die Episoden reduziert. Umso dichter ist die Atmosphäre. Mit „Silberfischchen“ bietet Inger-Maria Mahlke eine faszinierende Lektüre auf einem hohen literarischen Niveau.
Inger-Maria Mahlke wurde 1977 in Hamburg geboren, wuchs jedoch in Lübeck auf und verbrachte die Schulferien meistens bei Verwandten auf Teneriffa. Nach dem Jura-Studium an der FU Berlin arbeitete sie am Lehrstuhl für Kriminologie.
2005 nahm sie an einer Autorenwerkstatt mit Herta Müller teil, 2008 an der Autorenwerkstatt der Jürgen-Ponto-Stiftung und 2009 an der Autorenwerkstatt des Literarischen Colloquiums Berlin. Mit einer Passage aus dem „Silberfischchen“-Manuskript gewann sie im Herbst 2009 den 17. „open mike“, und für ihren 2010 veröffentlichten Debütroman „Silberfischchen“ wurde sie mit dem Klaus-Michael Kühne-Preis des Harbour Front Literaturfestivals in Hamburg ausgezeichnet. Weitere Preise folgten, und 2018 erhielt sie den Deutschen Buchpreis für ihren Roman „Archipel“.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2018
Textauszüge: © Aufbau Verlag
Inger-Maria Mahlke: Rechnung offen
Inger-Maria Mahlke: Archipel
Inger-Maria Mahlke: Unsereins