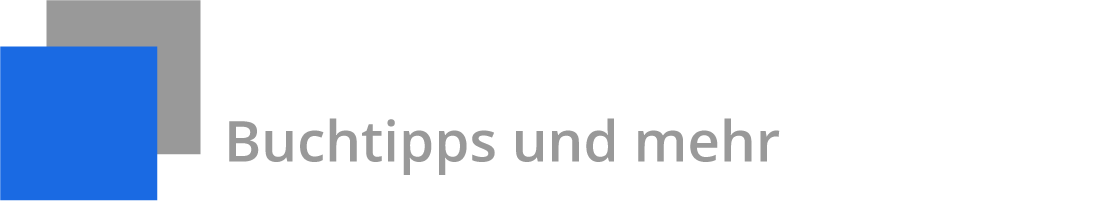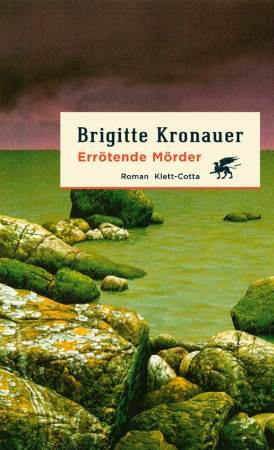Planet Erde

Planet Erde
Inhaltsangabe
(1) Planet Erde. Von Pol zu Pol
(2) Planet Erde. Bergwelten
(3) Planet Erde. Wasserwelten
(4) Planet Erde. Wüstenwelten
(5) Planet Erde. Höhlenwelten
Planet Erde. Eiswelten – Graswelten – Meereswelten – Waldwelten – Tiefseewelten
Inhaltsangabe, Filmkritik
Kritik
Von Pol zu Pol
Erstausstrahlung: ARD, 4. September 2006
Die erste Folge der Naturfilm-Serie führt uns im Zickzack um die Erde, vom Nord- zum Südpol, von der Arktis zur Antarktis, und es geht vor allem um Auswirkungen der Jahreszeiten, die durch die Neigung der Erdachse zur Umlaufbahn entstehen. Durch den Wechsel der Jahreszeiten kommt es zu regelmäßigen Tier-Wanderungen. Wir sehen eine Eisbärenmutter, die nach fünf Monaten ohne Futter im arktischen Frühling aus ihrer Schneehöhle klettert und ihre beiden Jungen, die zum ersten Mal ans Tageslicht kommen, auf die bevorstehende Wanderung vorbereitet. In der arktischen Tundra beobachten wir eine Wanderung von 3 Millionen Karibus, und Wölfe, die junge Karibus jagen. In Japan blühen die Kirschbäume. Eine Elefantenherde durchquert die Kalahari auf der Suche nach Wasser. Der Film endet in der Antarktis, wo gerade die Küken der Kaiserpinguine aus den Eiern schlüpfen.
Bergwelten
Erstausstrahlung: ARD, 11. September 2006
Wir sehen – teilweise aus dem All – die gewaltigsten Bergketten und Gletscher der Erde. Auch in diesen lebensfeindlichen Höhen gibt es Tiere wie Schneeleoparden und Grizzlybären. Der Himalaja wird von fliegenden Jungfernkranichen überquert. Spektakulär sind auch die Aufnahmen von einem aktiven Lavasee in Äthiopien, aus dem seit mehr als 200 Jahren ein Berg wächst.
Wasserwelten
Erstausstrahlung: ARD, 18. September 2006
Wir folgen dem Lauf von Bächen und Flüssen, von den Bergen bis zum Meer, und sehen Tiere, die im Wasser leben. Den Auftakt der Folge bilden eindrucksvolle Aufnahmen von den Tepuis im Süden Venezuelas, wo nach sintflutartigem Regen der Salto Angel entsteht, der mit 979 Metern höchste Wasserfall der Erde. Nicht weniger imposant sind die Iguaçu-Wasserfälle in Brasilien, die den breitesten Wasserfall der Erde bilden.
Wüstenwelten
Erstausstrahlung: ARD, 25. September 2006
Wüsten nehmen auf der Erde fast ein Drittel der Landfläche ein. Der Naturfilm widerlegt das Vorurteil, dass Wüsten unbewachsen und unbewohnt sind. In der Wüste Gobi ist das Baktrische Kamel (Trampeltier) zu Hause. Guanakos überleben in der Atacama-Wüste, indem sie den Tau von Kaktusdornen ablecken. Beim Flug über die Namib beobachten wir sogar Löwen und Elefanten. In der Sahara wurde ein Wüstenfluss gefilmt, der nach einem Regenguss einen Tag lang Wasser führt.
Höhlenwelten
Erstausstrahlung: ARD, 2. Oktober 2006
Die Aufnahmen dieser Folge entstanden in sensationellen Höhlen wie dem 400 m tiefen „Keller der Schwalben“ (Sotano de las Golondrinas) in Mexiko, der erst 1986 entdeckten Lechuguilla-Kristallhöhle in den USA und der von schätzungsweise 3 Millionen Fledermäusen bewohnten Deer Cave in Borneo.
Zweite Staffel
-
- Planet Erde. Eiswelten (Erstausstrahlung: ARD, 26. Februar 2007)
- Planet Erde. Graswelten (Erstausstrahlung: ARD, 12. März 2007)
- Planet Erde. Meereswelten (Erstausstrahlung: ARD, 19. März 2007)
- Planet Erde. Waldwelten (Erstausstrahlung: ARD, 26. März 2007)
- Planet Erde. Tiefseewelten (Erstausstrahlung: ARD, 2. April 2007)
Alastair Fothergill, der Regisseur und Produzent von „Planet Erde“, arbeitet seit 1983 für die BBC – von November 1992 bis Juni 1998 als Leiter der Naturkunde-Abteilung – und machte sich bereits durch die Fernsehreihe „Blue Planet“ („Unser blauer Planet“) einen Namen.
Die Aufnahmen für „Planet Erde“ entstanden im Verlauf von fünf Jahren. Vierzig Kamerateams waren dafür an zweihundert Orten der Erde im Einsatz. Die meisten Aufnahmen wurden mit hoch auflösenden Kameras gedreht (High Definition). Die Jagd von Wölfen auf Karibus in der Arktis und die Treibjagd eines Hyänenhunde-Rudels auf Impalas im Süden Afrikas wären wegen der Geschwindigkeit der Tiere vom Boden aus nicht zu filmen gewesen. Dafür benutzte das Team einen Hubschrauber mit einer ferngesteuerten, kreiselstabilisierten „Heligimbal“-Kufenkamera. Die Robbenjagd eines Haies und die Jagd von Nilkrokodilen auf Gnus wurden mit Ultra-Hochgeschwindigkeitskameras festgehalten, sodass wir die Aufnahmen in brillanter Zeitlupe betrachten können. Im Zeitraffer sehen wir dagegen die Überflutung der Okawango-Sümpfe, die Kirschblüte in Japan und Landschaften im Wechsel der Jahreszeiten. Neu ist dabei, dass die Kamera während einer Zeitrafferaufnahme in Bewegung ist und zum Teil aus der Luft filmt. Immer wieder wechselt die Perspektive: Hin und wieder sehen wir die Erde von einem Satelliten aus, dann beobachten wir beispielsweise eine Elefantenherde teils aus der Luft, teils vom Boden aus und dann auch unter Wasser, wenn sie in einem Fluss plantschen. Durch den aufwändigen Einsatz modernster Technik an unzugänglichen Orten entstand eine Naturfilmreihe mit bisher noch nie realisierten Filmdokumenten in einer noch nie erreichten optischen Qualität.
Alastair Fothergill und Mark Linfield springen in „Planet Erde“ von einem Ort zum anderen und verweilen nie lang bei einem Thema. Deshalb können wir zwar etwas lernen, aber der Wissensgewinn bleibt punktuell und wird nicht in größere Zusammenhänge eingebunden. Dementsprechend sind auch die Kommentare eher trivial. Sehenswert ist „Planet Erde“ für Zuschauer, die sich gern Naturfilme anschauen; sie können in vom BBC Concert Orchestra untermalten opulenten Bildern schwelgen.
„Planet Erde“ ist eine Koproduktion der BBC mit Discovery Channel, NHK/Japan und der kanadischen CBC. Von deutscher Seite waren der Bayerische Rundfunk und der WDR beteiligt.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2006 / 2009
Alastair Fothergill, Andy Byatt: Deep Blue