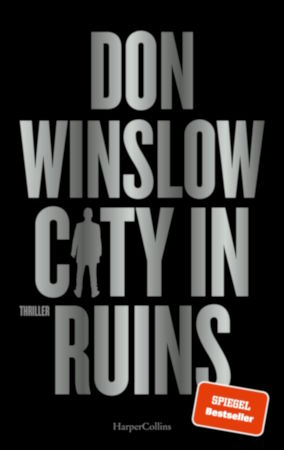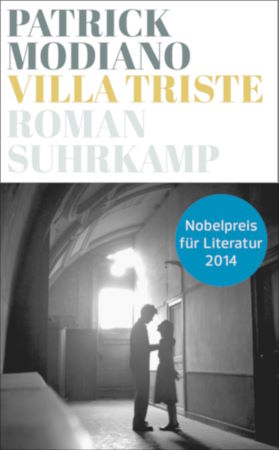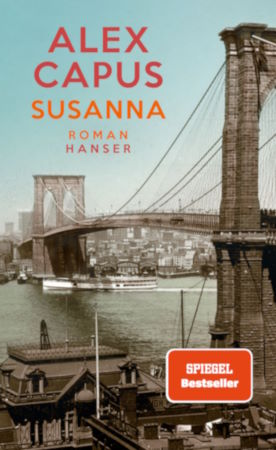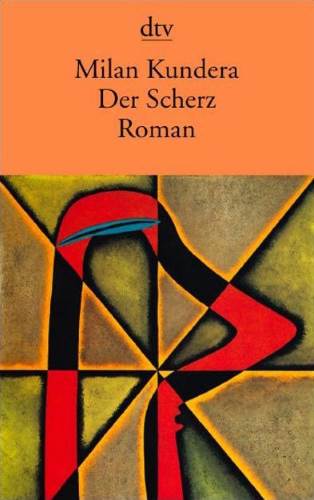Hans-Ulrich Treichel : Menschenflug

Inhaltsangabe
Kritik
Hans-Stephan wird in wenigen Tagen 52 Jahre alt. Das beunruhigt ihn, denn er befürchtet, nicht älter als sein Vater zu werden, der vor 40 Jahren im Alter von 54 Jahren starb. Dass er unter Herzrhythmusstörungen leidet, verstärkt seine Angst. Um die Midlife Crisis zu überwinden und Bilanz zu ziehen, hat er sich ein Jahr Auszeit von seiner Ehe mit der Psychoanalytikerin Helen genommen und ist in eine Dachkammer in Berlin-Steglitz gezogen.
Er hätte freilich nichts dagegen gehabt, wenn seine Familie ein wenig zögerlicher auf seinen Vorschlag reagiert hätte. Mit so viel spontaner Begeisterung über die Aussicht, ihn für ein Jahr los zu sein, hätte er nicht gerechnet, zumal Julia wegen ihrer diversen Praktika und Ruth wegen des Düsseldorfer Studiums nur noch in den Ferien oder am Wochenende zu Hause waren.
Ruth und Julia sind Stephans Stieftöchter; Helen hat sie aus ihrer ersten Ehe mitgebracht. Ruth studiert Textildesign an einer Fachhochschule in Düsseldorf. Das Geld für den Lebensunterhalt verdient vor allem Helen, denn Stephan hat nur eine halbe Stelle als Akademischer Rat im Bereich Deutsch als Fremdsprache an der Freien Universität. Er ist vorwiegend mit Verwaltungsaufgaben beschäftigt.
Stephan hat zwei ältere Schwestern. Mit Waltraut hätte er wohl eine inzestuöse Beziehung gehabt, wenn sie ihn nicht sanft abgewehrt hätte. Sie ist mit Gerhard verheiratet, einem Cousin zweiten Grades, mit dem sie im Lippischen einen Bauernhof bewirtschaftet. Sie kommt oft tagelang nicht aus den Gummistiefeln heraus. Gerda war lange Zeit mit einem Steuerberater verheiratet. Inzwischen lebt sie in einer luxuriösen Eigentumswohnung in Bad Pyrmont und ist mit einem verwitweten Rechtsanwalt namens Philipp liiert. Eigentlich wären die Geschwister zu viert, aber der ältere, am 24. September 1943 geborene Bruder ist verschollen. Im Januar 1945 hatten sich die Eltern mit ihm in Rakowiec (Kreis Gostynen) einem Flüchtlingstreck angeschlossen. In der Nähe von Konin waren sie von Soldaten der Roten Armee aus dem Konvoi herausgeholt worden. Die Russen hatten gedroht, den Vater zu erschießen und die Mutter zu vergewaltigen. Da hatten diese ihren kleinen Sohn einer Fremden überlassen und waren in den nahen Wald geflüchtet.
Als Stephan das erfuhr, erinnerte er sich, wie ihn seine Mutter an sich gedrückt hatte, als ob sie den Verlorenen aus ihm herauspressen wollte. Er leidet noch immer unter der Vorstellung, dass er für seine Eltern vielleicht nur der Ersatz des Verlorenen war. Darüber schrieb er einen teils authentischen und teils fiktiven Roman.
Stephan hatte kein Schicksal, sondern nur schlechte Schulnoten, einen cholerischen, arbeitswütigen Vater und eine von Schuldgefühlen und der Sehnsucht nach ihrem Kind zermürbte Mutter gehabt.
Bei einer Autorenlesung in Bremerhaven sprach ihn ein Zuhörer an, der als Findelkind aufgewachsen war und sich selbst als Verlorener bezeichnete. Stephan befürchtete, es könne sich um seinen Bruder handeln und wollte nichts mit ihm zu tun haben, aber der Mann war so aufdringlich, dass er sich schließlich mit ihm in einer Pizzeria in Berlin verabredete. Dort bot Wilhelm – so hieß er – ihm das Du an.
Ein frühverrenteter, trinkender, elternloser, von seiner eigenen Münzsammlung deprimierter Münzsammler, der nichts anderes als seine Lebenstragödie im Kopf hatte.
Mit Ausnahme der Tatsache, dass er einen älteren Bruder hat, von dem er nichts weiter weiß, hat Stephan sich bisher nicht für die Vergangenheit interessiert. Erst jetzt, als er Bilanz zieht, hätte er gern mehr über seine Eltern gewusst. Fragen kann er sie nicht mehr. Auch die Mutter ist tot. Sie starb 1991.
In einer Schublade hat er einen Antrag auf Lastenausgleich und einen handgeschriebenen Lebenslauf seines Vaters aufbewahrt. Daraus geht Folgendes hervor: Sein Vater wurde am 1. Dezember 1909 in Bryszcze (Kreis Luzk) geboren. Er gehörte zu den Deutschen in Wolhynien, einer Landschaft in der nordwestlichen Ukraine. Bis 1939 arbeitete er auf dem Bauernhof seiner Eltern. Dann musste er in den Krieg. Am 5. September 1941 wurde ihm wegen einer schweren Verwundung der rechte Arm amputiert. Nachdem er und seine Frau Anfang 1945 ihr damals einziges Kind auf der Flucht verloren hatten, mussten sie ein Jahr lang Zwangsarbeit in Polen leisten. 1946 wiesen die Behörden den Flüchtlingen den Ort in Norddeutschland zu, in dem dann Stephan und seine Schwestern geboren wurden.
Während eines Besuchs bei Waltraut und ihrem Mann lernt Stephan Gerhards Onkel Ernst kennen, einen Greis, der in Wolhynien Nachbar von Stephans Großeltern und seines Vaters gewesen war. Onkel Ernst hat sich eingehend mit seiner verlorenen Heimat beschäftigt und mehrere Arbeiten darüber geschrieben, so zum Beispiel „Schicksalswege einer wolhyniendeutschen Familie“. Er schickt Stephan ein Paket mit Kopien.
Stephan nimmt sich vor, selbst nach Wolhynien zu fahren und ein Buch darüber zu schreiben. Aber dann entdeckt er zufällig ein Buch, das ein Amerikaner unter dem Titel „Eine Reise nach Wolhynien“ veröffentlicht hat. Kurz darauf stirbt Onkel Ernst, und Stephan fährt zur Beerdigung nach Goslar. Der Sohn und die Schwiegertochter, die eine Versicherungsagentur betreiben, lassen ihn in den hinterlassenen Aktenordnern lesen. Dadurch kommt Stephan zu dem Schluss, dass eigene Nachforschungen nichts mehr bringen würden und gibt den Plan auf, nach Wolhynien zu fahren.
Stattdessen schlägt er Helen vor, ungeachtet der vereinbarten Auszeit in der Ehe gemeinsam nach Ägypten zu reisen. Er bucht drei Tage Kairo und sieben Tage Luxor. Drei Tage vor der Abreise telefoniert Ruth mit ihrer Mutter und klagt, dass es ihr nicht gut gehe. Sie wolle ihr Studium abbrechen. Helen lädt sie deshalb ein, zu ihr nach Berlin zu kommen und sagt die Ägypten-Reise ab. Stephan will sich zunächst ebenfalls um Ruth kümmern, aber davon hält Helen nichts; sie drängt ihn, allein nach Kairo zu fliegen.
Nach der Besichtigung der Großen Pyramide von Gizeh reist Stephan weiter nach Luxor. Obwohl er ein Fahrrad gemietet hat, hängen sich Taxifahrer und Bootsleute wie Kletten an ihn. Allerdings ist niemand in der Nähe, als er einen platten Reifen hat. Zum Glück hält ein Pickup neben ihm. Am Lenkrad sitzt eine etwa gleichaltrige rotblonde Frau, die ihm bereits im Hotel in Kairo auffiel und die er für eine Engländerin hielt. Sie nimmt ihn mit. Es handelt sich bei ihr allerdings nicht um eine Engländerin, sondern um eine deutsche Archäologin der Universität Bonn mit dem Vornamen Mercedes. Sie ist mit der Erforschung eines Grabes im Tal der Könige beschäftigt. Dabei inventarisiert sie allerdings nicht die ursprünglichen Grabbeigaben, sondern die Hinterlassenschaften Howard Carters. Sie erforscht also die Entdeckungsgeschichte, nicht das Altertum selbst.
Als sie genug für diesen Tag getan hat, bringt sie Stephan zu seinem Hotel zurück, und weil sie in einer von der Universität gemieteten schlichten Privatwohnung untergebracht ist, nimmt sie seine Einladung an, mit ihm im Pool zu schwimmen. Ihren Badeanzug hat sie dabei. Danach geht sie mit auf sein Zimmer, zieht sich dort ungeniert aus und trocknet sich ab. Als sie zusammen aufs Bett sinken, hat Stephan ein schlechtes Gewissen gegenüber Helen und deshalb Erektionsprobleme, aber Mercedes sorgt dafür, dass er doch noch in sie eindringen kann. Danach kleidet sie sich an und geht mit den Worten: „Ich werde mich gern an dich erinnern.“
Zurück in Berlin, erfährt Stephan, dass Ruth inzwischen in eine psychiatrische Klinik bei Rendsburg gebracht wurde. Sebastian habe die Einrichtung empfohlen, sagt Helen, und dafür gesorgt, dass Ruth sofort aufgenommen wurde. Bei Sebastian, einem hochrangigen Beamten beim Berliner Senator für Gesundheit und Soziales, handelt es sich um Helens geschiedenen Ehemann und den Vater der beiden Töchter.
Dass Helen und Sebastian sich zu einer Fortbildung in Schwangau angemeldet haben, missfällt Stephan noch mehr als die Sorge des leiblichen Vaters für seine Tochter.
Er hält zwar nichts vom Joggen, weil das seinen Gelenken nicht gut tut, aber er geht und trabt des Öfteren ein Stück. Der Weg führt an einer Klinik vorbei. Stephan hört und sieht deshalb nicht selten einen Rettungshubschrauber. Wenn er vor dem Lilienthaldenkmal steht, blickt er dem nackten geflügelten Knaben von unten aufs Gemächt. Auf einer am Sockel angebrachten Plakette heißt es: „Dem Vater des Menschenfluges zum 100. Geburtstag“. Als ihm beim Laufen übel wird, sucht er seinen Internisten auf, der ihn in die kardiologische Abteilung des Klinikums Steglitz einweist, wo er ein paar Tage bleiben soll, damit mehrere Untersuchungen durchgeführt werden können.
Helen bringt ihm seinen Toilettenbeutel, Wäsche und Schlafanzüge. Den Kurs in Schwangau sagt sie ab. Wilhelm, der gerade Verwandte in Berlin besucht und von Helen am Telefon erfuhr, wo Stephan zu finden ist, besucht ihn und erzählt ihm, er habe inzwischen den Stammbaum seiner Adoptiveltern erforscht. Stephan soll die Arbeit lesen, aber er hat keine Lust dazu.
Mit der Diagnose „arteriosklerotische Veränderungen der Herzkranzgefäße“ wird Stephan aus dem Krankenhaus entlassen.
Schließlich ringt er sich dazu durch, den Suchdienst anzurufen. Dabei erfährt er, dass er keinen neuen Antrag zu stellen brauche, weil der alte noch laufe. Man schickt ihm sogar die Akte. Das älteste Dokument darin ist vom 3. Dezember 1953. Bisher nahm Stephan an, seine Eltern hätten erst 1959 begonnen, nach dem verlorenen Sohn zu suchen. In einer protokollierten Rundfunk-Suchmeldung heißt es, der Gesuchte sei aus Remki, Kreis Gostynin. 1959 entdeckte Stephans Mutter offenbar in der Zeitung „Freie Presse“ das Foto eines Findelkindes, das sie sogleich für ihren verlorenen Sohn hielt. Stephan findet auch, dass der Junge ihm und Gerda ähnelt. Das um 1944 geborene Kind, von dem man nicht wusste, wie es hieß, erhielt den Namen Hermann Stäub. Ein Blutgruppenvergleich zeigte zwar, dass die Verwandtschaft möglich war, aber beweisen ließ sich das Eltern-Kind-Verhältnis nicht. Hermann wuchs bei Pflegeeltern auf.
Im elektronischen Telefonbuch findet Stephan einen Hermann Stäub in Celle. Er wählt die Nummer, und tatsächlich meldet sich ein Mann mit dem Namen Stäub. Stephan legt wieder auf, ohne etwas zu sagen; er weiß jetzt, dass Hermann Stäub noch lebt. Um mit ihm zu reden, will er nach Celle fahren.
Waltraut hat nichts dagegen einzuwenden, als Stephan mit ihr am Telefon darüber redet. Aber Gerda fordert ihn auf, nichts zu tun, bevor sie nicht mit Waltraut und ihrem Freund Philipp darüber gesprochen habe. Sie arrangiert ein Familientreffen bei Waltraut und Gerhard auf dem Bauernhof und bringt auch den Anwalt mit. Philipp weist darauf hin, dass ein Bruder Erbansprüche habe. Nur falls er adoptiert worden sei, könne er keine Forderungen gegen seine Geschwister geltend machen. Da der Mann in Celle jedoch noch so heißt, wie in den Unterlagen von 1959, hält Philipp es für unwahrscheinlich, dass Hermann Stäub adoptiert wurde. Waltraud, Gerda und Stephan erhielten nach dem Tod der Mutter 180 000 D-Mark pro Person. Sie müssten Hermann Stäub ein Viertel der Gesamtsumme abtreten: 135 000 D-Mark. Stephan müsste einen Kredit für aufnehmen, aber er wäre bereit, seinen Anteil zu geben. Gerda und Gerhard sind das nicht. Waltraut verschwindet in der Küche. Stephan folgt ihr, und sie vertraut ihm an, dass sie und Gerhard verschuldet sind, den Hof verkaufen müssen und befürchten, dass der Erlös nicht für die Rente reicht.
Stephan will sich diesen Hermann Stäub wenigstens einmal ansehen. An einem Samstag fährt er mit dem Zug nach Celle und schlendert vor dem Haus herum, in dem Hermann Stäub wohnt. Er bleibt nicht lange unbemerkt, zumal es sich um einen Privatweg handelt. Jemand beobachtet Stephan, zunächst durch die Gardine, dann unverhohlen am offenen Fenster. Damit er nicht für einen Einbrecher gehalten wird, der ein Objekt auskundschaftet, klingelt Stephan. Sofort fällt ihm auf, wie ähnlich Hermann Stäub ihm sieht. Der Mann geht an Krücken. Stephan fragt nach einem „Herrn Schneider“ und tut so, als habe er sich in der Adresse geirrt. Statt zu antworten, hebt Hermann Stäub drohend eine Krüke. Eine Frau bringt ihm eine volle Einkaufstüte und weist Stephan darauf hin, dass er sich auf einem Privatweg befindet. Sie wartet im Auto, bis sie sich vergewissert hat, dass er zum Bahnhof geht.
Dort steigt Stephan einfach in den nächsten Zug. Der fährt nach Uelzen, wo an diesem Wochenende zufällig ein Wolhyniertreffen stattfindet. Stephan geht hin, isst Hühnerfrikasse und Kuchen. Der Tisch mit dem Schild „Bryszcze“ bleibt leer. Ohne mit jemand gesprochen zu haben, kehrt Stephan nach Berlin zurück.
Helen sagt er, der Mann in Celle sei nicht sein Bruder.
Sie nimmt ihn mit in ihre Praxis und zeigt ihm zwei teure Seidenteppiche, die sie sich kaufte. Zum ersten Mal überhaupt will sie es mit ihm auf der Patientencouch treiben, doch gerade als sie den Büstenhalter abgelegt hat, klingelt es. Stephan verlässt die Praxis und geht zum Lilienthaldenkmal, um sich die Zeit zu vertreiben. Er freut sich auf den Sex mit seiner Frau nach der Therapiestunde.
Plötzlich bricht er zusammen und schlägt mit der Stirn auf. Jemand telefoniert. Er wird auf eine Trage gehoben und in einen Wagen geschoben, der dann beim Fahren einen Riesenlärm macht.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Stephan hob ab. Stephan hob ab wie ein Schwan, stieg auf wie der geflügelte Knabe. Er sah den Uferweg. Er sah den Kanal. Am anderen Ufer stand Hermann, hob seine Krücke und winkte ihm zu. Er drohte ihm nicht, sondern winkte ihm zu. Die Uferplatanen rauschten, Stephan spürte den Wind in den Haaren und dann einen Luftstrom zwischen den Schultern. Er flog, er war sich ganz sicher. Er flog den Menschenflug.
„Menschenflug“ ist eine Mischung aus Flüchtlingsdrama und Midlife-Crisis-Roman. Hans-Ulrich Treichel knüpft damit an seinen 1998 veröffentlichten Roman „Der Verlorene“ an.
Er hat „Menschenflug“ in drei Teile gegliedert. Im ersten beginnt Stephan sich halbherzig mit der Familiengeschichte zu beschäftigen. Dann sucht er Ablenkung durch eine Ägyptenreise, bei der er sich trotz Gewissensnot auf einen Seitensprung einlässt. Im dritten Teil stößt er auf einen Mann, der sein verschollener Bruder sein könnte. Seine beiden älteren Schwestern, die das Erbe nicht mit einem Vierten teilen wollen, halten ihn jedoch davon ab, der Sache auf den Grund zu gehen.
Der mittlere Teil soll wohl eine Fluchtbewegung des Protagonisten veranschaulichen, ist aber mit 69 Seiten zu lang geraten, zumal Hans-Ulrich Treichel auch nichts anderes als die Klischees von lästigen Ägyptern eingefallen ist, die für sinnlose Dienste Trinkgelder verlangen. Witzig ist in diesem Abschnitt, dass die Archäologin im Tal der Könige nicht den Originalzustand eines Grabes erforscht, sondern die Hinterlassenschaft des Entdeckers Howard Carter inventarisiert.
Auch sonst sind in „Menschenflug“ einige Szenen aufgrund von überraschenden Beobachtungen oder komischen Wendungen durchaus gelungen. Ein gutes Beispiel ist der folgende Dialog:
Helen meinte, dass [die Tochter] Julia ein wenig distanziert sei, weil sie seit einiger Zeit eine Freundin hatte. „Eine Freundin?“, fragte er zurück. „Jawohl“, sagte sie, „aber lass dir nichts anmerken.“ „Was soll ich mir denn anmerken lassen?“, antwortete er. „Du weißt schon“, sagte Helen nur. Und dann sagte sie noch: „Wir lassen das Thema am besten ruhen.“
Ebenso viele Passagen sind allerdings misslungen. Das gilt auch bezüglich der Sprache:
Aber zugleich musste er zugeben, dass sich, seit er fünfzig geworden war und beinahe das Lebensalter [gemeint: Sterbealter] seines Vaters erreicht hatte und trotz seiner sozusagen heldenhaften Vorsätze, sich so wenig wie möglich von der Vergangenheit behelligen zu lassen, immer öfter eine Sehnsucht nach alten Papieren seiner bemächtigte.
Als er Helen von Waltrauts Geburtstagsfeier berichtet hatte, zu der sie wohl eingeladen war, aber die Einladung aus beruflichen Gründen nicht hatte annehmen können, hatte er ihr einiges über Onkel Ernsts Familienforschungen, aber nur wenig von Waltraut erzählt.
Hans-Ulrich Treichel schreibt zwar in der dritten Person Singular, aber aus der subjektiven Perspektive der Hauptfigur. Leider lässt sich an diesem langweiligen Durchschnittsmenschen nichts entdecken, womit man sich identifizieren könnte. Deshalb bleibt man als Leser unbeteiligt. Darüber hinaus fehlt es „Menschenflug“ an Tiefe. Das Wenige, was an Handlung vorhanden ist, plätschert vor sich hin und wird mitunter von Zufällen gelenkt.
Den Roman „Menschenflug“ von Hans-Ulrich Treichel gibt es auch als Hörbuch, gelesen von Leonard Lansink (Regie: Felicitas Ott, Berlin 2006, 4 CDs, ISBN 3-89813-512-8).
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2013
Textauszüge: ©
Hans-Ulrich Treichel: Der Verlorene (Verfilmung)
Hans-Ulrich Treichel: Tristanakkord