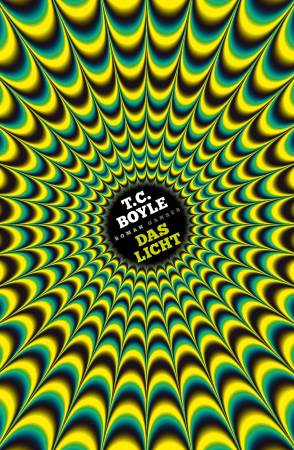Emil Strauß : Freund Hein
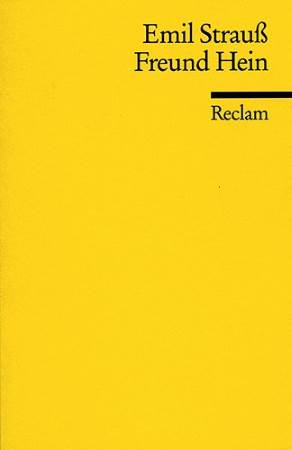
Inhaltsangabe
Kritik
Als der erfolgreiche badische Rechtsanwalt Lindner seinen neugeborenen Sohn erstmals mit vorgewärmten Händen aufnimmt, wünscht er sich, dass dieser nicht nur Advokat, sondern Staatsanwalt werde. Die Eltern nennen das auf den Namen Heinrich getaufte Kind Heiner, und der Vater ruft ihn hin und wieder „Walt“ (von Staatsanwalt). Der wohlbehütet aufwachsende Junge setzt sich gern in ein Gebüsch im Garten und lauscht auf das Zwitschern der Vögel. Offenkundig verfügt er über ein besonders feines Gehör. Einmal steht er vor einer Militärkapelle und wartet auf den Beginn des Spiels, aber als dann „alle Instrumente auf einen Schlag mit einem schmetternden Marsch“ losbrechen, zuckt er zusammen und rennt davon.
Als Schüler freut sich Heiner über das gelegentliche Klavierspiel seiner Mutter, und er überredet sie, ihm eine kleine Melodie beizubringen, die der dann stolz dem Vater vorspielt. Er möchte gern Klavierunterricht, aber die Eltern zeigen ihm, dass seine Hände noch zu klein sind, um eine Oktave greifen zu können und vertrösten ihn auf später. Sobald Heiner das Zimmer verlassen hat, mahnt der Vater die Mutter, den Sohn möglichst von der Musik fernzuhalten, weil er „keinen verträumten Musikanten, sondern einen lebensklaren, tatkräftigen Mann“ aus ihm machen will.
Im Nachbarhaus wechseln die Bewohner. Ein freches Mädchen – es heißt Helene Mahler – wohnt da jetzt und befreundet sich rasch mit dem gleichaltrigen Heiner, wundert sich aber darüber, dass er seiner Mutter aufs Wort folgt. Für sie ist das neu, aber ihre Eltern sind ganz anders als die von Heiner: Helenes Vater will seine Ruhe, und die Mutter ist zwar nicht dumm, aber unzufrieden und launisch; von ihr wird Helene „bald verwöhnt, bald verprügelt, oftmals für etwas gestraft …, was ihr vor fünf Minuten erlaubt worden war“. Helene hängt sich wie eine Klette an ihren neuen Freund, und sobald er sich mit anderen abgibt, fährt sie eifersüchtig dazwischen, auch wenn er auf Anordnung seiner Mutter mit seiner kleinen Schwester Stephanie spielt. Erst allmählich begreift Helene, dass sie auf diese Weise nichts erreicht, und durch den Umgang mit Heiner wird sie sogar etwas braver und zurückhaltender.
Ungeduldig wartet Heiner, bis er am Klavier eine Oktave greifen kann. Dann fragt er seinen Vater wieder nach dem in Aussicht gestellten Musikunterricht. Der Vater hat es kommen sehen, eine Kindergeige gekauft und überredet den Jungen nun zum Violinenspiel, weil er hofft, durch das schwieriger zu erlernende Instrument eine höhere Barriere zu errichten. Aber Heiner wird nicht müde, zu üben und zeigt dabei ein außergewöhnliches Talent.
Herr Mahler wird versetzt. Die Familie zieht fort, und Helene besucht ihren Freund nur noch ab und zu in den Ferien. Da wohnt sie dann bei der Familie eines Paten in der Stadt.
Als Stephanie Klavierunterricht erhält, schaut Heiner zu, übt heimlich und überholt mit seinem Können bald seine Schwester. Als er für eine „richtige“ Violine groß genug ist, holt der Vater sein Instrument aus dem unter dem Bett aufbewahrten Geigenkasten. Er schenkt das wunderbare italienische Instrument seinem Sohn und erzählt ihm, wie es der Großvater – ein Geiger und Kapellmeister – auf abenteuerliche Weise in einem Wirtshaus für wenig Geld erstand. Heiner bekommt aber auch zu hören, warum sein Vater den Geigenkasten seit 24 Jahren nicht mehr geöffnet hat: Während des Jurastudiums hatte er viel musiziert, aber als er kurz vor dem Examen merkte, welche Lücken er noch aufholen musste, legte er die Violine in den Kasten und brachte sie zu einer Tante. Auch nach dem erfolgreichen Studienabschluss rührte er sie nicht mehr an, weil er Angst hatte, dass ihn die Musik von seiner Karriere ablenken könnte.
Wegen ungenügender Leistungen in Mathematik muss Heiner die Obersekunda wiederholen.
In den Ferien kommt Helene, die inzwischen ein Pensionat in Genf besucht, „als fertige, sichere, von Lebenslust strahlende junge Dame“ und „elegant bis in die Fingerspitzen“ von einem Kuraufenthalt mit ihrer Mutter aus Bad Kissingen.
Ein neuer Mitschüler wird in Heiners Klasse aufgenommen: Karl Notwang, der Sohn eines reichen Affentaler Weinbauern, der trotz seiner Klugheit und seines umfangreichen Wissens schon von mehreren Schulen verwiesen wurde, weil er sich von den Lehrern nichts gefallen ließ. Der selbstbewusste Junge – der für Hölderlin schwärmt – bemerkt Heiners großes Verständnis für Musik und Dichtung und bietet ihm seine Freundschaft an.
Karl sieht keinen Sinn darin, dass sich der Freund an der Mathematik aufreibt und ist bereit, ihm bei Schul- und Prüfungsarbeiten heimlich zu helfen. Doch Heiner lehnt jede unerlaubte Unterstützung ab und zeigt Verständnis für das Schulsystem: „Ein Lehrer kann nur nach den Leistungen gehen.“ Da ist Karl anderer Meinung: „Nein, diese Voraussetzung wäre eben Leichtsinn! Er war auch einmal Schüler und muss wissen, mit wem er es zu tun hat, und muss die Leistungen immer multiplizieren mit dem Wesen des betreffenden Schülers oder dadurch dividieren, je nachdem!“ Doch er kann Heiner nicht überzeugen: „… aber – aber – die Leute, so borniert einzelne sein mögen, tun ihre Pflicht, so gut sie halt können; so ganz rosig wird sie ihnen auch nicht immer sein. Und dadurch, dass ich überhaupt im Gymnasium bin, hab‘ ich mich ihren Ansprüchen und ihrem Urteil unterworfen.“
Obwohl Heiner mit größtem Eifer büffelt und Nachhilfestunden nimmt, droht er in der Unterprima erneut zu scheitern. Der Vater verbietet ihm schließlich, an Schultagen das Klavier oder die Violine anzurühren. Heimlich stillt Heiner sein Bedürfnis nach Musik, in dem er in Libretti, Opernpartituren und Kompositionen seines Großvaters blättert, die er in einem Seitenflügel des Dachgeschosses entdeckt hat.
Kurz vor dem Ende des Schuljahres sucht er seinen Mathematiklehrer in dessen Wohnung auf, aber als er kein Verständnis findet, sagt er enttäuscht: „Ich dachte, es sei einem Lehrer, der mit einer Zahl über das Wohl und Wehe eines Schülers entscheidet, auch wertvoll, über so einen Schüler und seine Sorgen mehr zu erfahren, als gerade auf der Schulbank laut werden darf, weil es doch noch eine feinere Waage gibt als so ein Notizbuch …“ Weiter kommt er nicht. Der Lehrer brüllt ihn nieder: „Jetzt können Sie reden, in der Schule kriegt man nie eine Antwort von Ihnen!“
Das Schulzeugnis lässt Heiner liegen. Allein geht er in den Wald. Drei Beeren pflückenden Kindern, deren Vater sich die Hand mit einer Fräse abgetrennt hat, schenkt er das ganze Geld, das er bei sich hat. Auch nachts geht er nicht nach Hause.
Dort warten nicht nur die Eltern, sondern auch Karl und Helene auf ihn. Sein Freund ahnt, dass Heiner nicht mehr zurückkehren wird, und er kritisiert dessen Vater: „Gott sagt zu Heiner: Du sollst mir singen, sollst mir die schweren Herzen auf der Erde leicht machen und die leichten schwer! Und Sie sagen: Nein, du musst mir mit Logarithmen rechnen und Gleichungen mit mehreren Unbekannten lösen! – Von Vermessenheit abgesehen, hat das irgend Verstand? Sie verlangen doch auch nicht von jeder Amsel, sie soll den Göpel ziehen.“
Am anderen Morgen setzt Heiner eine Pistole an die Stirn, besinnt sich, setzt sie auf die Brust und schießt sich ins Herz.
Drei Marktfrauen finden seine Leiche. Eine, die Heiners Eltern seit langer Zeit mit Butter und Eiern beliefert, lädt ihre Körbe und Eimer auf die Karren der beiden anderen Frauen um und bringt den toten Jungen nach Hause.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Die Handlung des Romans „Freund Hein“ spielt wohl in Karlsruhe und auf jeden Fall im Badischen. Das Lokalkolorit untermalt die neuromantische Darstellung der Spannung zwischen Künstlertum und Bürgertum bzw. Schöpferischem und „Vernünftigem“, mit der Emil Strauß vor einem Werteverfall und einem verständnislos ausgeübten schulischen Leistungsdruck warnt. Gerade das letzte Thema ist 100 Jahre nach der Veröffentlichung des Romans wieder aktuell.
Emil Strauß wurde am 31. Januar 1866 als Sohn eines Pforzheimer Schmuckwarenfabrikanten geboren und entstammte einer österreichischen Musiker- bzw. einer badischen Pfarrerfamilie. Sein Großvater war 40 Jahre lang Hofkapellmeister in Karlsruhe. 1885 bis 1890 studierte er Germanistik, Philosophie und Nationalökonomie, dann betätigte er sich lange Zeit als Landwirt – 1892 bis 1894 in Brasilien –, und fand schließlich seine Berufung als Schriftsteller.
Er unterstützte den nationalsozialistischen „Kampfbund für deutsche Kultur“, trat 1931 demonstrativ aus der Preußischen Akademie aus und wurde erst nach deren „Neuordnung“ 1933 wieder Mitglied. 1936 folgte er einem Ruf in den Reichskultursenat.
Er starb am 10. August 1960 in Freiburg im Breisgau.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2002
Textauszüge: © Jürgen Schweier Verlag, Kirchheim/Teck