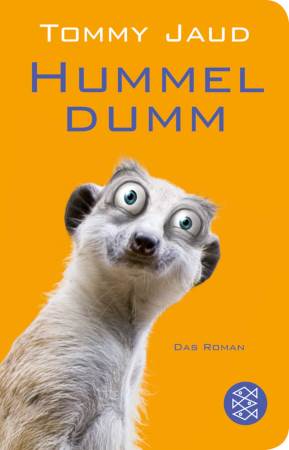Otto de Kat : Mann in der Ferne

Inhaltsangabe
Kritik
Der etwa sechsunddreißig Jahre alte Erzähler sitzt in einer Hotelhalle in New York. Über die Zeitung hinweg, die er sich uninteressiert genommen hat, beobachtet er eine ungefähr zehn Jahre jüngere attraktive Frau, die hereinkommt und offenbar von dem Mann neben ihm erwartet wird.
Während er den beiden zusieht und zuhört, erinnert er sich, wie er vor zwanzig Jahren als Schüler in der griechischen Tragödie „Antigone“ von Sophokles die Rolle des Haimon spielte: „Haimon, Sohn eines übermächtigen Vaters, Geliebter einer sehr radikalen Frau. Tragisches häufte sich, Tod, Verfluchung, Liebe und Wahnsinn im Übermaß“. Dann fällt ihm ein, wie er mit seinem Vater und seinem Bruder Eis laufen war. Wie er mit seinem Vater Auktionshäuser in Dordrecht besuchte. Oder wie sein Vater überraschend am Strand zwischen Katwijk und Noordwijk aan Zee auftauchte, um ihm beim Golfspielen zuzusehen. Vor zwanzig Jahren, da beherrschte eine sechzehnjährige Mitschülerin aus einer Klasse über ihm jede Minute seines Tages. Er denkt daran, wie ihn während der Fasnacht in Zürich unvermittelt eine fremde junge Frau auf den Mund küsste und gleich wieder in der Menge verschwand.
1967, im Sechstagekrieg, hofften er und sein Freund E. auf einen Sieg der Israelis über die Palästinenser. Damals waren sie nicht viel älter als zwanzig. Ein paar Monate nach dem Krieg reisten sie begeistert nach Israel. Im Jahr darauf verfolgten sie den Prager Frühling. Ein paar Jahre später wurde E. auf einem Gebirgspass in Afghanistan totgefahren.
Während seines Postgraduiertenstudiums in Cambridge verzehrte er sich in ebenso obsessiver wie unerfüllbarer Liebe zu K. (E’s Witwe?), die den Unfall, bei dem ihr Mann getötet worden war, verletzt überlebt hatte.
Ebenfalls in Cambridge lernte er einen jungen, mit einer Deutschen namens Sabine verheirateten Amerikaner kennen, Roy Dawson.
Er beneidete Roy um dessen Mangel an Fantasie. Roy liebte das Glänzen seines Motorrads, er tat die Dinge, die er tun konnte. Darin folgte er einem untrüglichen Instinkt. In Amerika hatte er die Schriften des deutschen Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer kennen gelernt. Bonhoeffer, einer mit unvergleichlichem Talent, bis zum Ende für eine Sache zu kämpfen, diszipliniert und radikal: allein in der Tat ist die Freiheit, Roy war prompt nach Deutschland gereist, um sich dort mit ihm zu beschäftigen. Die erste junge Frau, die er in Göttingen traf, war die Tochter Bethges, des Freundes und Biografen seines Idols Bonhoeffer. Er heiratete sie, und manchmal wusste er nicht, ob er sie um ihretwillen oder wegen der Gespräche mit ihrem Vater gewählt hatte. Lange hielt er sich mit dieser Frage nicht auf.
In den Siebzigerjahren überredete ihn eine Bekannte, Ellen, mit ihr zu einem Kongress nach Budapest zu fliegen. Sie verschaffte ihm auch die Telefonnummer von Vera, einer ungarischen Tänzerin, die ihn bei einem Auftritt in der Botschaft ihres Landes in Den Haag fasziniert hatte. Er verabredete sich mit Vera, doch als er sie mit ihren Schülerinnen tanzen sah, blieb er im dunklen Korridor stehen, schloss kurz die Augen, drehte sich um und reiste aus Budapest ab, ohne noch einmal von sich hören zu lassen.
Immer wieder muss er an den Tod seines Vaters denken. Eine Nachbarin rief ihn damals an. Sein Vater sei ins Krankenhaus gebracht worden. Sofort setzte er sich ins Auto und fuhr ins Hafenkrankenhaus. Dort erwarteten ihn sein Bruder und seine Mutter. Der Vater war bereits tot.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Stilistisch erinnert „Mann in der Ferne“ an „Die folgende Geschichte“ von Cees Nooteboom. In seinem sehr poetischen Debütroman erzählt Otto de Kat keine durchgehende Handlung, sondern er lässt uns teilhaben an den assoziativ verknüpften Erinnerungen seines melancholischen Ich-Erzählers, eines etwa sechsunddreißigjährigen Niederländers, der nicht darüber hinwegkommt, dass sein Vater starb, bevor er ein letztes Mal mit ihm reden konnte. Der Erzähler bleibt passiv: Er beobachtet, statt aktiv einzugreifen, und er droht sich in seinen Erinnerungen zu verlieren.
Er lebte rückwärts. Hörte, sah, fühlte, dachte rückwärts.
Er hatte Angst, dass er alles verpasste, dass das ganze Leben ohne irgendein Eingreifen von seiner Seite an ihm vorübergehen werde. Und dass er die paar geliebten Menschen, die er hatte, verlieren müsse.
Menschen gehörten zur Ausstattung der Welt, sie waren da, aber man kannte sie nicht. Sie existierten, aber man hatte keine Verbindung zu ihnen, sie hatten keine bleibende Form oder Gestalt.
Einmal sagt ein Unbekannter zu ihm:
„Was vorbei ist, existiert erst wirklich. Wenn man weitergeht und sich umblickt, sieht man Spuren und das Gelände, durch das die Spuren führen. Die Vergangenheit ist das einzige, das Halt bietet. Es geschieht nichts, was nicht schon viel früher in Gang gesetzt worden ist. Authentizität, Originalität, das sind Phrasen, und Identität kann man ruhig auch noch dazusetzen, das bedeutet alles nichts. Alles nur Gerede mit geschlossenen Augen. Wir sind Batterien, die mit dem geladen worden sind, was wir in unseren Genen mitbekommen haben. Was in all den Jahrhunderten vor uns entschieden wurde und verpfuscht und auf ewig verflucht, das schiebt uns vor sich her. Wirklichkeit – die kann man vergessen, und ganz besonders Wahrheit, und Zukunft erst recht. Die Zukunft ist für dich und mich der Tod. Wenn man nach vorn blickt, erreicht man damit nur eins: man entdeckt ein Grab.“
Auch ein Bekannter, der für einen Geheimdienst arbeitet, hält die Realität für eine Täuschung:
Beim Geheimdienst werde einem erst klar, dass es gar keine Wirklichkeit gebe. Wenn man im Hinterhalt liege, erkenne man erst richtig, dass die sogenannte Wirklichkeit eine zufällige Ansammlung von Fragmenten sei. Niemand verstehe irgend etwas, niemand. Auch der kleinste Bruchteil des eigenen Daseins passe nirgendwo in ein größeres Ganzes. Es gebe kein größeres Ganzes, gerade die Vorstellung, es gebe ein Ganzes, sei ein Phantom.
Dazu passt der Inhalt eines Buches, das der Erzähler gelesen hat. Er fasst den Inhalt folgendermaßen zusammen:
Der Autor predigte die vollkommene Unmöglichkeit des Handelns, leugnete beinahe jede Art von Erkenntnis, das „Ich“ war Zuschauer vor einer Bühne, auf der es selbst keine Rolle spielte.
Otto de Kat (*1946) studierte Theologie und Literatur an der Universität Leiden. Seit 1986 ist er Verleger in Amsterdam. 2006 erscheint bei Suhrkamp sein neuer Roman „Sehnsucht nach Kapstadt“ („De inscheper“, Übersetzung: Andreas Ecke).
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Kommentar: © Dieter Wunderlich 2003
Textauszüge: © Suhrkamp Verlag