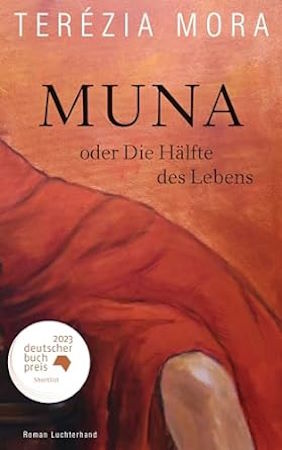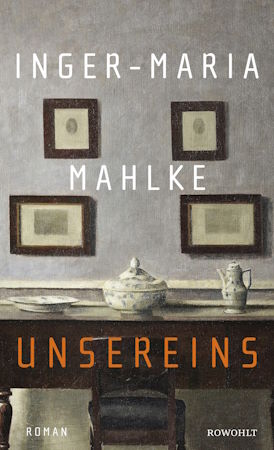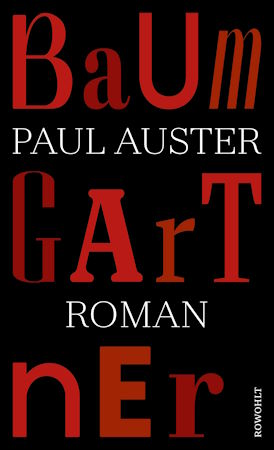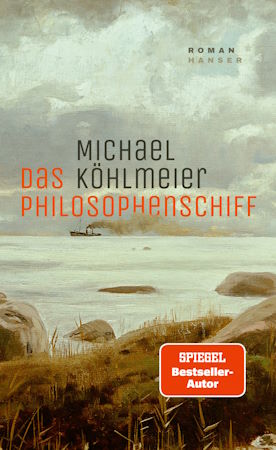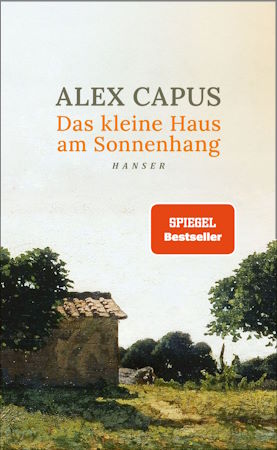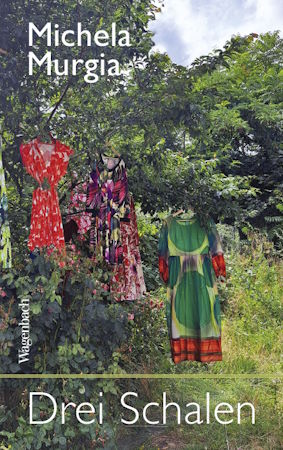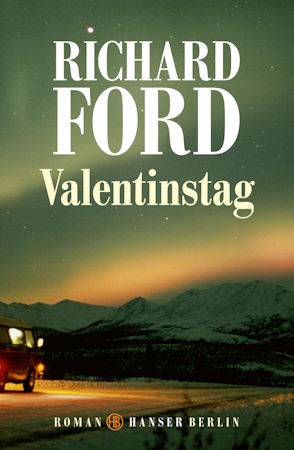Martin Walser : Finks Krieg
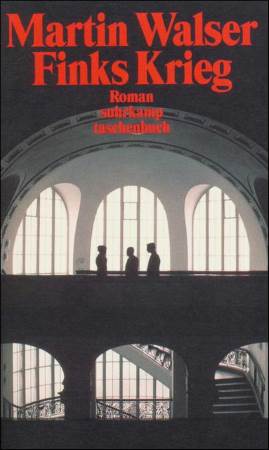
Inhaltsangabe
Kritik
Der Hessische Ministerpräsident Albert Osswald (1969 – 1976) beauftragte 1971 den katholischen Juristen Stefan Fink mit dem Aufbau eines Verbindungsbüros der Staatskanzlei in Wiesbaden zu den Kirchen und Religionsgemeinschaften. Im Frühjahr 1987 löste der CDU-Politiker Walter Wallmann (1987 – 1991) den zurückgetretenen Ministerpräsidenten aus der SPD ab.
Eineinhalb Jahre nach der Regierungsübernahme, am 23. November 1988, teilt Staatssekretär Tronkenburg (CDU) dem Beamten Stefan Fink (SPD) mit, dass am 1. Januar 1989 der CDU-Landtagsabgeordnete Moosbrugger das zur Abteilung aufgewertete Verbindungsbüro übernehmen und er in die Rechtsabteilung versetzt werde.
Um seinem Unmut Luft zu verschaffen, ruft Fink den mit ihm befreundeten Ministerialrat Franz Karl Moor im Kultusministerium an. Der rät ihm, sich um die Stelle des Abteilungsleiters Kirchen und Religionsgemeinschaften zu bewerben. Falls die Position dann an jemand außerhalb der Staatskanzlei vergeben werde, solle er beim Verwaltungsgericht eine Konkurrentenklage einreichen und eine einstweilige Anordnung beantragen.
Tatsächlich verlangt das Verwaltungsgericht einen fairen Wettbewerb zwischen den beiden Bewerbern um den Abteilungsleiterposten. Daraufhin ändert Staatssekretär Tronkenburg seine Vorgehensweise: Um Moosbrugger durch eine Organisationsplanänderung zum Nachfolger Finks machen zu können, verzichtet er vorerst darauf, das Referat zur Abteilung hochzustufen.
Um einer Pressekampagne gegen Moosbrugger den Wind aus den Segeln zu nehmen, wird dieser schließlich nicht in die Staatskanzlei berufen, sondern als Vertreter Hessens nach Thüringen entsandt, und ein anderer Beamter übernimmt in Wiesbaden das Verbindungsbüro zu den Kirchen und Religionsgemeinschaften. Fink behält nur noch die Referate Protokoll, Orden und Lebenslängliche, die bis dahin fünf Prozent seiner Arbeitszeit beansprucht hatten.
Gegen die Organisationsplanänderung strengt Fink ein weiteres Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht an. Wieder gibt man ihm dort Recht, aber die Staatskanzlei legt dagegen Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof in Kassel ein. Als Tronkenburg dem Gericht an Eides statt versichert, Fink sei versetzt worden, weil sich die Kirchen und Religionsgemeinschaften wiederholt über ihn beschwerten und seine Entwürfe für Grußworte und Reden des Ministerpräsidenten häufig umgearbeitet werden mussten, obsiegt er.
Diesen Makel will der rechtschaffene Beamte Fink nicht auf sich sitzen lassen. Er beantragt deshalb über seinen Anwalt, die Staatskanzlei müsse alle in den beiden Eilverfahren gegen ihn vorgetragenen ehrenrührigen Behauptungen widerrufen. Das Verwaltungsgericht entscheidet jedoch ohne mündliche Verhandlung zugunsten des Staatssekretärs.
Nach dieser zweiten juristischen Niederlage eröffnet Fink eine weitere Front und lanciert Presseberichte, in denen die eidesstattliche Erklärung Tronkenburgs in Zweifel gezogen wird. Nun greift auch die oppositionelle SPD das Thema auf und will in einer Hauptausschusssitzung im Landtag geklärt haben, ob der Staatssekretär gelogen hat oder nicht. Fink wendet sich an Prälat Prof. Dr. Degen und ersucht ihn, zu bestätigen, dass er sich nie über ihn beschwert habe. Degen unterrichtet Staatssekretär Tronkenburg über das Ansinnen, und der geht in der Hauptausschusssitzung nicht auf die Frage ein, ob der Prälat sich über Fink beschwert habe oder nicht, sondern wirft dem Beamten versuchte Zeugenbeeinflussung vor. Damit gelingt es ihm, die gegen ihn selbst erhobenen Vorwürfe vom Tisch zu wischen.
Ein fünfundachtzigjähriger Bekannter warnt Stefan Fink:
Man wird ein anderer Mensch durch eine solche Streitsache. Es gebe dann nur noch diese eine Sache, die Streitsache. Anders könne das gar nicht laufen, als dass diese Streitsache das Leben ganz und gar beherrschte, verzerre, zerstöre. (Seite 24)
Tatsächlich interessiert Fink nur noch der Rechtsstreit. Er beginnt seinen Fall in Aktenordnern mit der Aufschrift „DGG“ (David gegen Goliath) zu dokumentieren. Im Januar 1991 legt er sich sogar einen Computer zu und lässt sich von seinem Sohn Sebastian erklären, wie man damit Schriftsätze verfasst, speichert und ausdruckt.
Seit November 1988 musste jeder, der mir irgendetwas sagte, das auch nur entfernt nach Brauchbarkeit duftete, damit rechnen, dass ich das Gesagte aufschrieb und mir unterschreiben ließ. Formalisieren nennt man das. (Seite 54)
Aus den Landtagswahlen im Januar 1991 geht die SPD siegreich hervor und stellt mit Hans Eichel den neuen Ministerpräsidenten. Der neue Staatssekretär erklärt Fink, die Angelegenheit müsse jetzt ein Ende haben und man dürfe die Kirchen nicht länger in eine heikle Lage bringen. Fink soll wieder das Verbindungsbüro zu den Kirchen und Religionsgemeinschaften übernehmen – aber vorher einer Vereinbarung zustimmen, derzufolge beide Parteien zusichern, Inhalte und Einzelheiten der vorangegangenen Verwaltungsstreitverfahren oder damit Zusammenhängendes nicht mit Dritten zu erörtern oder solche Erörtungen zu fördern. Am 28. März 1992 steht in der Zeitung, der Leitende Ministerialrat Stefan Fink sei voll rehabilitiert.
Am 1. April 1992 erhält Fink sein altes Amt zurück, aber er kann sich nicht darüber freuen, denn zwei Tage zuvor gab der Oberstaatsanwalt in einer Presseerklärung die Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen Tronkenburg wegen des Verdachts einer falschen eidesstattlichen Erklärung bekannt. Es kommt noch schlimmer: In einer Pressekonferenz am 10. Juni begründet die Staatsanwaltschaft die Einstellungsverfügung und vertritt dabei die Auffassung, Tronkenburg habe auch dann die Wahrheit gesagt, wenn es sich nicht um formale Beschwerden gegen Fink gehandelt habe, sondern nur um beiläufige Beschwerden im umgangssprachlichen Sinn.
Erbost lässt Fink durch seinen Anwalt Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung einlegen und sammelt weiter Material.
Der inzwischen Sechzigjährige, der in Bleidenstadt ein Haus bewohnt, hat mit seiner Ehefrau Thea drei Kinder: Andreas, Sebastian und Barbara. Als Andreas heiratet, erlebt Fink wieder eines der für ihn quälenden Familienfeste.
Freunde der Familie und Verwandte, die wieder alle in der Zeitung etwas über meinen Prozess gelesen hatten. Jeder etwas. Keiner alles. Und jeder etwas anderes. Aber in einer Hinsicht waren sie sich trotz ihres unterschiedlichen Informationsstandes einig: Der Stefan muss das jetzt lassen. Das führt doch zu nichts. (Seite 77f)
Ungeduldig wartet er auf die Nachricht, wie die Staatsanwaltschaft auf seine Beschwerde reagiert. Kurz vor Ostern 1993, als sein Anwalt gerade in Ferien gefahren ist, trifft die Zurückweisung der Staatsanwaltschaft ein.
Dann träumte ich, ich müsse auf einem engen, korridorartigen Fußballfeld barfuß spielen, als Ball diente ein Igel. (Seite 132)
Fink denkt darüber nach, ob er sich vor einen Zug werfen soll. Bekannte schütteln den Kopf über ihn und meinen, er betreibe Selbstzerstörung. Morgens ab 6 Uhr, samstags und sonntags kopiert Fink in der Staatskanzlei seine Schriftsätze, um sie an Anwälte, Politiker, Kirchenleute und Journalisten zu verschicken. Aus Angst, es könne in der Staatskanzlei Feuer ausbrechen, macht er auch noch einmal Kopien von seinen vollen Leitzordnern – inzwischen sind es vierundachtzig – und deponiert sie im Haus eines Bekannten in der Wetterau.
Als Fink sich einen Neuwagen ansieht, meint der Händler, er fahre wohl nicht mehr viel, denn er sei doch wohl bereits Rentner. Das trifft ihn. Der Streit hat ihn alt und kränklich werden lassen. Aber er macht wie unter Zwang weiter.
Jemand, der um sein Leben kämpft, [kann] nicht aufhören […], um sein Leben zu kämpfen. (Seite 192)
Ich hatte doch keine Wahl. Eine Wahl zu haben, das, stellte ich mir vor, musste der Inbegriff von Luxus sein. (Seite 94)
Schließlich wittern ein CDU- und ein FDP-Abgeordneter – Fink nennt sie „Wenck“ und „Zieten“ – die Chance, aus seinem Fall Kapital gegen die rotgrüne Landesregierung zu schlagen. „Wenck“ will die Angelegenheit vor den Petitionsausschuss bringen, fühlt sich aber verpflichtet, vorher eine Verständigung mit dem amtierenden Staatssekretär zu versuchen. Ende 1993 berichtet Wenck, der Staatssekretär sei über die Drohung mit dem Petitionsausschuss erschrocken und wolle die Sache nach Weihnachten aus der Welt schaffen. Im Januar trifft die versprochene schriftliche Erklärung des Staatssekretärs ein: Auf acht Seiten zerpflückt er jeden Punkt der sechzehnseitige Petition („unrichtig ist ferner Ihre Behauptung“). Das versteht er also unter dem Versuch, die Angelegenheit aus der Welt zu schaffen!
Aber der Beamte Fink kniete noch einmal nieder auf seine Papiere und beantwortete Punkt für Punkt, widerlegte alles. Dann rief er Wenck an. Vielleicht wollte der ja gar nicht mehr. Der Beamte Fink übte das Telefongespräch, bevor er wählte. Lachen, lustig, fröhlich, zynisch, hart: Der Herr Staatssekretär als Unterhaltungskünstler, ha, ha, ha. Nehmen wir’s ihm nicht übel, er vermag ja nichts gegen seinen Justitiar, und wer den aus dem provinziellen Nichts in eine Staatskanzlei gehievt hat, wissen wir doch. (Seite 226)
Nach dem Scheitern des Einigungsversuchs soll Finks Eingabe auf die Tagesordnung für die Sitzung des Petitionsausschusses am 8. Februar 1994 gesetzt werden. Tags zuvor erfährt er, dass man seinen Fall in der vorbereitenden Sitzung auf den 15. März verschoben hat.
Am 14. März nimmt er in der Staatskanzlei jeweils vier Aktenordner und trägt sie zu seinem Auto. Er muss zweiundzwanzigmal gehen, bis alle im Kofferraum liegen. Dann schreibt er seiner Frau einen Brief, verabschiedet sich von seiner Sekretärin und bittet sie, im Personalbüro Bescheid zu sagen, dass er vorzeitig in den Ruhestand gehen werde.
In einem Benediktinerinnenkloster im Melchtal in der Schweiz findet er Zuflucht und erhält Wäsche und Anzüge eines verstorbenen Priesters zum Anziehen. Die Aktenordner lässt er im Kofferraum.
Seine Frau besucht ihn und bringt ihm die Nachricht, der Petitionsausschuss habe ihm Recht gegeben. Die gegnerische Seite habe zwar seine mimosenhafte Empfindlichkeit und seinen Starrsinn ins Feld geführt, aber er sei wieder uneingeschränkt rehabilitiert. Sie bringt ihm auch einen entsprechenden Artikel im „Wiesbadener Kurier“. Aber er bleibt misstrauisch, denn er hat schon einmal erlebt, dass die schriftliche Erklärung des Staatssekretärs das Gegenteil dessen enthielt, was er angekündigt hatte. Thea fährt nach drei Tagen wieder ab. Fink will noch bleiben und mit sich ins Reine kommen.
Einige Zeit später schickt Thea ihm die Kopie eines Schreibens des Staatssekretärs an den Petitionsausschuss, in dem er verlangt, das Beschlussprotokoll zu berichtigen, denn es sei falsch, dass die Landesregierung von ihrer Behauptung abgerückt sei, Vertreter der Kirchen und Religionsgemeinschaften hätten sich gegen Fink beschwert. Wie im Wortprotokoll nachzulesen sei, habe er das genaue Gegenteil gesagt und dabei bleibe er.
Nie, nie würden die nachgeben. Die musste man niederkämpfen, ihnen Satz für Satz aus dem Behauptungsmaul reißen, wie man in einer vom Feind besetzten Stadt Haus für Haus zurückerobern muss. Auch wenn dabei die Häuser, die man zurückerobert, vernichtet werden. (Seite 275)
Nach einem sechsjährigen Krieg beschließt Stefan Fink, die im Kofferraum liegenden Aktenordner demnächst zu vernichten. Der Beamte Fink sei ein „Rechtshypochonder“ gewesen, meint er.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Lobe deine Feinde! Überlege doch: Wo wärst du ohne deine Feinde? Auf den Mäusepfaden aller Ministerialräte als eine weitere graue Maus. Lobe deine Feinde, denn sie haben dich befreit aus der verhängnisvollen Verbindlichkeit, der du dein Leben verschrieben hattest. Lobe deine Feinde, Mann! So behandelt zu werden mit allgemeiner Billigung heißt keine Verpflichtung mehr zu haben. Freier als du jetzt bist, kann man nicht sein. Lobe deine Feinde, Mann. (Seite 274)
Ich werde die Geschichte des Beamten Fink schreiben als ein Lob der Mächtigen. Alles, was dem Beamten Fink angetan worden ist, ist lobenswert. (Seite 304)
Ministerialrat Stefan Fink fühlt sich von seinem Dienstherrn nicht nur ungerecht behandelt, sondern obendrein durch dessen nachträgliche Beschuldigungen in seiner Beamtenehre verletzt. Sein Kampf um Rehabilitierung nimmt bald kafkaeske Züge an und erinnert an Michael Kohlhaas; bald kann Fink an nichts anderes mehr denken. Das juristisch-bürokratische wird von einem kriegerischen Vokabular abgelöst.
Mit siebzehn Initiativen eröffnete ich die Herbst-Winterschlacht. (Seite 192)
Dabei kommt es allmählich zur Selbstentzweiung: Der Mensch Stefan Fink rückt vom Beamten Fink ab, wird aber von ihm dominiert. Der Ich-Erzähler Stefan Fink beginnt, in seinen inneren Monologen über den Beamten Fink (dritte Person Singular) zu reflektieren.
Am Morgen nach dieser Nacht konnte ich den Beamten Fink nicht rasieren. (Seite 133)
Dieser grauenhafte Beamte Fink. Wie ich ihn hasste. Aber er war das einzige, was ich war und hatte. Von ihm mich trennen – das hätte geheißen, mich umzubringen. (Seite 88)
Nach sechs Jahren hält Fink den Krieg nicht länger aus und zieht sich in ein Kloster in den Schweizer Bergen zurück („Höhengewinn“), um mit sich ins Reine zu kommen.
„Finks Krieg“ ist ein Lehrstück über die Ohnmacht eines Einzelnen gegenüber anderen Individuen, die Zugang zu den Schalthebeln der Macht haben.
Dem Roman von Martin Walser liegt der authentische Fall des hessischen Ministerialrats Rudolf Wirtz zugrunde, den Staatssekretär Alexander Gauland (CDU) 1988 aus der Leitung des Verbindungsbüros der Staatskanzlei zu den Kirchen und Religionsgemeinschaften entfernte, um Platz für einen Parteifreund zu machen. Als Wirtz sich dagegen wehrte, schob Gauland die Begründung nach, man sei mit seiner Arbeit nicht zufrieden gewesen. Weil der Beamte diesen Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen wollte, begann er einen Krieg gegen den Staatssekretär, den er auch nach dem Regierungswechsel im Jahr 1991 gegen dessen Nachfolger weiterführte.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2004
Textauszüge: © Suhrkamp Verlag
Martin Walser: Die letzte Matinee
Martin Walser: Ehen in Philippsburg
Martin Walser: Ein fliehendes Pferd
Martin Walser: Ein Angriff auf Perduz
Martin Walser: Selbstporträt als Kriminalroman
Martin Walser: Dorle und Wolf
Martin Walser: Ohne einander (Verfilmung)
Martin Walser: Der Lebenslauf der Liebe
Martin Walser: Tod eines Kritikers
Martin Walser: Das dreizehnte Kapitel
Martin Walser: Ein sterbender Mann
Martin Walser: Statt etwas oder Der letzte Rank