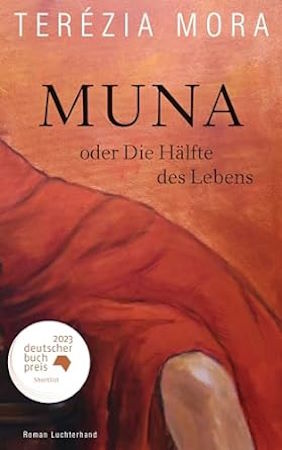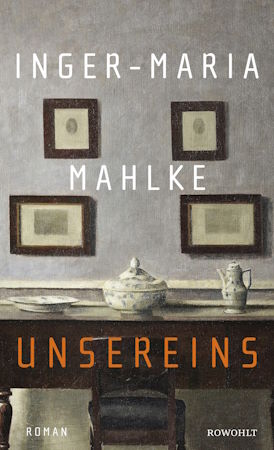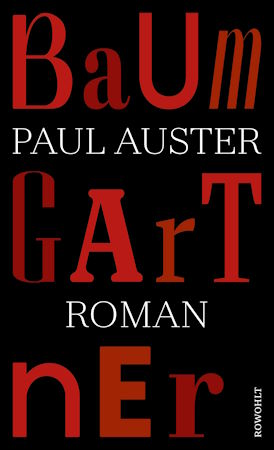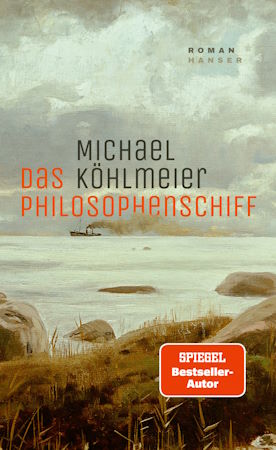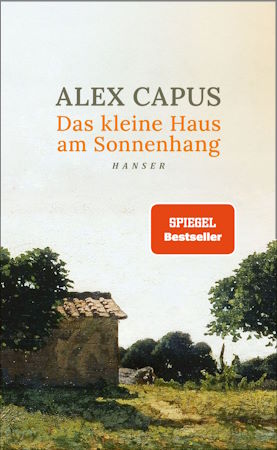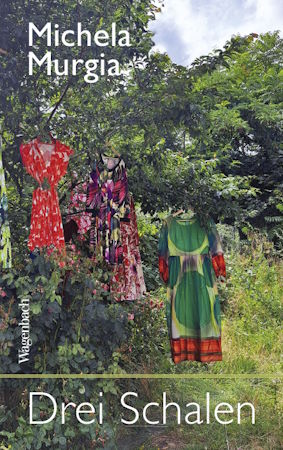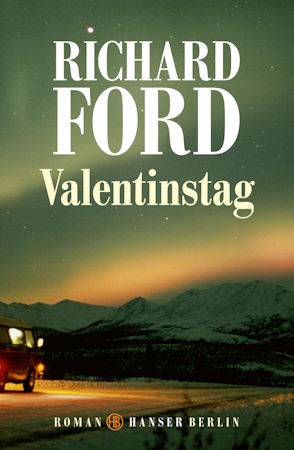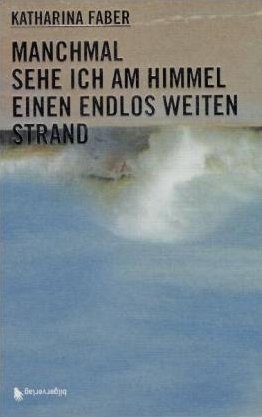Frank Schulz : Morbus fonticuli oder Die Sehnsucht des Laien

Inhaltsangabe
Kritik
Bodo („Mufti“) Morton wurde am 11. Februar 1957 in einem Dorf bei Stade geboren. Im neunzehnten Semester brach er sein geisteswissenschaftliches Studium ab. 1983 lernte er Anita („Nita“) Heidemarie Adamczik kennen, und die beiden wurden ein Paar.
Im Frühjahr 1987 beginnt Mufti als Redakteur und Lokalreporter beim „Elbe Echo“, einem jeden Donnerstag kostenlos an die Haushalte verteilten Anzeigenblatt, das von Irmgard („Irmi“) Schröder herausgegeben wird, einer Vierzigjährigen, die Mufti für eine „betriebsblinde, geldgeile workaholic“ (Seite 157) hält. Der Chefredakteur heißt Eugen von Groblock. Meinungsumfragen pflegt Mufti mit Bekannten zu türken, und im Redaktionsbüro holen er und seine Kollegen sich aus Langeweile Computerspiele auf den Bildschirm; da heißt es rasch die Escape-Taste drücken, wenn die Tür aufgeht. Ansonsten versucht Mufti – ein „beinharter Bock- und Wienerwurst-Gourmand“ (Seite 176) – sich mit Kettenrauchen, Schnaps und Bier bei Laune zu halten. Immer wieder kämpft er mit den Tücken des Alltags.
Ferner Schnürbandproblem. Liegt in der Kindheit begründet. Vor über 30 Jahren haben wir das Schleifenbinden falsch gelernt, und so müssen wir uns seit über 30 Jahren damit herumplagen, dass die Schleife nicht einfach an einem Senkel aufgezogen werden kann, ohne dass ein Gordischer Knoten entsteht. Geschlagene fünf Minuten dran rumgefummelt! Rechnen wir nur mal drei pro Tag, dann sind das in 30 Jahren über 500 Stunden! Mehr als drei Wochen unseres Lebens bisher damit vertändelt, die Schnürbänder zu entwirren!
Und dabei soll man nicht depressiv werden. (Seite 588)
Hin und wieder ist Mufti auch spaßig.
Als ich Anfang November die HaBa betrat und den mit meinem flotten Autogramm versehenen Auszahlungsschein unter dem Panzerglas hindurchschob, thronte dahinter ein teures Frl. Behrend – Gott! das nackte „Nüüülon“ (Heino Jaeger)!
„In großen, nicht nummerierten Scheinen, bitte“, flüsterte ich ihren frechen Schenkeln zu. Was aber erwiderte dieser Ausbund von Milchmädchen? „Die sind alle numeriert.“
„Na gut“, sprach ich, „dann geben Sie mir davon. Zehn Stück, bitte.“
Frl. Behrend schaute auf den Kassazettel. „Vier!“
„Sieben, mein letztes Wort“, sprach ich. Die knallharte Bankkauffrau aber schob mir vier Hunderter zu. Zicke, die. (Seite 326)
Während Anita mit ihrer Freundin Conny 1987 einige Monate durch die USA reist, erhält Mufti den Auftrag, die Präsentationsveranstaltung des neuen Konkurrenzprodukts „Süderelbe plus“ am 21. Oktober in der „Hexenkate“ zu besuchen und darüber einen Artikel zu schreiben. Weil der Dreißigjährige sich in der Uhrzeit täuscht, trifft er eine Stunde zu früh ein – und lernt auf diese Weise die achtzehnjährige Bärbel („Bülbül“) Befeld kennen. Maße: 102-60-105.
Die Tür stand offen. Das Lokal war leer.
Das heißt, am Ende des Tresens, da hockte dieses junge Weib, in diesem verwünschten Blümchenkleid, hockte da mit ihrem gottgegebenen Boulevardarsch auf einem Barhocker an der Stirnseite des Tresens, die gewaltigen Chaka-Khan-Schenkel übereinandergeschlagen […] Ihr weißes Kleid mit den rosa Rosen darauf, bis zur Hälfte des Oberschenkels gerutscht, leuchtete in der 40-Watt-Dämmerung. Die Brüste, obwohl schwebend wie Zeppelinbuge, wogen damals schon drei Pfund – jede. Sie taten ihr manchmal weh, wenn sie lange hatte stehen oder viel laufen müssen […] (Seite 183)Sie war eine Holly Golightly aus der Provinz. Sie war eine der wenigen Frauen ohne Handtasche, die ich kannte. (Seite 296)
Bärbel ist zwar ein bisschen dumm, dafür ungeniert und unersättlich geil. Mufti verfällt der Frau, die ihm in der ersten Nacht ihr „Becken brutal über die Nase stülpt“ (Seite 211) und dabei „komm, leck mich; leck mich, geiler Bock“ (Seite 211) keucht und ihn von da an nun nur noch „Böckchen“ oder „Boboböckchen“ ruft. So etwas erlebt er in seiner „dreißigjährigen Laufbahn als Testosteronproduzent“ (Seite 211) zum ersten Mal, und er stöhnt:
Bärbeln. Bis ans Ende meiner Tage. Bärbeln, von vorn, von hinten, seitwärts, oben hinein, unten hinein. Immer hinein. In die Achselhöhlen. Zwischen die beiden Brüste, die in ihrer Seele wohnen. Zwischen die gebenedeiten Schenkel, die festen Füße, die kühlen Fäuste. Bärbeln, bärbeln, BÄRBELN. BÄRBELN. Bärbeln und bärbeln lassen. Bärbeln und gebärbelt werden.
Und sonst gar nichts. (Seite 178)
Einmal fahren sie nachts auf die wegen Bauarbeiten gesperrte Köhlbrandbrücke und kommen dort zu einem „54-Meter-Höhepunkt“ (Seite 661).
[…] hinterrücks aufgespießt klemmte Bärbel quer zwischen der Notreling und dem Brückengeländer und starrte schreiend in die klaffende Tiefe […] (Seite 335)
Vergeblich versucht Mufti, ihr den korrekten Gebrauch der Begriffe „leihen“ und „borgen“ beizubringen.
[Bärbel:] „Du hast dir doch gestern Nacht dreißig Mark von mir geliehen –“
„Geborgt“, sagte ich untot. (Seite 267)„Ich kann dir was – borgen“, sagte mein süßes Kind.
„Leihen“, sagte ich. (Seite 268)
Ihren Vater Franz kennt Bärbel nicht. Ihre Mutter Marion sah ihn auch nur einige Stunden lang: Bei einer Straßenschlacht zwischen Polizei und Demonstranten im Jahr 1968 schlug er einen Polizisten nieder, der sie an den Haaren hinter sich hergezogen hatte, flüchtete mit ihr in eine Kommune und zeugte dort mit ihr Bärbel. Marion putzte bei einem Soziologieprofessor, kellnerte, brachte Bärbel zur Welt, gründete einen Kinderladen, kellnerte wieder und studierte, bevor sie im Sommer 1970 den Politologie-Studenten Jobst Befeld heiratete, einen Irrwisch, „der halbtags qua Spaßguerilla die Berliner Expropriateure expropriierte“ (Seite 555). Nach ein paar Monaten wurden ihm die Wochenenden mit der überarbeiteten Mutter zu anstrengend, und er setzte sich ab, angeblich zum Opalschürfen nach Australien.
Nachdem Mufti Marion Befeld kennen gelernt hat, meint er:
Marion Befeld, ’ne frustrierte Schmuddelsuffragette, von den klimakterischen Vorboten derart, ja?, gebeutelt, ja?, dass sie die Vertreter des mescalsaufenden Machismo vaginal inkorporiert, so oft’s irgend geht. Ja? (Seite 155)
Ihre Schwester Irene und deren Ehemann Karl Knaack führen übrigens die Kneipe „Zum Runden Eck“.
Wegen seiner Faulheit wird Mufti von Irmgard Schröder entlassen, aber dann überlegt sie es sich doch noch einmal und zieht die Kündigung zurück. Später denkt Mufti, dass er dadurch eine Chance verpasste.
Wie ist das bloß alles möglich. Weshalb hat man nicht einfach die Kündigung akzeptiert. Weshalb hat man sie nicht einfach als willkommenen Anlass genommen, der Süderelbe den schmerzenden Rücken zu kehren, sich irgendeinen verantwortungsarmen Bürojob zur Finanzierung des Studiums gesucht, endlich das Examen gemacht, Anita geheiratet, und dann hätte man weitersehen können. Man hätte promovieren können. Praxis Dr. Morton. Man hätte Tierpfleger werden können. Oder Tischler wie sein Vater. Und Vater hätte man werden können. Irgendwas hätte man werden können. Mit dreißig wär’s noch nicht gar zu spät gewesen. (Seite 317)
Anfang Februar 1988, drei Tage vor Muftis 31. Geburtstag, kehren Anita und Conny aus den USA zurück.
Nach einer durchzechten Nacht mit seinen Freunden in der „Glucke“ wird Mufti auf dem Heimweg angefahren, …
[…] von einem Sonntagsfahrer, einem dieser halbtoten Hutträger, die ihren Mittelklassewagen einmal pro Woche aus der Garage holen, damit die Bremse nicht einrostet. (Seite 390)
Mufti erholt sich von dem Schädel-Hirn-Trauma und könnte nun „Bäume jäten“ (Seite 392).
Da war’s, das neue Leben. Ich war ein Muster an fitness und wellness. Ich schlief wie ein Baby, federte noch vorm Weckerfiepen aus dem Bett, und kaum aufgestanden, trabte ich schon im Trainingsanzug den Isekai entlang – ah, wie willfährig der Tee über die Geschmacksknospen rieselte, wie hingebungsvoll sich Müsli von wurzelstarken Zähnen zermalmen ließ und wie gefügig Obst und Gemüse – und wie geschmeidig kerngesunder Stuhl durch die blühende Darmflora glitt, ja abging wie ’ne Rohrpost! Was für einen fantastischen Organismus durfte man sein eigen nennen! Die Äuglein glänzten! Schuppenlos rein die Haut, Haare splissfrei, ’ne Wucht Herz und Nieren! Und das bei einem weiland strammen Spitzen-Alkoholathleten wie unsereins!
Mit andern Worten, ich drohte zu sterben vor Langeweile. Bei lebendigstem Leibe.
(Seite 391)
In der Nacht auf den 10. Dezember 1988 ertappen Mufti und seine Chefin Irmgard Schröder deren Ehemann Sven mit der Volontärin Simone („Zitrone“) Zimmermann in flagranti auf Bertram Heinsohns Leuchttisch. Zum Trost treibt die Herausgeberin es von da an hin und wieder mit Mufti.
Fredi Born, der Inhaber eines Blumengeschäfts, ein väterlicher Freund Bärbels, der ihr zum 19. Geburtstag am 16. Dezember 1987 tausend Mark geschenkt hatte, damit sie im Frühjahr ihren Führerschein machen konnte, deckt eines Morgens den Korridor mit einer Plastikplane ab und wartet auf seine Frau. Als Margarethe Born von einem Besuch bei ihrer Mutter zurückkommt, erschießt er sie mit einem alten Revolver und tötet sich dann selbst.
Bärbel hat er als Alleinerbin eingesetzt. Sie mietet sich für 3500 D-Mark pro Monat ein Vier-Zimmer-Penthouse und führt das Blumengeschäft weiter.
Am 4. April 1989 wird Mufti zum stellvertretenden Chefredakteur des Anzeigenblatts befördert, doch bald darauf beendet er seine Tätigkeit beim „Elbe Echo“, denn zu seinem 33. Geburtstag schenkt Anita ihm einen Heiratsantrag. Sie gibt ihren Job auf, um mit ihm für drei Monate nach Griechenland zu reisen. Am 15. Juli 1990 heiraten sie in Rethimnon. Nach der Rückkehr zieht Mufti im September bei ihr ein. Am 1. Oktober beginnt er eine ABM-Stelle bei der Hamburger Gesundheitsbehörde, und Anita fängt eine Ausbildung zur Buchhändlerin und Bibliothekarin an, die sie aber nach einem halben Jahr wieder beendet, um eine Boutiquen-Filiale ihrer Freundin Heidrun („Chique-Tique“) auf Vordermann zu bringen. Mufti kriecht schließlich bei Irmgard Schröder zu Kreuz, unterschreibt am 9. Oktober 1991 einen neuen Vertrag und steigt am 1. November wieder als einfacher Redakteur und Lokalreporter beim „Elbe Echo“ ein. Irmgard Schröder nörgelt zwar immer wieder über Muftis Beiträge („Das versteht doch kein Mensch – geschweige unsere Leser!“ (Seite 683)), aber am 1. April 1992 steigt er zum Redaktionsleiter auf, und zur Feier seiner Beförderung schläft er mit seiner Kollegin Hanna Sybille („Hasy“) Braune, die eigentlich mit Brokstedt liiert ist.
Den ganzen Winter über hockte ich in jeder langweiligen Minute in Bärbels Luxuswohnung, trank nachmittags Brandy zum Tee und abends Bier zum Brandy und ließ mich aushalten und blätterte in ihren modernen Frauenzeitschriften. Alles war Erotik, aber das war auch alles. Alles wurde immer bunter, immer geiler und peinlicher, und Bärbel wurde immer dicker – wie ich […] (Seite 678)
Innerhalb kurzer Zeit ruiniert Bärbel das Blumengeschäft, aber ihren „spätvenezianischen Lebensstil“ (Seiten 296 / 678) behält sie bei.
Obwohl Anita weder etwas von Muftis Verhältnis mit Bärbel noch von seinen anderen Seitensprüngen ahnt, kriselt es in ihrer Ehe.
Das hat man davon, wenn man als Dorftrottel ’ne kluge Frau heiratet. Man muss sich „Kleinkariertheit“ vorwerfen lassen, „rentnerhafte Nörgelsucht“, „Jähzorn“, „Egomanie“, „Katatonie“, „Melancholie“ etc. Ausgepumpt von der Zankerei hat man Sonntagnacht im Sofa gesessen und sich zuüblerletzt auch noch Folgendes anhören müssen: „Was ist aus dir geworden. Abends ’ne Fresse, morgens ’ne Fresse. Deine Fresse morgens, die müsstest du mal sehen. Früher bist zu aufgewacht und hast gelacht.“ (Seite 362)
Entnervt mietet Mufti sich im Juli 1993 heimlich eine „Schreibklause“, in der er sich auch mit Bärbel trifft, ohne dass Anita davon erfährt.
[…] ich mein klandestines Parallelleben mit Bärbel und ihrem Klan weiterführte, während ich noch hin und wieder mit [Bärbels Mutter] Marion schlief, ohne Wissen Bärbels, und mit Hasy, ohne Wissen Marions und Doc Brokstedts, und mit Bärbel, ohne Wissen Anitas (und ein einziges Mal noch, in einer schwachen, ja schwachsinnigen Stunde mit Irmi […]) (Seite 681)
Im Winter 1994/95 stöbert ihn dann auch noch seine frühere Geliebte Lala durch einen Detektiv auf und läutet mit ihren „Lotterglocken“ die „Schwarze Phase“ ein (Seite 375).
In der Showbar „Hammonia“ trifft er zufällig einen Bekannten namens Rudi, der dort Schampus ausgibt. Ungefragt verrät Rudi ihm, wie er zu Geld gekommen ist:
Pass auf, Mordtn, aldta Schmierfiengk. Follgndess. Ich bin dehmnehchßd freia Midd’ahbeidta bei eim gewissn ßohschl Ikßperrimendt eh Fau, und da wird ich mid Geld nuhr so zugeschissn. Unßwah bei eussaßd angenehma Tehdtichkeidt. (Seite 605)
Anfang der Neunzigerjahre, berichtet Rudi über die Entstehung seiner Geldquelle, saß der bettelarme Soziologiestudent Hansjürgen Störtzer auf einer Anlagenbank an der Alster. Da legte genau vor ihm eine Ruderin an, kettete sich mit Handschellen neben ihn und forderte ihn auf, ihr das Höschen auszuziehen. Zögernd ging Störtzer darauf ein. Dann stellte sich heraus, dass alles nur eine Show war, um ein paar Perverse aufzugeilen, die aus ihrem Versteck hinter einem Rhododendron und mit einem Feldstecher von einer Villa aus zusahen. Als Schweigegeld drückten ihm die Männer tausend Mark in die Hand. Das brachte Störtzer auf die Idee, sein letztes Geld für Anzeigen in Manager-Magazinen auszugeben:
„Alles erreicht: Aber auch alles erlebt? Dann Social EXperiment e. V.“ (Seite 618)
Als Mufti das hört, entwickelt er spontan ein paar Ideen, zum Beispiel eine Pseudovergewaltigung von VIPs durch authentische Strafgefangene, aber Rudi nennt ihn vorwurfsvoll einen „Zühniggka“ (Seite 619).
Muftis „realexistierender Hedonismus“ (Seite 137), Nikotin, Alkohol und Sex setzen ihm schwer zu. Akribisch hält er jeden Tag fest, wieviel und welche Marken er geraucht, wieviel Bier und Schnaps er getrunken und wieoft er Sex gehabt hat. Überhaupt führt er seit seiner Jugend ein Tagebuch.
Sribo, ergo, summa summarum, sum […] (Seite 544)
In seinem „Herbstjournal 1994“ schreibt er:
Dennoch schwierigste Einschlafprobleme gehabt: Vollmond. Tidenhub im schwammigen Körper gespürt. Ordentlich was weggegrübelt. Morgens kaum noch nachvollziehbar, was nächtliche Hirngespenster so alles anstellen können[…]
Mittags wie nach ’ner Schlägerei aufgestanden. Wasser ins Gesicht. Zähneputzen vorerst zu anstrengend. Zigarettchen. Unter Aufbietung sämtlicher mentaler Ressourcen Satsches Nummer gewählt. Gespräch ungefähr so:
Bartels.
Hmb.
Sach ma – du Arschloch. Drecksack. Oder Wichser. Wieso rufst du eigentlich nie mehr an! Oder zurück! Wa?
D’s ’s so anstrengend …
[…] (Seite 138f)
Erschrocken stellt er plötzlich fest, dass er verkehrt herum atmet: Statt einzuatmen, atmet er aus und umgekehrt (Seite 534). Er gerät in Panik.
Es brauste in meinen Eustachischen Röhren, kalter Schweiß stand mir auf der Oberlippe, und meine Nerven machten Radau. (Seite 232)
Heut morgen Haut-Dr. Hornung (!). Pilz an den Beutelflanken kein Pilz, sondern Infektion (4 Wochen lang Salbe). Fußpilz allerdings tatsächlich Fußpilz (vorm Schlafengehn mit rotem Farbstoff einpinseln – „Vorsicht! Färbt gefährlich ab!“ –, Textilstreifen zwischen die Zehen legen, Socken anziehn, 10 Tage lang), Felljucken am Hinterkopf und die Flecken im Gesicht: „Schlechtwetterekzem“ (wegen fehlender Sonne)! So was schon gehört? (Krem, 3x am Tag.) Den Hautzapfen am Adamsapfel hat er einem nach Spraynarkose mit ’ner Art Rasiermesser abgeschabt, bisschen Aua, Pflaster, fertig. Wahrscheinlich ’ne Art Warze. Wird noch untersucht. (Seite 558)
Schmerzen beim Urinieren kulminieren. Alle halbe Stunde Urindrang, und dann presst man drei bis vier Tropfen hervor, als wären’s erhitzte Bocciakugeln! (Seite 569)
Von Rechts wegen gehörte ich an den Tropf. Die Knie wackelten, die Nerven wieherten; ich litt unter Dreh- und Schwankschwindel, lautem Schädelsausen, teilweisen Absenzen, zeitweiser Blindheit; Übelkeit, Appetitlosigkeit, Hunger, Durst, Teerkatarrh, Heiserkeit, Atemnot, Panikattacken, Herzklopfen, und mein Auto war weg bzw. nicht da! (Seite 266)
Um sein Leben wieder in den Griff zu bekommen, fasst Mufti gute Vorsätze.
Man muss sich erstmal fangen, aber es wird schon. Wird schon alles gut. Ach, man wird ein ganz normales Leben führen, abends schlafen gehen, morgens aufstehn, wie jeder andere Blendamed-Verwender auch. (Seite 347)
[…] eigentlich hatte man sich ja vorgenommen, endlich mal am 1. Januar zu beginnen. Nun ist man am Neujahrstag aber ja verkatert gewesen – das heißt was heißt verkatert: man wartete so gut wie auf die Sterbesakramente –, sodass einem gleich wieder alles scheißegal war. (Seite 372)
Als er Sex nur noch als Belastung empfindet, wundert er sich der Achtunddreißigjährige in seinem Tagebuch:
Wo zum Teufel bleibt denn die vielzitierte Altersgeilheit … (Seite 686)
Mufti wird endgültig entlassen, weil er hin und wieder auch für andere Zeitungen schreibt, obwohl Irmgard Schröder darauf pocht, dass die festen Angestellten des „Elbe Echo“ ihre gesamte Arbeitskraft dem Anzeigenblatt zur Verfügung stellen. (Dummerweise vergaß er, ein Pseudonym zu verwenden.)
Bärbel verlangt von ihm schließlich, dass er sich von Anita scheiden lässt. Andernfalls werde sie ihr alles verraten.
Am 1. Juni 1995 sagt er zu Anita, er gehe Zigaretten holen. In einer Tankstelle versorgt er sich nicht nur mit Zigaretten, sondern auch mit Bier und Magenbitter. Dabei begegnet er der Taxifahrerin Maria, die ihn für 500 D-Mark zu dem Dorf fährt, wo er aufgewachsen ist. Am nächsten Tag heuert er eine Baukolonne an, die ihm ein Stück Wald einzäunt, das der Familie seines Jugendfreundes Kolk gehört, von dem er jedoch behauptet, er habe es gekauft. Außerdem lässt er sich die Höhle, in der er als Kind mit seinem Freund gespielt hatte, ausbauen und einen größeren Vorrat Bier, Wurst und Spirituosen hineinschaffen. Von seinem Konto hebt er 10 000 D-Mark ab, um die Arbeiter entlohnen und die Lieferungen bezahlen zu können.
Als Mufti nicht mehr zurückkommt, gibt Anita eine Vermisstenanzeige auf und sucht ihn bei allen Freunden und in allen Kneipen. Entsetzt hört sie auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht von einer ihr unbekannten Frau:
„Hier ist Bäärbül, bist du daaa? Ich hab mir ’n neuen Slip gekauft. Bist du daaa? Ich muss ma wieder ordnlich durchgefickhick!, fickt werden. Bist du daaa? Mp.“ (Seite 45)
Über eine Nichte ihrer Freundin Heidrun, die bei der HaBa arbeitet, erfährt Anita, dass auf dem Konto ihres arbeitslosen Ehemanns ein Guthaben von 368 320 DM liegt. Vorgestern wurden 10 000 DM abgehoben. Dann finden Anita und Conny auch noch Muftis geheime Schreibklause und dort seine Tagebücher von Herbst 1994 bis Frühjahr 1995.
Es stellt sich heraus, dass das seit September 1993 in vier größeren Beträgen eingetroffene Guthaben auf Muftis Konto aus Autorenhonoraren besteht. Ohne ihr etwas davon zu sagen, hatte er mit erotischen Erzählungen, die er in einem Band der inzwischen liquidierten „Edition Erotikon“ veröffentlichte, eine Menge Geld verdient.
In drei schwarzen Autos machen sich Anita, Conny, Heidrun, Satsche und die übrigen Freunde Muftis am 10. Juni auf die Suche nach ihm. Bärbel und zwei Männer folgen dem Konvoi in einem blauen Mercedes. In Kolks Wald finden sie ihn, nackt bis auf Gummistiefel, Badehose und einen schwarzen Motorradhelm. Er hat einen Hund bei sich, hält einen Spaten in der Hand und war augenscheinlich gerade mit Erdarbeiten beschäftigt. „Ich wollt nur mal meine Ruhe haben“, erklärt Mufti. Beim Anblick ihres halb nackten Ehemanns erleidet Anita einen Nervenzusammenbruch und muss zum Auto getragen werden. Die anderen überreden Mufti, ihnen das Tor in dem neuen Elektrozaun zu öffnen, und er führt sie in seine Höhle. Weil der Motorradhelm beim Biertrinken das „Ankoppelungsmanöver Mund-Flaschenschlund“ (Seite 638) behindert, nimmt er ihn endlich ab.
Mufti behauptet, an „Morbus fonticuli“ zu leiden und erklärt seinen Freunden die Krankheit:
„Fontanellen“, sagte ich, „lateinisch fonticuli. Ich benutze das Signifikat metaphorisch, was wiederum wesentlicher Bestandteil meiner Theorie ist. Aber zunächst mal: Per definitionem handelt es sich um die anatomische Bezeichnung für Knochenlücken des Schädels von Neugeborenen […]“
„Nun schließen sich diese Lücken – also, es gibt verschiedene Fontanellen, Fonticulus frontalis, fonticulus maior, fonticulus occipitalis und so fort –; diese Lücken schließen sich in unterschiedlichen zeitlichen Abständen nach der Geburt. Klar. Unsere Spezies hätte nicht überlebt, wenn sie bis ins hohe Erwachsenenalter physisch offen geblieben wäre. Ich bin aber überzeugt, dass sämtliche Fontanellen – insbesondere die kleine am Hinterkopf – metaphorisch betrachtet in der Tat offen bleiben!“
„Was soll das heißen, metaphorisch betrachtet“, sagte Leo. „Offen ist offen, zu ist zu.“
„Das ist ein Paradoxon“, sagte ich. „Da geb ich dir Recht. Und deswegen könnte man meine Theorie des Morbus fonticuli auch umschreiben als Theorie des Metaphorischen Paradoxons. Denn natürlich ist zu zu, aber die Wirkung ist wie die von offen! […]“
„Die Fontanelle – eine Art semipermeable Scheidewand – ist noch durchlässig, obwohl sie physiologisch dicht ist. Am besten stellt man sich das als einen Prozess umgekehrter Osmose vor.“
Ich kippte mir einen gewaltigen Schluck Brandy hinter die Binde.
„Durchlässig für was?“, fragte ich mein Auditorium rhetorisch. „Für eine Art universelles Plasma“, sagte ich, „‚Plasma‘ als Sammelbegriff für die Totalität der Beanspruchung aller fünf Sinne, ein diffuses, indifferentes Aggregat oder Konglomerat aus Giften, fremdem Geschwätz, fremden Gefühlen et cetera, kurz: aus allem was die Welt ist, und die Welt ist bekanntlich alles, was der Fall ist. Manchmal ist das ein Gefühl, als ob man in den Kopf gefickt wird […]“ (Seite 643ff)
Im Klinikum für Psychosomatik und Psychiatrie zu Bad Suden wird Mufti von Nikotin, Alkohol und seiner Verrücktheit entwöhnt. Bei ihrem ersten Besuch in Bad Suden eröffnet Anita ihm, dass sie die Scheidung eingereicht habe. Nach vierzehn Monaten wird Mufti entlassen. Einige Wochen später zieht er in das leer stehende Haus eines Freundes in Griechenland – und beginnt dort im Oktober 1996 mit der Arbeit an dem vorliegenden Schmöker.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Der Roman „Morbus fonticuli oder Die Sehnsucht des Laien“ von Frank Schulz setzt sich aus drei Teilen zusammen. Der erste und der letzte Teil bilden eine Rahmenhandlung. Da verlässt der von Nikotin, Alkohol, Sex und Arbeitslosigkeit zerrüttete Protagonist Mufti unvermittelt seine Ehefrau und wird zehn Tage lang von ihr und seinen Freunden gesucht. Im Zentrum des Romans stehen drei Tagebücher Muftis, in denen er seine Erlebnisse in dem Jahr vor seiner Flucht festhielt und sich an frühere Zeiten erinnerte. Dabei wurde der Narzisst immer stärker zum Hypochonder und Hysteriker.
In den Journalen verwendet Mufti mitunter statt „ich“ das unpersönliche „man“. Aber auch die Rahmenerzählung ist in der ersten Person Singular geschrieben, eine verblüffende Perspektive, da der Ich-Erzähler gar nicht selbst dabei ist, wenn seine Frau und seine Freunde nach ihm suchen.
Auf aberwitzige Weise gelingt es Frank Schulz, Funken aus der Banalität des Alltags zu schlagen, nicht zuletzt, weil er über „ein fledermausfeines Ohr für die Tonfälle der Alltagssprache“ verfügt (Michael Kohtes in „Die Zeit“, Literaturbeilage vom 4. Oktober 2001). Mit überbordender Lust am Fabulieren und Formulieren macht er auch die belangloseste Situation zu einer urkomischen Begebenheit. Dabei verquirrlt er Nonsens und Kalauer, Ironie und Sarkasmus, Satire und Parodie zu einem furiosen Lesevergnügen.
Frank Schulz wurde 1957 in Hagen bei Stade geboren. Sein Debütroman „Kolks blonde Bräute“ erschien 1991 im Haffmans Verlag, Zürich. „Kolks blonde Bräute“, „Morbus fonticuli oder Die Sehnsucht des Laien“ und „Das Ouzo-Orakel“ (Eichborn-Verlag, Mai 2006) bilden zusammen die Hagener Trilogie.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2004
Textauszüge: © Eichborn Verlag