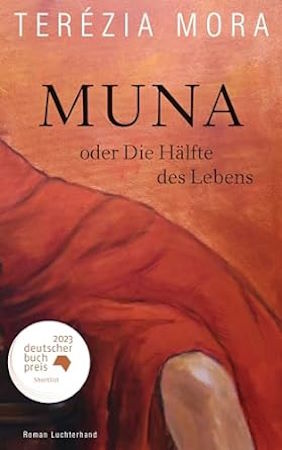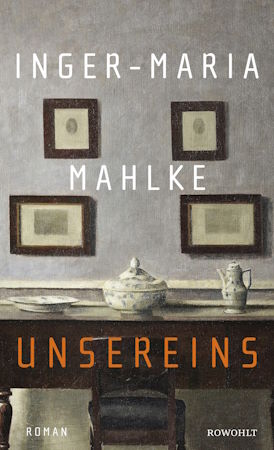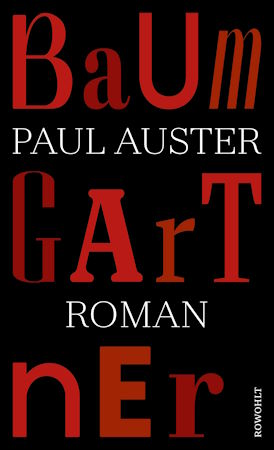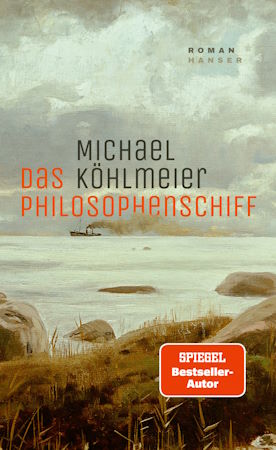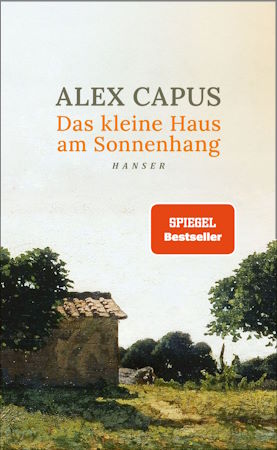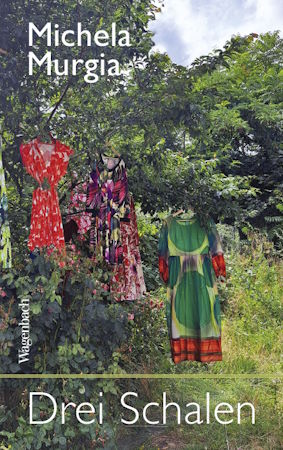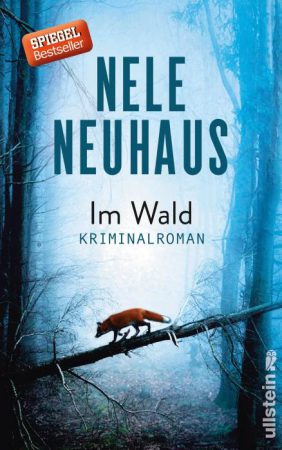Richard David Precht : Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?
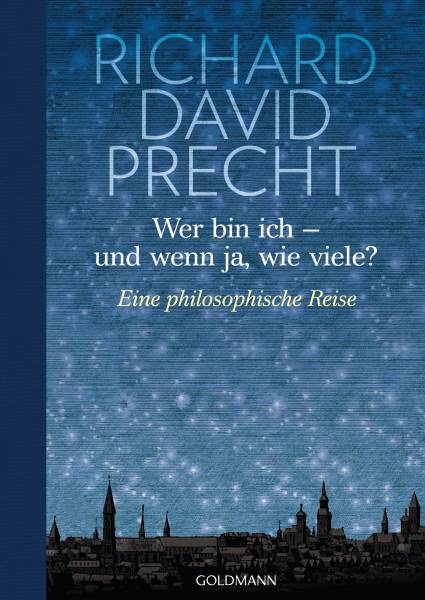
Inhaltsangabe
Kritik
Richard David Precht nennt sein Buch „Wer bin ich – und wenn ja wie viele?“ im Untertitel „eine philosophische Reise“. Wie er im Vorwort erklärt, wollte er keine Philosophiegeschichte schreiben, sondern sich mit drei von Immanuel Kant gestellten Fragen auseinandersetzen: (1) Was kann ich wissen? (2) Was soll ich tun? (3) Was darf ich hoffen? Diese Fragen bilden denn auch die Überschriften der drei Teile des Buches.
Was kann ich wissen?
Die Frage nach dem, was man über sich selbst wissen kann, die klassische Frage der Erkenntnistheorie also, ist heute nur noch sehr bedingt eine philosophische. Weitreichend ist sie vor allem ein Thema der Hirnforschung, die uns die Grundlagen unseres Erkenntnisapparates und seiner Erkenntnismöglichkeiten erklärt. (Seite 15)
Weil der Mensch keine „Sonderanfertigung Gottes“ (Seite 72) ist, sondern ein Ergebnis der Evolution, ist sein Gehirn nicht darauf ausgerichtet, die große Wahrheit zu erkennen, sondern es dient vor allem dazu, die täglichen Anforderungen des Lebens zu bewältigen.
Das Erkenntnisvermögen des menschlichen Geistes, wie Schopenhauer und Nietzsche vorausahnten, steht in einer direkten Abhängigkeit zu den Erfordernissen der evolutionären Anpassung. Der Mensch vermag nur das zu erkennen, was der im Konkurrenzkampf der Evolution entstandene Erkenntnisapparat ihm an Erkenntnisfähigkeit gestattet. Wie jedes andere Tier, so modelliert der Mensch sich die Welt danach, was seine Sinne und sein Bewusstsein ihm an Einsichten erlauben. Denn eines ist klar: All unser Erkennen hängt zunächst einmal von unseren Sinnen ab. (Seite 27)
Das Gehirn ist nicht eine Hardware, die mit dem Geist als Software ausgerüstet ist, sondern beides spielt auf eine untrennbare und sehr komplizierte Weise zusammen. (Seite 57)
Vor 3 Millionen Jahren sei die Größe des Primaten-Gehirns explodiert, erklärt Richard David Precht, aber erst sehr viel später habe der Mensch von seinen dadurch möglichen technischen Innovationsfähigkeiten Gebrauch gemacht. Der amerikanische Hirnforscher Paul D. MacLean (1913 – 2007) behauptete, das menschliche Gehirn sei entsprechend seiner phylo- und ontogenetischen Entwicklung nach wie vor über einem primitiven „Reptilienhirn“ aufgebaut. In MacLeans Vorstellung besteht es aus drei Teilen: dem Reptilienhirn, dem frühen Säugetierhirn und dem Primatenhirn bzw. der Großhirnrinde. Dieses Modell ist inzwischen überholt. Heute unterscheidet man stattdessen zwischen Hirnstamm, Zwischen-, Klein- und Großhirn.
Lässt dieses eigentlich für den Überlebenskampf entwickelte Gehirn Erkenntnisse zu? Unter der Kapitelüberschrift „Ulm. Ein Winterabend im 30-jährigen Krieg. Woher weiß ich, wer ich bin?“ erzählt Richard David Precht, wie René Descartes (1596 – 1650) erst einmal alles bezweifelte.
Doch halt – gibt es nicht etwas, woran ich auf gar keinen Fall zweifeln kann? Denn wenn ich an allem zweifle, so kann ich doch nicht daran zweifeln, dass ich zweifle und dass ich es bin, der zweifelt. Und wenn ich weiß, dass ich, während ich zweifle, zweifle, so muss ich denken, dass ich zweifle. Es gibt also eine unbezweifelbare Gewissheit, ein erstes, allem anderen vorausgehendes Prinzip: Cogito ergo sum – „Ich denke, also bin ich“. (Seite 52)
René Descartes nahm sich vor, nichts für wahr zu halten, was sich nicht schrittweise und lückenlos beweisen lässt. Weil er davon gehört hatte, was Galileo Galilei widerfahren war, veröffentlichte er seine „Abhandlung über die Methode des richtigen Vernunftgebrauchs und der wissenschaftlichen Wahrheitsforschung“ 1637 vorsichtshalber anonym.
René Descartes hatte das Ich zum Zentrum der Philosophie gemacht. Aber gibt es das Ich überhaupt? Der schottische Philosoph David Hume (1711 – 1776) hielt das Ich für eine Illusion, und viele moderne Hirnforscher teilen seine Überzeugung.
Viele Hirnforscher neigen dabei der Ansicht zu, dass es nicht ein Ich gibt, sondern viele verschiedene Ich-Zustände: mein Körper-Ich sorgt dafür, dass ich weiß, dass der Körper, mit dem ich lebe, tatsächlich mein eigener Körper ist; mein Verortungs-Ich sagt mir, wo ich gerade bin; mein perspektivisches Ich vermittelt mir, dass ich der Mittelpunkt der von mir erfahrenen Welt bin; mein Ich als Erlebnissubjekt sagt mir, dass meine Sinneseindrücke und Gefühle tatsächlich meine eigenen sind und nicht etwa die von anderen; mein Autorschafts- und Kontroll-Ich macht mir klar, dass ich derjenige bin, der meine Gedanken und meine Handlungen zu verantworten hat, mein autobiografisches Ich sorgt dafür, dass ich nicht aus meinem eigenen Film falle, dass ich mich durchgängig als ein und derselbe erlebe; mein selbstreflexives Ich ermöglicht mir, über mich selbst nachzudenken und das psychologische Spiel von „I“ and „Me“ zu spielen; das moralische Ich schließlich bildet so etwas wie mein Gewissen, das mir sagt, was gut und was schlecht ist. (Seite 69)
Sigmund Freud (1856 – 1939) unterschied im „psychischen Apparat“ zwischen drei Instanzen: Dem „Es“ (Unterbewusstsein), dem „Ich“ (Vermittlungsinstanz zwischen „Es“ und Außenwelt) und dem „Über-Ich“ (Leitbilder, Wertvorstellungen, Handlungsnormen, Gewissen).
1917 stellt er seine Entschlüsselung des Unbewussten in eine Reihe mit den Theorien von Kopernikus und Darwin. Alle drei hätten sie die Menschheit gekränkt. Kopernikus hatte die Erde vom Mittelpunkt der Welt an den Rand gerückt. Darwin hatte die göttliche Natur des Menschen gegen eine Affennatur ersetzt. Und Freud habe dem Menschen gezeigt, dass er kein Herr im eigenen Haus ist, weil das Unbewusste viel dominanter sei als das Bewusste. (Seite 88)
Von der Frage nach dem Ich – „wer bin ich?“ – kommt Richard David Precht zum Thema Gedächtnis und Erinnerungen.
[…] ist das Gedächtnis nicht so etwas wie unsere Identität? Was wären wir ohne unsere Erinnerung? Nicht nur hätten wir ohne Erinnerung keine Biografie, wir hätten auch kein Leben, jedenfalls kein bewustes. Verstehen bedeutet, etwas auf etwas anderes zu beziehen, das wir kennen. Und kennen tun wir nur das, was wir gespeichert haben. (Seite 100f)
Weitere Themen in „Was kann ich wissen?“: Was sind Gefühle? Was ist Sprache?
Was soll ich tun?
Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) behauptete, Kultur und Gesellschaft hätten den Menschen nicht besser, sondern schlechter gemacht. Er war davon überzeugt, dass das Böse erst mit der Vergesellschaftung begann. Erst in der Gesellschaft hassen sich die Menschen, betrügen einander und trachten sich gegenseitig nach dem Leben. Die Vernunft zeigt dem Menschen nicht das Gute, sondern was für ihn vorteilhaft ist. Der englische Biologe Thomas Henry Huxley (1825 – 1895) widersprach Rousseau 1893 in seinem Vortrag „Evolution und Ethik“ und vertrat die Meinung, der Mensch müsse durch die Zivilisation gebändigt werden. Das hatte bereits Thomas Hobbes (1588 – 1679) gelehrt. Ihm zufolge ist der Mensch im Naturzustand des Menschen Wolf („homo homini lupus“).
Der niederländische Zoologe und Verhaltensforscher Frans de Waal (* 1948) kommt dagegen aufgrund seiner jahrzehntelangen Beobachtung von Affen zu dem Schluss, dass es bereits im Tierreich Altruismus gibt. Es handelt sich dabei um Verhaltensweisen, die sowohl für den Einzelnen als auch für die Gruppe vorteilhaft sind.
Immanuel Kant (1724 – 1804) ging davon aus, dass uns die Vernunft sagt, was wir zu tun haben und dass wir verpflichtet sind, gut zu sein. Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) widersprach Kant: Nicht die Vernunft, sondern der Wille bestimme das menschliche Tun.
Er hatte den „Grundirrtum aller Philosophen“ erkannt und mit ihm die, wie er meinte, „größte aller Illusionen“: dass es nämlich ausreiche zu wissen, was das Gute ist, um es auch tun zu können. (Seite 150)
Richard David Precht konstatiert:
Der Mensch ist ein moralbegabtes Tier. Die Fähigkeit zur Moral ist angeboren, aber wie weit, lässt sich nur schwer sagen. Das Primatengehirn stellt Möglichkeiten bereit, sich in andere hineinzuversetzen, und es kennt (neurochemische) Belohnungen für „gute“ Taten. Ethisches Verhalten ist ein komplexer Altruismus. Er besteht sowohl aus Gefühlen wie aus Abwägungen. Es gibt kein „moralisches Gesetz“ im Menschen, wie Kant meinte, das ihn zum Gutsein verpflichtet. Aber moralisches Handeln ist entstanden, weil es sich oft für den Einzelnen und für seine Gruppe lohnt. Wie stark er davon Gebrauch macht, ist sehr weitgehend eine Frage der Selbstachtung, und diese wiederum eine Frage der Erziehung. (Seite 176)
Der amerikanische Physiologe Benjamin Libet (1916 – 2007) wies 1979 mit einem Experiment (Libet-Experiment) nach, dass der Handlung – in diesem Fall einer Handbewegung – zwar eine bewusste Entscheidung vorausgeht, die jedoch ihrerseits erst kurz nach einem im Gehirn messbaren Impuls erfolgt. Dieser Gehirnimpuls bleibt unbewusst.
Libet war in höchster Aufregung: Die Patientin hatte sich entschieden zu handeln, eine halbe Sekunde bevor sie um diese Entscheidung wusste! (Seite 152)
Der freie Willen beschränke sich auf eine Veto-Funktion, erklärte Benjamin Libet. Die Handlung könne bis etwa 50 Millisekunden vor der Muskelaktivierung abgebrochen werden.
Ausführlich geht Richard David Precht in „Wer bin ich – und wenn ja wie viele?“ auf den von Jeremy Bentham (1748 – 1832) begründeten Utilitarismus ein, demzufolge eine Handlung auch ethisch nach ihrer Nützlichkeit bewertet wird. Ziel ist es, das aus dem Glück Einzelner aggregierte Glück der Allgemeinheit zu maximieren und das Unglück zu minimieren. Durch das utilitaristische Prinzip lässt sich zum Beispiel die Legitimität des Tyrannenmordes begründen: Es wäre die moralische Pflicht der Zeitgenossen gewesen, Adolf Hitler zu töten, um weiteres Leid zu verhindern. Augenzwinkernd fragt Richard David Precht, ob er nicht auch seine böse Erbtante Bertha umbringen müsse, damit er mit ihrem stattlichen Vermögen Gutes tun könne. Und er berichtet in diesem Zusammenhang von Experimenten des Harvard-Psychologen Marc Hauser, der Probanden fragte, wie sie sich in folgender Situation verhalten würden: Ein leerer Waggon rast auf fünf Gleisarbeiter zu, die nichts davon merken. Wenn der Proband die Weiche umstellt, rettet er die fünf Männer – allerdings wird der Waggon dann einen einzelnen Gleisarbeiter töten. Fast alle Befragten würden die Weiche umstellen und den Tod eines Menschen in Kauf nehmen, um fünf andere zu retten. Das wäre ganz im Sinne des Utilitarismus. Allerdings gibt Richard David Precht zu bedenken, dass es nicht immer so einfach wie in diesem Gedankenexperiment ist, die Folgen einer Tat abzuwägen.
Im nächsten Kapitel seines Buches „Wer bin ich – und wenn ja wie viele?“ beschäftigt er sich mit dem Thema Abtreibung.
Das Recht auf Leben, sein Wert und seine Würde, beginnen […] nicht beim Zeugungsakt. Es ist deshalb nicht einzusehen, warum Embryonen bis zum dritten Monat nicht abgetrieben werden dürfen. Bei weiter entwickelten Föten ist die Sache problematischer. Eine Tötung ist von Monat zu Monat eine moralisch bedenklichere Sache. (Seite 195)
Ebenso vage bleibt Richard David Prechts Stellungnahme zur Sterbehilfe:
Was heute im Einzelfall in der Grauzone von passiver, indirekter und aktiver Sterbehilfe in deutschen Krankenhäuern tatsächlich geschieht, dürfte allemal besser sein als eine rechts- und moralphilosophisch klare und eindeutige Position für die aktive Sterbehilfe. (Seite 208)
Kaum klarer ist seine Meinung zum Thema Fleisch-Konsum.
Genau genommen, wissen wir Menschen ja noch nicht einmal, inwieweit nicht auch Pflanzen leiden können. Ob der Salat wohl Schmerzen empfindet, wenn man ihn aus der Erde reißt? Das Empfinden von Schmerzen ist also keine klare Grenze. (Seite 214)
Die Frage, inwieweit man sich durch kluge Überlegungen vom Fleischessen abbringen lassen will, muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn man vernünftig darüber nachdenkt, dann wird man wohl sagen müssen, dass die Argumente gegen das Fleischessen wahrscheinlich besser und einleuchtender sind als die Argumente, die dafür sprechen. Die utilitaristischen ebenso wie der Verweis auf die moralische Intuition. Ob man nun ganz auf das Steak, den Hamburger und das Brathähnchen verzichtet oder einfach nur etwas seltener als bisher Fleisch isst, hängt sehr davon ab, wie stark man sich selbst in dieser Frage sensibilisiert oder sensibilisieren lässt. (Seite 219f)
Im Kapitel über Gentechnik, Klonen und Stammzellforschung schreibt Richard David Precht:
Wägt man auf utilitaristische Weise das mutmaßliche Glück aus den Heilsversprechen der embryonalen Stammzellforschung mit jenen aus der adulten Stammzellforschung ab, so erscheint die Forschung mit adulten Stammzellen als der viel bessere Weg. Es bedeutet nicht, dass aus moralischen Gründen niemand mit embryonalen Stammzellen forschen darf, denn die utilitaristische Abwägung kann ja immer nur die vermutlichen Erfolge berücksichtigen. Aber es relativiert den Anspruch, das Selbstverständnis und die gesellschaftliche Bedeutung dieses Forschungszweigs, der sich auf eine so unangenehm pathetische Weise in den letzten Jahren in die Diskussion gebracht hat. (Seite 249)
Unter der Überschrift „Gent. Kinder von der Stange. Wohin führt die Reproduktionsmedizin?“ heißt es:
Was ist schlimm an der Trennung von „lebenswertem“ und „lebensunwertem“ Leben? Die Unterscheidung erinnert uns an die barbarische Grausamkeit der Nationalsozialisten, die geistig und körperlich behinderte Menschen als „lebensunwert“ eingestuft und ermordet haben. Schlimm daran ist, dass ein Staat sich zum Richter über den Lebenswert von Menschen aufgeschwungen hat und dass er Personen ermordet hat, die ein Interesse daran hatten weiterzuleben. Beides ist unbedingt moralisch zu verurteilen. Es ist schwerstes menschenverachtetendes Unrecht.
Treffen diese beiden schwerwiegenden moralischen Verstöße bei der PID [Präimplantationsdiagnostik] zu? Sie treffen nicht zu, denn vier- oder achtzellige Embrybonen sind […] keine Personen. Und es ist nicht der Staat, der hier zur Tat schreitet, sondern es ist eine Auswahl durch die künftigen Eltern […] Bringt dieser medizinische Fortschritt nicht mehr Nutzen als Schaden, mehr Glück als Leid in die Welt?
[…] Was spricht gegen eine Auswahl nach nicht medizinischen Kriterien? Wenn dies erlaubt würde, so befürchten die Kritiker, greift irgendwann jeder darauf zurück, zumindest der, der es sich leisten kann. Wo früher Zufall gewaltet habe, regiere eines Tages nur noch die Willkür des elterlichen Geschmacks […] (Seite 255f)
Richard David Precht kritisiert, das Verbot der Präimplantationsdiagnostik in Deutschland bedeute, dass man Embryos erst nach der Implantation auf Erbkrankheiten untersucht – und dann unter Umständen legal abtreibt.
Wird dabei eine künftige Krankheit diagnostiziert, der die Mutter nicht gewachsen zu sein glaubt, darf sie diesen Fötus bis kurz vor der Geburt abtreiben lassen. Überlebt der Fötus den Abort jedoch, muss sie ihn mit allen zusätzlichen Abortschäden annehmen. (Seite 254)
Weitere Themen in „Was soll ich tun?“: Wie sollen wir mit Menschenaffen umgehen? Warum sollen wir die Natur schützen? Was darf die Hirnforschung?
Was darf ich hoffen?
Anselm von Canterbury (um 1033 – 1109) stellte den ontologischen Gottesbeweis auf:
Da Gott die größte aller möglichen Vorstellungen ist, ist es nicht möglich, dass er nicht existiert. (Seite 279)
Dagegen wandte Thomas von Aquin (um 1225 – 1274) ein, die Vorstellung eines vollkommenen Gottes beweise nicht die reale Existenz eines solchen. Außerdem gebe es die größte aller Vorstellungen gar nicht, denn wie zu jeder Zahl eine Eins addiert werden kann, lässt sich zu jeder Vorstellung eine etwas größere denken. Thomas von Aquin glaubte, Gott stattdessen durch Kausalität beweisen zu können, als erste aller Ursachen, als „unbewegten Beweger“ (Aristoteles). Bertrand Russell (1872 – 1970) bezweifelte jedoch, dass es eine erste Ursache geben muss.
Thomas‘ Theorie von Gott als erster Ursache ist also ein wirklich überzeugender Gottesbeweis. (Seite 287)
Einen anderen Weg, die Existenz Gottes zu beweisen, ging William Paley (1743 – 1805). In seinem 1802 veröffentlichten Buch „Natürliche Theologie“ griff er die schon vor ihm verwendete Uhrmacher-Analogie auf:
Fänden wir einen Gegenstand wie eine Uhr auf der Heide, so zwänge uns – selbst wenn wir nicht wüssten, wie sie entstanden ist – allein ihre Präzision und die Feinheit des Entwurfs zu der Schlussfolgerung, „dass die Uhr einen Schöpfer gehabt haben muss“. (Seite 292)
Folglich, so William Paley, müsse man auch vom lebenden Organismus auf einen „Designer“ schließen. Das tun auch die Anhänger des Kreationismus („Intelligent Design“).
Als nächstes geht Richard David Precht auf Niklas Luhmann (1927 – 1998) ein, den Begründer der soziologischen Systemtheorie.
Bakterien tauschen sich miteinander aus und bilden so ein ökologisches System. Hirnregionen kommunizieren und erzeugen so ein neuronales System, das Bewusstsein. Sind dann nicht auch soziale Systeme, so dachte Luhmann weiter, ein autopoietisches System, entstanden durch sprachliche (also „symbolische“) Kommunikation? (Seite 304)
Auch die Liebe ist demnach ein soziales System, gebildet aus Erwartungen. Oder noch genauer: aus weitgehend erwarteten und somit fest geschriebenen Erwartungen: aus Codes. (Seite 305)
Das Bedürfnis nach Liebe entspringt dabei einer bestimmten Art des Selbstverhältnisses. Je weniger der Mensch durch einen festen Rahmen der Gesellschaft bestimmt und an seinen Ort gestellt wird, umso stärker wird sein Bedürfnis danach, sich selbst als etwas Besonderes zu fühlen – als ein Individuum […] Der einzelne Mensch zerreißt sich heute in lauter verschiedenen Teilbereichen: Er ist Familienvater oder Mutter, er erfüllt eine Rolle im Beruf […] Eine einheitliche Identität bildet sich auf diese Weise nur schwer. Was fehlt, ist eine Bestätigung, in deren Spiegel sich der Einzelne als etwas Ganzes erfährt, eben als Individuum.
Diese „Selbstdarstellung“ leistet nach Luhmann die Liebe – das ist ihre Funktion. Eine sehr seltene und deshalb „unwahrscheinliche“ Form von Kommunikation, aber immerhin eine ganz normale. Liebe ist demnach die ganz normale Unwahrscheinlichkeit, „im Glück des anderen sein eigenes Glück zu finden“. (Seite 305f)
Niklas Luhmann ignorierte Biologie und Physiologie. Heute gilt es jedoch als wahrscheinlich, dass das Peptidhormon Oxytocin an der Bindungslust und
–fähigkeit beteiligt ist.
Folgende Inschrift las Richard David Precht auf einer Steintafel in einer Taverne auf Naxos:
To be is to do – Sokrates
To do is to be – Sartre
Do be do be do – Sinatra (Seite 313)
Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ging davon aus, dass der Einzelne sich durch seine Handlungen überhaupt erst definiert: „Die Existenz geht der Essenz voraus.“ So formulierte er die Grundthese des Existenzialismus und meinte damit, dass es anfangs nur die bloße Tatsache des Daseins gebe, eine Phase, in der das menschliche Individuum weder gut noch böse, sondern neutral wie die unbelebte Realität sei. Erst im Handeln entscheide sich das Individuum und entwickle einen bestimmten Charakter. Dabei sei jeder auf sich selbst angewiesen, ohne sich an vorgegebenen Werten orientieren zu können, und es komme darauf an, sich dieser Verantwortung zu stellen, sich nicht hinter Traditionen und Religionen, Doktrinen und Ideologien zu verschanzen – auch wenn es Angst hervorrufe.
Richard David Precht meint dazu:
Die Antwort auf die Frage, ob die psychische Grundausstattung das Handeln bestimmt oder das Handeln die Psyche, lautet also: sowohl als auch. (Seite 324)
Für Robinson Crusoe spielte es keine Rolle, ob ihm die Dinge auf der Insel gehörten oder nicht. Die Frage nach dem Eigentum wird erst relevant, wenn andere Personen da sind, die es einem streitig machen könnten. In der modernen Industriegesellschaft definieren sich die Menschen allerdings in hohem Maße über ihren materiellen Besitz.
Noch nie freilich gab es in der Geschichte der Menschheit eine Gesellschaft und einen Lebensstil, der sich in einem solchen Maße über den Erwerb von Eigentum definiert hätte, wie es heute in der industrialisierten Welt der Fall ist.
Die Frage „Was ist Eigentum?“ ist also nicht nur eine juristische, sondern auch eine psychologische Frage. Denn Eigentum bietet eine vergleichsweise stabile Möglichkeit, sich emotional auszudehnen – wenn auch mitunter auf Kosten alternativer sozialer Ausdehnungsmöglichkeiten. (Seite 334)Der Traum von der finanziellen Unabhängigkeit ist heute noch immer der am weitesten verbreitete Lebenstraum in den Industriestaaten. Genau dafür rackern wir uns ab und investieren die größte Zeit unseres Lebens, obwohl die meisten von uns nie wirklich so weit kommen, tatsächlich „frei“ zu sein. Geld und Prestige stehen auf der höchsten Stufe unseres persönlichen Wertesystems noch vor Familie und Freunden. Dies ist umso erstaunlicher, als dass die Werteskala der Glücksökonomen genau andersherum ausfällt […] Sie opfern ihre Freiheit und ihre Selbstbestimmung für ein höheres Einkommen. Und sie kaufen Dinge, die sie nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht mögen, mit Geld, das sie nicht haben. (Seite 350)
Damit sind wir beim Thema Glück.
Folgt man Epikurs Lehren, dann ist ein „Epikuräer“ ein ausgeglichener Mensch, der sein Glück aus den vielen kleinen Freuden des Lebens zieht, der seine Ängste besiegt und der gesellig und verträglich mit anderen lebt. (Seite 362)
Zwei Strategien zum Glück lassen sich unterscheiden: Selbstbewusste Optimisten versuchen, sich Lustgewinne zu verschaffen, ängstlichere und vorsichtigere Menschen zielen eher darauf ab, Leid zu vermeiden. Auf jeden Fall, so Richard David Precht, muss Glück aktiv hergestellt werden.
Mit anderen Worten: Glück ist schön, macht aber viel Arbeit. (Seite 362)
Nachdem er sieben Regeln aufgelistet hat, die zum Glück verhelfen, meint er:
[…] ganz so einfach ist das mit diesen Regeln nicht. Es genügt eben nicht, auf sie hinzuweisen. Die spannendste und von den Glückspsychologen bislang auch am stärksten vernachlässigte Frage ist: Wie groß ist denn überhaupt mein persönlicher Spielraum? Die Positive Psychologie schöpft zwar jedes neue Ergebnis der Hirnfoschung aus, aber die Grundsatzdebatte „Kann ich wollen, was ich will?“ wird gerne vermieden. Was nützen die schlauesten Maximen, wenn es mir gar nicht freisteht, sie umzusetzen? (Seite 367)
Zum Schluss beschäftigt Richard David Precht sich mit der Frage nach dem Sinn des Lebens und zieht folgendes Fazit:
Die Frage nach dem Sinn des Lebens kann heute nur noch subjektiv beantwortet werden: Welchen Sinn sehe ich in meinem Leben. Der Grund dafür ist einfach. Sinn ist keine Eigenschaft der Welt oder der Natur, sondern eine typisch menschliche Konstruktion. „Sinn“ ist ein Bedürfnis und eine Idee unserer Wirbeltiergehirne. So gesehen kann es nicht darum gehen, einen Sinn in der Welt zu finden, sondern wir müssen ihn uns geben. (Seite 374)
In dem von Elke Heidenreich empfohlenen Bestseller „Wer bin ich – und wenn ja, wie viele? Eine philosophische Reise“ demonstriert Richard David Precht (* 1964), dass Philosophen nicht verstaubt sein müssen, sondern ebenso aktuelle wie spannende Fragen stellen können. Er zeigt Querverbindungen auf und verknüpft klassische philosophische Ansätze mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen wie Soziologie, Psychologie, Biologie und Hirnforschung. Obwohl er im Vorwort betont, er habe keine Philosophiegeschichte schreiben wollen, liefert er zu den wichtigsten von ihm angeführten Persönlichkeiten lebendig geschriebene Kurzbiografien. Manches ist szenisch ausgeschmückt.
Gehen wir ins Jahr, sagen wir, 1850. Und gehen wir in Schopenhauers Wohnung in der Schönen Aussicht Nr. 17 in Frankfurt am Main. Es ist früher Morgen. Halt! Er ist noch nicht ansprechbar. Wir müssen erst warten: Zwischen 7 und 8 Uhr ist er aufgestanden und hat sich mit einem kolossalen Schwamm den ganzen Oberkörper kalt gewaschen […] So, jetzt noch eine Stunde warten, dann können wir klingeln. (Seite 153)
Dazu passen lockere Formulierungen.
Machs philosophische Gedanken waren radikal. Für ihn zählte nur, was sich durch Erfahrung belegen ließ oder was man berechnen konnte. Damit fiel der größte Teil aller bisherigen Philosophie durch. Denn indem er alles daraufhin überprüfte, ob es physikalisch richtig war, verabschiedete Mach fast die gesamte Philosophiegeschichte mit einer Vier minus in die Ferien. (Seite 63)
Ein Vergleich von „Wer bin ich – und wenn ja, wie viele? Eine philosophische Reise“ mit „Gödel, Escher, Bach. Ein Endloses Geflochtenes Band“ fällt allerdings zugunsten von Douglas R. Hofstadter aus: Der Amerikaner ist origineller, witziger und brillanter. Richard David Precht reißt eine Fülle von Themen an – das zeigt schon die Zahl der Kapitel, es sind 34 –, bleibt jedoch an der Oberfläche und lässt viele der von ihm gestellten Fragen offen. Das Positive daran ist: Die Lektüre regt zum Nachdenken an.
Wer sich für eine packende Philosophiegeschichte interessiert, dem empfehle ich: „Idee und Leidenschaft. Wege des westlichen Denkens“ von Richard Tarnas.
„Wer bin ich – und wenn ja, wie viele? Eine philosophische Reise“ gibt es auch in einer gekürzten Fassung als Lesung mit Musik (Sprecher: Caroline Mart und Bodo Primus, Random House Audio, Hamburg 2008, 4 CDs, ISBN: 978-3-86604-923-9).
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2009
Textauszüge: © Wilhelm Goldmann Verlag