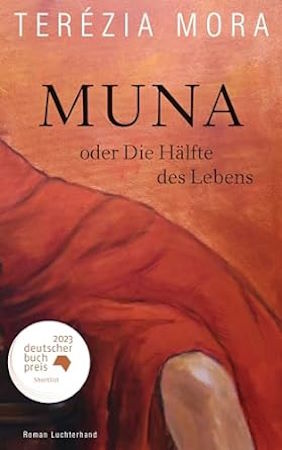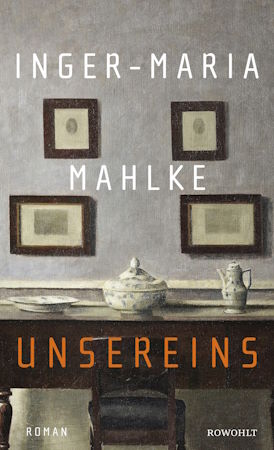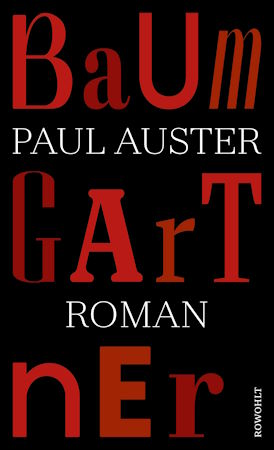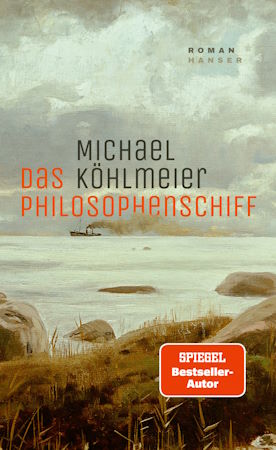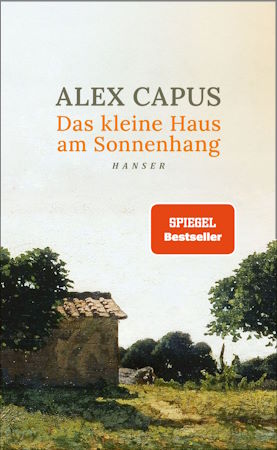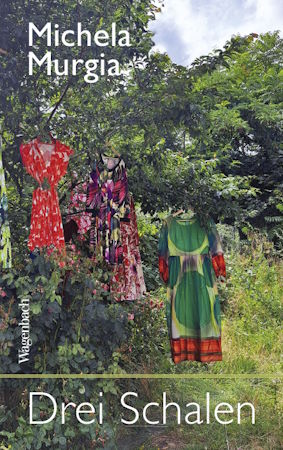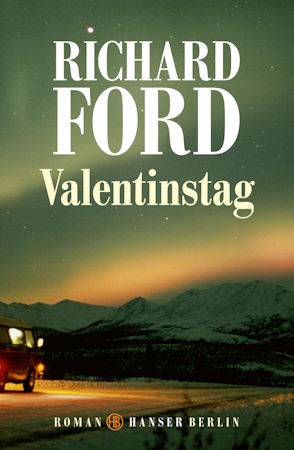Christoph Poschenrieder : Mauersegler
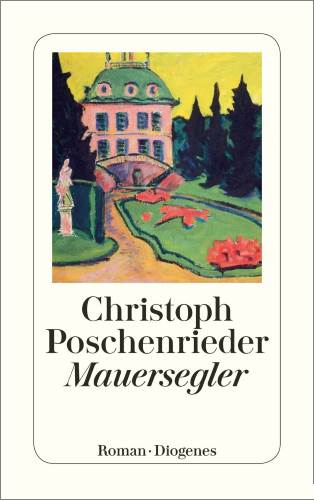
Inhaltsangabe
Kritik
Die Kinder Wilhelm, Heinrich, Ernst, Siegfried, Carl und Martin bildeten eine Clique. Als Martin an einem 2. Dezember vom gemeinsamen Kraterhüpfen nach Hause eilen wollte und die Abkürzung über den zugefrorenen Weiher nahm, brach er ein und ertrank.
Die Überquerung des Weihers im Frühwinter muss ihm jemand eingeredet haben. Einer von uns. Denn Martin war ein ängstlicher Junge, der sich selbst nichts zutraute und nur auf seine Spielkameraden hörte. Wir nutzten das manchmal aus.
Seine Freunde entdeckten die Leiche später am Abend.
Unter dem dünnen, klaren Eis schwebte er mit offenen Augen.
Aber sie schwiegen darüber. Später blieb keiner von ihnen in der Kleinstadt, in der sie aufgewachsen waren, keiner, außer Martin. Obwohl sie an verschiedenen Orten wohnen, sind sie Freunde geblieben. Während des Jahres halten sie lose Kontakt, aber an Martins Todestag treffen sie sich regelmäßig. Das hält sie zusammen. Inzwischen sind sie im Rentenalter.
Wir hatten immer gedacht, wir würden mit dem Sterben und dem Tod vernünftig umgehen. Nicht nur vernünftig, sondern lässig-nonchalant, so wie wir unsere Leben geführt hatten. Wir gutaussehenden, braungebrannten Erfolgstypen. Alphawölfe. Überholspurfahrer. FDP-Wähler, als es die noch gab. Und jetzt ist Heulen und Zähneklappern – Drittezähneklappern.
Nein, so ernst ist die Sache auch wieder nicht. Unsere Komödie – mit ein paar tragischen Einsprengseln, zugegeben – befindet sich nunmehr im finalen, fünften Akt, bevor der Vorhang für den Letzten von uns fällt.
Wilhelm studierte Jura und war zuletzt Chefjustitiar bei Deutschlands größtem Versicherungskonzern. Er wehrte Ansprüche von Versicherten mit juristischen Spitzfindigkeiten ab und pflegte zu sagen: „Es ist zwar nicht recht, aber es ist Recht.“
Der Chemiker Heinrich gilt als „Erfinder der Leberwurst ohne Leber“; er arbeitete als Food Designer bei einem großen „Lebensmittel“-Konzern.“ Obwohl er stolz auf seine Erfindungen ist, wurde er selbst zunächst zum Vegetarier, dann sogar zum Veganer: „Vom konservativen, parteispendenden Lebensmittelchemiker zum missionierenden Müsli-Mann.“
Ernst wurde Programmierer, baute ein Software-Unternehmen auf und brachte es von den fünf allesamt gutsituierten Freunden zum größten Vermögen.
Siegfried machte sich als Theaterregisseur einen Namen, nicht zuletzt durch Provokationen wie die Besetzung der Rolle Gretchens mit einem Afroamerikaner im Rollstuhl.
Carl, der Ich-Erzähler, kann mit seinen vier Freunden finanziell nicht mithalten. In seinem Berufsleben war er Honorarprofessor für Philosophie, und als Journalist brachte er es zum „Chefredakteur eines schöngeistigen Magazins, das ständig über dem Abgrund hing“.
Man hatte uns alles vorgezeichnet: Lernen, Studieren, Arbeiten, Familie, Leben. Die, die ein paar Jahre jünger waren, die machten Revolte.
Bei einem der Treffen an Martins Todestag kommt die Idee einer Altenwohngemeinschaft der fünf Freunde auf. Im Jahr darauf bringt Wilhelm Prospekte von Seniorenresidenzen der oberen Preisklasse mit, und als nächstes fahren sie an die oberitalienischen Seen – „Gardasee, Idro-, Iseosee, dann rüber zu Comer See und zum Lago Maggiore“ – um sich dort nach einer geeigneten Einrichtung umzusehen. Aber sie finden nichts, was ihnen gefällt.
Auch gut. Wir waren im Grunde fünf Jungs aus der Kleinstadt, trotz allem, was wir erreicht hatten. Keine Kosmopoliten. Siegfried brachte uns wiederum rasend schnell zurück nach München, von wo wir uns auf unsere diversen Wohnorte verteilten.
Ein paar Wochen später stehen sie erneut an einem See, diesmal in Deutschland. Ernst hat dort eine riesige Villa gekauft, die eigentlich als Schulungszentrum für sein IT-Unternehmen gedacht war, nun aber seniorengerecht umgebaut wird, gewissermaßen zur „Seenioren-WG“. Hier wollen Wilhelm, Heinrich, Ernst, Siegfried und Carl ihren Lebensabend gemeinsam verbringen. Heinrichs Ehefrau lässt ihre Anwälte prüfen, ob er aufgrund der Entscheidung entmündigt werden könne. Die anderen haben mit ihren Angehörigen bzw. geschiedenen Ehefrauen keine Probleme. Eine Illustrierte schickt eine Reporterin und einen Fotografen für eine Homestory.
Eine Enquête-Kommission „Neuartige Wohnformen im Alter“ des Deutschen Bundestages kündigte sich an und kam doch nicht. Gerüchteweise hieß es, unsere WG erscheine zu elitär.
In der Villa hat nun jeder der fünf Freunde sein eigenes Apartment. Weil noch ein Zimmer unter dem Dach frei ist, suchen sie per Zeitungsinserat nach einem sechsten Mitbewohner. Unter den Interessenten befindet sich der frühere Vorstandsvorsitzende eines großen deutschen Konzerns, der wegen eines Schmiergeldskandals seinen Hut nehmen musste. Er sei ein leidenschaftlicher Teamplayer, erklärt er und fügt hinzu, dass er es selbstverständlich gewohnt sei, im Team die Richtung anzugeben.
Wir hatten ganz sicher keine Lust auf eine feindliche Übernahme. Wieso konnten diese Typen selbst im dritten Jahr ihres Ruhestands nicht von Tyrannosaurus Rex auf Labrador umschalten? Oder wenigstens Dobermann?
Als er merkt, dass die Herren auf Distanz bleiben, versucht er sie mit dem Hinweis zu ködern, dass er günstige Haushaltsgeräte besorgen könne, und einer seiner Söhne bietet Carl insgeheim einen Tausender pro Monat extra an. Jürgen Altmann, den früheren Chef der Staatsbahn und einer Fluglinie, lehnen die fünf Freunde ebenso ab wie alle anderen Bewerber. Lieber bleiben sie unter sich.
Der Veganer Heinrich legt einen Gemüsegarten an, richtet ein Gewächshaus ein und versucht es im Keller mit einer Champignon-Zucht. Wilhelm engagiert sich in der Verbraucherberatung und legt sich ins Zeug, um Versicherungen auszutricksen. Außerdem schlägt er unzählige Golfbälle in den See. Siegfried inszeniert im örtlichen Laientheater zwei Stücke pro Jahr. Ernst baut in drei Kellerräumen eine Modelleisenbahn auf.
Man darf sich das nicht als liebevoll gestaltete Miniaturlandschaft – Grasmatten, Häuschen, kleine Figuren – vorstellen. Ernst interessierte das Netzwerk von Schienen, die Weichen und die Signale und wie in dem System möglichst viele Züge reibungslos herumfahren konnten. Alles andere war ihm nutzloser Zierrat. Dafür baute er natürlich eine eigene Computersteuerung, oder waren es mehrere – wir blickten da nicht im Ansatz durch. Ihn interessierte eine Welt ohne Menschen, ohne deren Unzuverlässigkeit, Fehlerhaftigkeit. […] In den wenigen Momenten, in denen alle seine Züge kreisten (meistens wurde gebaut und verbessert), sah er ihnen gar nicht zu, er schaute auf zwei oder drei Computerbildschirme, die ihm alle wichtigen Zustände der Anlage vermittelten.
Wilhelm schlägt vor, Martin in die Erde des Anwesens umzubetten.
Ein Pfarrer kommt mir nicht aufs Grundstück“, sagte Heinrich. „Hier mit Weihwasser herumspritzen, pfui Teufel, vielleicht noch auf meine Tomaten.“
Weil keine von Martins Angehörigen mehr leben und das Grab samt Pflege seit langer Zeit von den Freunden bezahlt wird, gelingt es ihnen, die Gebeine exhumieren und im Garten der Villa am See neu bestatten zu lassen. Einen Geistlichen lassen sie nicht kommen, aber sie versuchen, dem Ganzen mit Fackeln einen feierlichen Rahmen zu geben, und für das „Wortgeklingel“ ist Carl zuständig.
Zwei Herren vom Bestattungsinstitut hielten sich im Hintergrund und ihre Mützen fest.
Die fünf Freunde wollen nicht nur den Lebensabend miteinander teilen und würdevoll alt werden, sondern auch selbstbestimmt sterben. Zu diesem Zweck schreibt Ernst ein Computerprogramm und richtet es auf einem Rechner ein. Damit kann jeder seinen „Todesengel“ wählen, den Freund, der ihm Sterbehilfe leistet. Das System sei so robust, erklärt Ernst, dass es keiner weiteren Pflege bedürfe und auch nach seinem Tod zuverlässig weiterlaufen werde. Um für den Fall vorzubeugen, dass der „Todesengel“ vor dem Freund stirbt, dem er beim Abgang helfen soll, gibt jeder nicht nur einen Namen an, sondern legt die Reihenfolge fest, in der die vier anderen für ihn da sein sollen. Nur der Letzte wird auf sich selbst angewiesen sein. Die Präferenzen bleiben ein Geheimnis.
Code01
def lebendeUndtote():
try:
dahingegangen = VerstorbenenListe.leseDatei()
for verstorben in dahingegangen:
pos = wg_besatzung.index(verstorben)
wg_besatzung.remove(verstorben)
wg_besatzung.insert(pos,+)
return wg_besatzung
except:
self.log.error(Datei nicht gefunden oder leer)[…]
Code06
def programmBeenden():
dateiliste = (bewohner.log, engel.log,
engelmail.log, intervall.log,
verstorben.log, totmann.log)
for datei in dateiliste:
Dateimanager.schliesse(datei)
self.destroy()
os._exit(1)
Ergänzt wird das „Todesengel“-Programm durch einen Totmannknopf in jedem der fünf Apartments. Wird dieser nicht in den vorgegebenen Zeitintervallen gedrückt, erhält der „Todesengel“ eine SMS bzw. eine Mail mit der Aufforderung, aktiv zu werden. Für diesen Zweck bewahrt jeder der fünf Freunde ein Fläschchen mit einem tödlichen Gift auf. Zur Tarnung steht auf den Etiketten: „Tinctura Valerianae (Baldrian). Für die ‚ewige‘ Ruhe“.
Der Dorfarzt wird bei den Todesfällen nicht so genau hinschauen dürfen, denn er soll unverfängliche Ursachen auf die Totenscheine schreiben. Um sein Wohlwollen zu gewinnen, nimmt Siegfried ihn mit zu Premieren in der Hauptstadt, und Ernst verschafft ihm über seine Stiftung Zugang zu Zelebritäten aus Politik und Wissenschaft.
Und natürlich durfte er bei uns ein und aus gehen. Eine gute Zigarre und ein Gläschen Bordeaux waren immer drin.
Obwohl Wilhelm das Zigarettenrauchen reduziert hat, muss ihm das linke Bein wegen chronischer Durchblutungsstörungen (Raucherbein) abgenommen werden. Danach leidet er unter Phantomschmerzen. Als sich der Beinstumpf entzündet, wird Wilhelm gegen seinen Protest ins Krankenhaus gebracht und in ein künstliches Koma versetzt. Zwar erholt er sich wieder, bleibt aber ein Pflegefall. Deshalb nehmen die Freunde eine Pflegeschwester unter Vertrag und quartieren sie im Dachgeschoss ein. Sie heißt Katarina, ist Mitte 30 und stammt aus Kirgisistan.
Nachdem Carl eine Mail vom „Todesengel“-Programm erhalten hat, geht er spät in der Nacht zu Wilhelm hinüber. In der Aufregung entgleitet ihm das Giftfläschchen; der Hals bricht ab und etwas von der Flüssigkeit wird verschüttet. Mit fünf Schlucken trinkt Wilhelm den Rest aus. Er schläft zwar ein, atmet jedoch weiter. Deshalb erstickt Carl ihn mit einem Kissen.
Ein letztes, leichtes Schütteln kam noch von diesem Körper, so, wie wenn man bei einem alten Mercedes den Diesel abstellt. Und dann war da nur noch abkühlende Wärme, das Knistern der Kühlerhaube, des Motorblocks, der nie wieder angelassen wird.
Am nächsten Morgen findet Katarina den Toten.
Ein wenig von der Asche aus der Urne werfen die vier verbliebenen Freunde in ein am Seeufer entzündetes Feuer, bevor sie das Gefäß mit dem restlichen Inhalt in einen Karton verpacken und mit einem Kurierdienst nach Alaska schicken, wo Wilhelms Sohn eine Lachsfarm betreibt.
Das Ableben geht weiter.
Katarina befürchtet ihre Entlassung, aber die Männer gehen davon aus, dass ihre pflegerischen Dienste bald wieder benötigt werden und beschäftigen sie deshalb vorübergehend im Haushalt. Von einem Besuch in ihrer Heimat Kirgisistan bringt Katarina einen neun oder zehn Jahre alten verwaisten Jungen mit. Er heißt Nooruzbay.
Als Heinrich an Demenz erkrankt und sich immer wieder verläuft, lässt Ernst ihm einen Chip unter die Haut einpflanzen, mit dem er stets elektronisch zu orten ist. Carl erhält erneut eine Mail vom „Todesengel“-Programm. Diesmal bleibt es nicht bei der einen, sondern das System schickt mehrere Nachrichten. Er nimmt an, dass es sich um einen Fehler handelt, kann aber nicht mit Ernst darüber reden, weil er sonst gegen die vereinbarte Vertraulichkeit verstoßen würde. Schließlich kommt der Zufall Carl zu Hilfe: Nach längerer Suche findet er Heinrich auf dem Heuboden, und ein leichter Schubs genügt für einen tödlichen Sturz des Lebensmüden. Weder die Polizei noch der Gerichtsmediziner zweifeln an Carls Aussage, Heinrich sei bereits tot gewesen, als er ihn gefunden habe.
Katarina bringt ein zweites Kind aus Kirgisistan mit. Damit Anarbek im Kreiskrankenhaus operiert werden kann, sammelt Siegfried im Laientheater Spenden, und den noch fehlenden Betrag übernimmt Ernst.
Bei Ernst wird ein nicht mehr behandelbarer Gallenblasen-Krebs diagnostiziert. Wieder erhält Carl eine Mail. Gegen Mitternacht betritt er Ernsts Zimmer. Der Todgeweihte, der seit einem Jahr einen Herzschrittmacher der neuesten Bauart trägt, erklärt dem Freund:
„Die Idee ist: Ich schalte mich einfach ab.“
Dafür hat er zwar ein Programm geschrieben, aber bei der Ausführung des Vorhabens muss Carl ihm helfen, indem er im richtigen Augenblick die blanken Enden von zwei vorbereiteten Drähten zusammenhält. Der Dorfarzt schreibt „plötzlicher Herztod“ auf den Totenschein.
Die Redner standen nachher am Grab herum und wollten zu ihren tiefschürfenden Reden beglückwünscht werden; aber der Einzige, der an diesem Tag tief geschürft hatte, war der Totengräber.
Es stellt sich heraus, dass Ernst die Villa Katarina vermacht und den Freunden Carl und Siegfried ein lebenslanges Wohnrecht eingeräumt hat. Katarina bringt weitere Waisenkinder aus Kirgisistan: Urmat, Aikokul, Chinara und Ainura.
Carl drückt nicht mehr auf den Totmannknopf. Er könnte das Gift auch allein trinken, findet jedoch, dass jetzt einmal ein anderer an der Reihe ist, Sterbehilfe zu leisten. Wie erwartet, hört er nachts die leise quietschenden Räder von Siegfrieds Rollator nahen. Aber dann rumpelt es, und als er hinausgeht, fällt er beinahe über den umgestürzten Rollator. Siegfried liegt mit dem Kopf nach unten auf der Treppe und kann sich nicht mehr bewegen. Der Hals befindet sich über einer Stufenkante. Noch einmal leistet Carl Sterbehilfe.
Ich setzte mein Knie auf seine Schläfe und drückte es ein wenig hinunter. Mein – so geringes – Gewicht genügte. Siegfried muss nicht ins Krankenhaus.
Noch in Nacht fährt Carl mit dem Treppenlift in den Keller, kippt den Rechner um und gießt den Inhalt eines Glases mit sauren Gurken ins Gehäuse. Bevor die verschmorten Teile zu brennen beginnen, zieht er alle Stecker.
Carl erinnert sich, wie Martin starb. Der Freund besaß keine Uhr, musste aber jeweils eine halbe Stunde vor den anderen zum Abendessen nach Hause. Als er wieder einmal befürchtete, zu spät zu kommen, nannte Carl ihm eine falsche Uhrzeit und riet dem wegen seiner Leichtgläubigkeit immer wieder aufgezogenen Freund, die Abkürzung über den zugefrorenen Weiher zu nehmen, um es doch noch rechtzeitig zu schaffen.
Geh übers Eis, wenn es so eilig ist, sage ich. Trägt das?, fragt er. Ja, natürlich, wir sind doch zusammen darauf herumgeschlittert. Trägt das wirklich?, sagt er. Ja, ja, sag ich.
Ich weiß es jetzt, wo die Menschen vorher sind – sie sind, wie der kleine Martin, auf der anderen Seite der Scheibe. Man zeigt ihnen diese Welt (bestimmt nicht alles, nur das Schöne), man fragt sie: Wollt ihr das? Ich sage „man“, mangels genauerer Erkenntnisse. Sie also sagen begeistert ja. Man arrangiert eine Zeugung für sie. Da beginnt es schon mit den Kompromissen. Vielleicht findet sich nur ein Paar in Bangladesch für sie, oder in Kirgisien. Nicht alle wachsen in privilegierten Verhältnissen auf, sie bekommen nicht alle das gleiche Maß an Verstand, Schönheit und Kraft mit.
Aber egal, sobald sie auf dieser Seite der eisigen Scheibe eintreffen, haben sie das sowieso vergessen. Glücklich können sie alle werden; oder nicht.
Mit diesen Worten enden Carls Aufzeichnungen, die von Katarina gefunden werden. Sie schreibt noch dazu:
„Die Alte haben sich alle gegenseitig aus dem Leben geschafft. Habe ich von anfang gewusst, weil ich bin auch nicht bloed.“
Und:
Herr Carl hat gesagt: Kommt nicht drauf an wie alt man wird sondern wie man alt wird.
Sie betreut jetzt bereits zehn Waisenkinder in der Villa am See.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Fünf seit der Kindheit befreundete, inzwischen wohlhabende Greise bilden in der Hoffnung, in Würde altern und selbstbestimmt sterben zu können, eine Wohngemeinschaft. Zu ihrem Pakt gehört, dass sie sich auch gegenseitig Sterbehilfe leisten.
Die Vergreisung der deutschen Gesellschaft, die Übernahme der Pflege alter Menschen durch überforderte Heime und der technische Fortschritt der Apparate-Medizin lassen den Ruf auf Würde trotz Pflegebedürftigkeit und Selbstbestimmung bis zuletzt immer lauter werden. Christoph Poschenrieder beschäftigt sich in seinem Roman „Mauersegler“ mit den Themen Altern, Pflegebedürftigkeit, Sterbehilfe und Tod, ohne die Leserinnen und Leser am Ende erschüttert zurückzulassen, denn er geht damit locker und augenzwinkernd um. „Mauersegler“ ist denn auch mehr oberflächlich unterhaltsam als tiefschürfend, ernsthaft und nachdenklich.
Der Plot von „Mauersegler“ klingt vielversprechend. Während der Lektüre stellt man jedoch fest, dass Christoph Poschenrieder das Potenzial der Grundidee nur zum Teil ausgeschöpft hat. Ein wenig mehr Tiefgang wäre wohl möglich gewesen, ohne die Leichtigkeit aufzugeben. Dazu kommt, dass es sich bei dem in der Alten-WG fürs „Wortgeklingel“ zuständigen Ich-Erzähler Carl nicht gerade um ein Genie handelt und seine Versuche mit Sprachwitz und Situationskomik nicht besonders funkeln.
Bei den Romanfiguren handelt es sich eher um Klischees als um lebensechte Charaktere: der auf seine Finessen stolze Jurist, der Food Designer, der sich selbst vegan ernährt, gerade weil er über die Lebensmittelindustrie Bescheid weiß, der Programmierer, der von einer perfekt funktionierenden Welt träumt, die er sich nur ohne Menschen vorstellen kann, der Theaterregisseur, der die Unsterblichen der Literaturgeschichte totzukriegen versucht, ein auch als Journalist tätiger Philosophie-Professor mit einem Minderwertigkeitskomplex. Aber gerade weil die Männer Stereotype sind, repräsentieren sie die Industrie und den Kapitalismus. „Mauersegler“ lässt sich deshalb auch als Gesellschaftssatire lesen.
Wenn wir uns damit abfinden, dass Christoph Poschenrieder keine facettenreichen Charaktere entwickelt, stört es uns auch nicht, dass ihre Beziehungen zu Angehörigen und anderen Freunden nur kurz und rudimentär abgetan werden.
Der Aufbau von „Mauersegler“ ist gelungen: Carl tritt als Chronist auf und hinterlässt bei seinem Tod eine Mappe mit vollgeschriebenen Blättern, die von der Pflegerin der Männer gefunden und durch einen kurzen Kommentar ergänzt werden.
Dass diese beherzte Frau die sukzessive leer werdende Senioren-Villa zunehmend mit Waisenkindern aus ihrer Heimat Kirgisistan bevölkert, ist eine ebenso schöne wie naheliegende Idee.
In der Natur schreit alles: Du gehst, ich komme. (Die Natur selbst lächelt und sagt: Ich bleibe.)
Ob Leserinnen und Leser, die es nicht gewohnt sind, Computer-Programme zu lesen, viel mit den Einschüben in der Python-Programmiersprache anfangen können, ist zu bezweifeln. Der Einfall ist allerdings sinnvoll, denn diese Passagen in „Mauersegler“ unterstreichen, welche Bedeutung elektronische Maschinen und ihre Logik in unserem Leben (vor allem seit der intensiven globalen Vernetzung) bereits eingenommen haben.
Der titelgebende Mauersegler ist Carls Lieblingsvogel.
Mauersegler können monatelang in der Luft bleiben. Sie essen, trinken, scheißen – alles im Flug. Sie schlafen im Flug. Ich glaube gern, dass sie sich sogar im Flug begatten. Nur das Brüten geht nicht fliegend. In Brehms Tierleben steht: Der Mauersegler ist ein herrschsüchtiger, zänkischer, stürmischer und übermütiger Gesell, der streng genommen mit keinem Geschöpfe, nicht einmal mit seinesgleichen in Frieden lebt und unter Umständen andern Tieren ohne Grund beschwerlich fällt. Einer wie wir.
[…] Mir gefällt die Vorstellung, dass sterbende Mauersegler einfach die Flügel falten und zu Boden stürzen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Vielleicht landen sie für den Fall auch, trippeln ein wenig auf ihren zarten Krallen herum und suchen sich ein Plätzchen und kippen einfach um. Aber das kann nicht sein, das darf nicht sein. Das wäre unwürdig. Sicher kann man das herausfinden, heute sowieso, mit Internet und solchen Dingen, natürlich. Doch manchmal muss man sich vor Wissen schützen. Der Mauersegler legt die Flügel an und will nicht mehr fliegen. So soll es auch mit mir zu Ende gehen.
Christoph Poschenrieder wurde 1964 bei Boston geboren. Nach dem Studium an der Hochschule für Philosophie München und an der Journalistenschule an der Columbia University in New York begann er als freier Journalist und Autor von Dokumentarfilmen zu arbeiten. 2010 veröffentlichte Christoph Poschenrieder seinen ersten Roman: „Die Welt ist im Kopf“. Es folgten: „Der Spiegelkasten“ (2011), „Das Sandkorn“ (2014) und „Mauersegler“ (2015). 2014 wurde Christoph Poschenrieder für den Deutschen Buchpreis nominiert (Longlist).
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2015
Textauszüge: © Diogenes Verlag