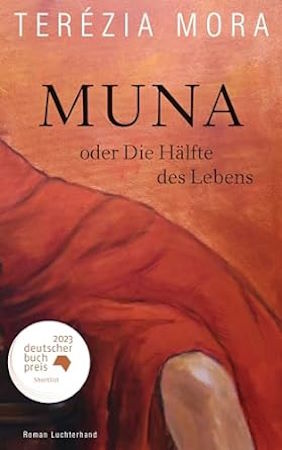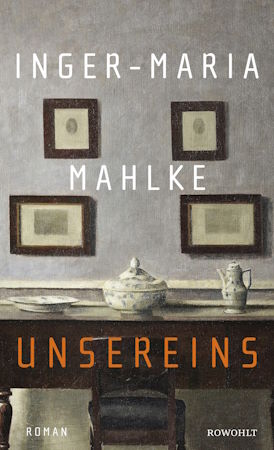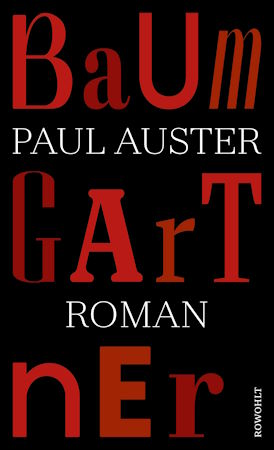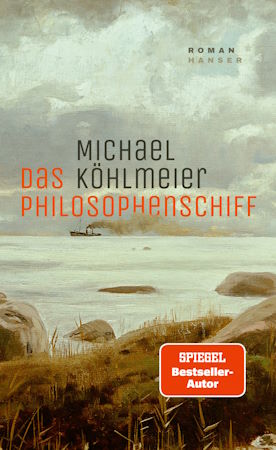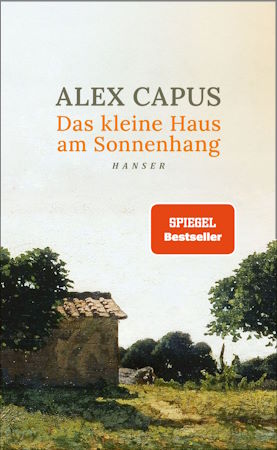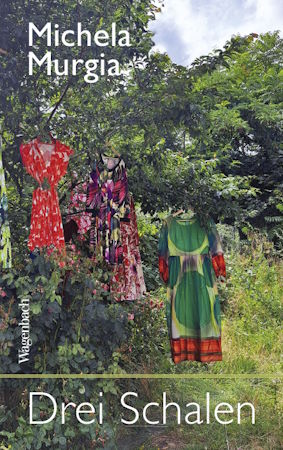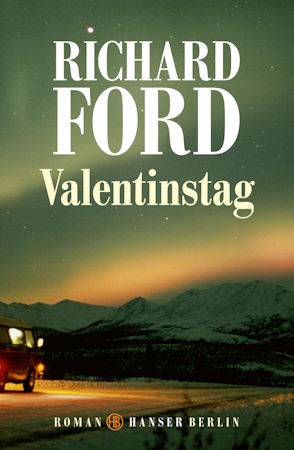Hermann Burger : Erzählungen

Inhaltsangabe
Kritik
„Das Leben ist eine Dissertation über den Tod“, sagt der Großillusionist Grazio Diabelli („Diabelli, Prestidigitateur. Eine Abschiedsvolte für Baron Kesselring“, 1979). Das könnte über einigen Erzählungen Hermann Burgers als Motto stehen.
Seine skurrilen Erzählungen sind von einsamen Sonderlingen bevölkert. Da ist zum Beispiel ein August Schramm, der sich beim Generalmusikdirektor der städtischen Philharmonie um die Stelle des Orchesterdieners bewirbt („Der Orchesterdiener. Ein Bewerbungsschreiben“, 1979). Der bisherige Orchesterdiener Urfer, der wegen seines absoluten Gehörs auch „wandelnde Stimmgabel“ genannt worden war, erlag während eines verpatzten Decrescendos in der a-Moll-Sinfonie von Felix Mendelssohn-Bartholdy hinter der Bühne einem Schlaganfall und sank tot in einen offenen Kontrabasskoffer. August Schramm behauptet in seinem Bewerbungsschreiben, er qualifiziere sich für den Posten, weil kein verkappter Musiker wie Urfer sei: „Ein enthusiasmierter Wagnerianer, ein in tanzendes Quecksilber verwandelter Saint-Saëns-Jünger kommt für den Posten von vornherein nicht in Frage. Ich fordere absolute instrumentale Neutralität.“
Er verspricht, jederzeit auf dem Posten zu sein: „Vorne inexistent, hinten omnipräsent.“ Besonders in der „Ovationsphase“ komme es auf den Orchesterdiener an, denn er habe darauf zu achten, dass der Dirigent während des Beifalls weder zu früh noch zu spät auf die Bühne zurückkehrt. „Der Dirigent ist in diesem Moment eine hilflose Aberntungspuppe an der behaarten Hand des Orchesterdiensters.“
Nicht nur absonderliche Außenseiter, sondern auch „verrückte“ Situationen sind charakteristisch für Hermann Burgers Erzählungen. In „Die Glorietten-Vision. Tagebuch eines Wiener Spitalaufenthalts“ (1983) erleidet der Erzähler einen Herzinfarkt, während er mit Heidelore, Milva und Gutti an der Bar eines Wiener Kabaretts Champagner trinkt. Er versteinert zu einer kardialen Gipsmaske, geht zu Boden und bleibt stöhnend liegen. Das wird missverstanden. Ein „getigertes Tarzanweib“ schleppt den Ächzenden in ein freies Separée, Milva folgt mit einer weiteren Flasche „Witwensprudel“ und klaut ihm die Brieftasche, sozusagen als Sicherheit. Wie soll er der hünenhaften Alexandra, die sich auf ihn wirft, den Unterschied zwischen Herzbeschwerden und Herzenswünschen klarmachen? Schließlich gelingt es ihm, ohne Jackett und Brieftasche zum Ausgang zu kriechen. Wie ein Seesack liegt er dann im Fond des Taxis, das ihn zur Notaufnahme im Kreisky-Spital bringt.
Nach jahrzehntelanger Vorbereitung findet auf Schloss Kaltenstein der vierte Kongress der Waldbrüder-Kongregation statt („Der Eremitenkongress“, 1987). Thema ist „Die Waldeinsamkeit im Zeitalter der Technik unter besonderer Berücksichtigung der Bedrohung unseres Forstbestandes“. Pressefotografen springen über die Blumenrabatten im Schlosshof, während zwei Hostessen in tadellos sitzenden Uniformen die nach und nach eintreffenden Eremiten mit stereotypem Lächeln und einem Apéritif aus Waldmeister und Löwenzahn begrüßen.
Wegen des Schweigegelübdes einigt man sich darauf, bei der Diskussion das Morsesystem zu benützen, in lateinischer Sprache natürlich. Bruder Serafin morst als erstes das Protokoll des vorangegangenen Eremitenkongresses von 1867. Damals war es zu einem Aufstand der Einsiedler gegen das Lotterleben im Mutterhaus Lungernbad gekommen. Nachdem die Ordnung mit Heugabeln und Dreschflegeln wieder hergestellt war, schien es das Zweckmäßigste zu sein, „die Mutterklause in eine Trinkerheilanstalt umzuwandeln, weil dann die meisten Insassen nicht auszuziehen brauchten“. Aber man entschied sich letztlich dafür, in Lungernbad eine Nervenheilanstalt für geistig und seelisch zerrüttete Einsiedler einzurichten.
Nach zehn Stunden Diskussion sind die Teilnehmer hungrig und unruhig geworden. Alle morsen wild durcheinander. Bruder Wunnibald entfacht ein Feuerchen, um mittels Rauchzeichen anzufragen, ob er die Toilette aufsuchen dürfe. Dabei gerät der Tischschmuck in Brand. Einige der Teilnehmer versuchen das Feuer zu löschen, andere stecken Pilze aus der Dekoration an ihre Morsefähnchen und braten sie.
Das Tohuwabohu endet erst, als Altvater Ambrosius auf gut deutsch „Ruhe“ brüllt.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangaben und Rezension: © Dieter Wunderlich 2002
Textauszüge: © S. Fischer Verlag, Frankfurt